
Am Freitag präsentierte US-Präsident Donald Trump das erste offizielle Handelsabkommen seit der Verkündung der Zölle am 2. April. Großbritannien wurde die Ehre zuteil, ein Abkommen zu präsentieren, das einen ersten Hinweis auf die neue Ordnung im internationalen Handel geben könnte. Ein Hebel der USA in den Verhandlungen mit den Handelspartnern scheint der Export von Ethanol zu sein. Die Amerikaner dominieren diesen für den Produktionsprozess und die chemische Industrie fundamentalen Rohstoff mit einem weltweiten Marktanteil von 52 Prozent und legen ihn als Gegengewicht zum Rennen um Zugang zu Seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen in die Waagschale.
Und das mit Erfolg: Großbritannien war bereit, zahlreiche Zugeständnisse zu machen, den heimischen Markt für amerikanische Agrarprodukte zu öffnen und den allgemeinen Basistarif von 10 Prozent US-Zöllen zu akzeptieren, um weiterhin US-Ethanol importieren zu können. Dies dürfte das Handelsdefizit der Briten, die bereits ein jährliches Defizit von etwa 12 Milliarden US-Dollar aufweist, weiter verschärfen. Ein Etappensieg für Trump.
Im Gegenzug streichen die USA Zölle auf den Import von Stahl und Aluminium aus dem Königreich – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Re-Industrialisierung der Vereinigten Staaten. Im Kampf um weltweite Marktanteile und nationale Standortvorteile wird nun um jedes Jota Marge gekämpft. Und dies mit harten Bandagen. In Indien hat man dies zuerst erkannt. Präsident Modi ließ bereits in der vergangenen Woche während der Verhandlungen mit den USA durchblicken, reziproke Zölle auf Autoteile, Pharmazeutika und Stahl vollständig streichen zu wollen – ein klares Bekenntnis der kommenden wirtschaftlichen Supermacht zur Partnerschaft mit den USA.
Ist man in Neu Delhi auf dem Weg, sich enger an die USA zu binden? Und geschieht dies möglicherweise auf Kosten der Integration mit der BRICS-Staatengruppe? Die interne Dominanz Chinas wird in Indien seit jeher kritisch gesehen und die Anbindung an die USA könnte die Rolle des Landes als Scharnier oder „Swing-State“ zwischen den Interessensphären festigen. Auch in diesem Falle scheint sich die harte Linie der US-Regierung in verbesserten Handelsbedingungen für die heimische Wirtschaft auszuzahlen.
In Brüssel zeigt man sich öffentlich bislang wenig verhandlungsbereit. Am Donnerstag präsentierte die Europäische Kommission eine Liste von möglichen Gegenzöllen, die man im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen scharf stellen wird. Käme es dazu, kassierte die EU-Kommission jährlich 95 Milliarden Euro zusätzlich an Zöllen aus dem US-Handel. 75 Prozent dieser Einnahmen landen übrigens unmittelbar in der Kasse der Kommission, die etwa 12 Prozent ihres Jahresbudgets aus Zolleinnahmen finanziert.
Dass Brüssel nicht zu den Apologeten des Freihandels zählt, erklärt sich allein aus dieser zugrundeliegenden Anreizstruktur. Wir werden sehen, ob es Trump gelingen kann, diese harte Nuss zu knacken. Ihm spielen die fortschreitenden De-Industrialisierung und Rezession in den Kernsektoren der Eurozonen-Wirtschaft in die Karten. Während Washington wirtschaftliche Freiheit und Energieautarkie zur neuen Handelsdevise erhebt, versinkt Brüssel im bürokratischen Sumpf: Digitale Überwachungsgeldsysteme (CBDC), wachsender Dirigismus und kleinteilige Marktinterventionen schnüren den Unternehmen die Luft ab und machen Europa für Investoren zunehmend unattraktiv. Das Beispiel Spaniens, wo künftig jede Geldabhebung über 3.000 Euro die Erlaubnis des Staats erfordert, zeigt, dass die Europäer Ernst machen mit dem Aufbau der „Festung“ Europa.
Trump hat mit Blick auf die Europäer deutlich gemacht, dass die Zeit des „Free Lunch“ eines versteckten Euro-Protektionismus passé ist. Die Abwicklung der Regulierungspolitik im Rahmen des „Green Deal“ in den Vereinigten Staaten läutet eine Zäsur in der Handelspolitik ein: künftig werden US-Firmen auf das entfesselte Potenzial ihrer konventionellen Energieträger zurückgreifen, während die EU-Wirtschaft unter der Last von Klimaregulierungen und CO-2-Weltenretterabgaben in die Knie geht.
Dass sich die USA mit der Installation des Interbankenmarkts SOFR (Secured Overnight Financing Rate) die Preissetzungsmacht über Dollarkredite zurückerobern konnten, wird sich in den kommenden Monaten im europäischen Kreditgeschäft materialisieren. Die Zeit der dollarbasierten Nullzinskredite zur Finanzierung marktferner Ideologie im Rahmen des „Green Deal“ steuert in jedem Falle ihrem Ende entgegen.
Künftig sind reale Kollaterale wie US-Staatsanleihen gefragt, um Dollarkredit zu erhalten. Energie, Öl, Gold geben dann den Takt vor – Ressourcen, über die Europa nur sehr begrenzt oder gar nicht verfügt. Europa muss auch nach Jahren der Dauersubvention seiner zweifelhaften Energiewende (Spanien lässt grüßen) 60 Prozent seines Energiebedarfs durch Importe decken. Wird der US-Dollar im Laufe der Zeit wieder aufwerten, muss man buchstäblich mehr Euro drucken, um sich den Greenback und in der Folge die nötigen Energiemengen zu sichern. Ein Teufelskreis.
Bliebe noch China. Peking kämpft seit Jahren gegen den Kollaps seines Immobiliensektors, der in der Pleite von Evergrande einen vorläufigen Höhepunkt erreichte, aber bis auf den heutigen Tag nicht enden will. Fallende Immobilienpreise, in Verbindung mit einem spürbaren Bevölkerungsrückgang, treiben eine deflatorische Spirale an, die nun im Zuge der US-Zölle an Fahrt aufnehmen wird. Die politische Führung Chinas flüchtete sich in den vergangenen Krisenjahren zur Stabilisierung der Konjunktur in einen aggressiven Ausbau des Exportgeschäfts.
Trump hat am 2. April in diese künstliche Blase gestochen und damit einen weiteren deflatorischen Dschini aus der Lampe befreit. Die im April um 2,7 Prozent gefallenen chinesischen Produzentenpreise lassen für den weiteren Verlauf Böses ahnen: China erstickt an seiner eigenen Überproduktion, Fabriken werden vorläufig geschlossen, die Arbeitslosigkeit steigt. Was wir erleben, ist kein gewöhnlicher Handelskrieg. Es ist der Todesstoß für das Narrativ der chinesischen Übermacht auf den Exportmärkten, eine heraufziehende Legitimationskrise der Kommunistischen Partei im Binnenverhältnis zur Bevölkerung, die den Versprechen des 5-Jahresplans ewigen Wachstums bislang stillschweigend gefolgt war.
Auch geldpolitisch offenbart sich die Fragilität der chinesischen Wirtschaft. Während die amerikanische Notenbank Kurs und Zinsen hoch hält, wird der chinesische Kontrapart zu Liquiditätsinjektionen und Zinssenkungen gedrängt. Der Yuan muss abwerten, der Kreditmotor anspringen, um die Wirtschaft kurzfristig zu stabilisieren – koste es, was es wolle. Dass sich die chinesische Führung im Machtpoker mit Trump in dieser Woche zuerst bewegte, wie Reuters berichtete, ist mehr als nur symbolisches Handeln: Man spürt den wachsenden Druck auf dem Kessel einer in eine nicht endende Deflation taumelnde Wirtschaft und versucht sich aus dem Klammergriff der USA zu befreien. Und man sollte in Peking nicht davon ausgehen, dass die Europäer zur Rettung eilen und ihren eigenen Binnenmarkt mit chinesischer Ware fluten.
Chinesische Handelspartner wie Indien, Vietnam oder auch Japan wittern die Schwäche Pekings und führen bilaterale Gespräche mit den USA. Wenn es Trump gelingt, diese Allianzen wenigsten in Teilen zu sprengen, gerät das gesamte Projekt der BRICS, das auf einem chinesischen Machtmonolithen ruht, ins Wanken.
Die USA haben das Weltgefüge mächtig ins Wanken gebracht. Sollten die selbst hochverschuldeten Amerikaner Kurs halten und eine eigene Schuldenkrise erfolgreich hinauszögern, kann es Trump tatsächliche gelingen, die Machtverhältnisse auf den Weltmärkten zugunsten der USA neu zu justieren.
Die Frage ist: an welchen Stellen entwickeln sich aus systemischen Rissen veritable Krisen? Wer ist bereit, innenpolitischen Schmerz zur Anpassung an die neuen ökonomischen Gegebenheiten zu verordnen? Zur Therapie zählen ordnungspolitische Reformen, Marktöffnung, Senkung der Fiskallasten und ein Rückbau des Alimentierungswesens, das in Staaten wie Deutschland jedes verständliche Maß überschritten hat. Die Katharsis wird kommen, sie ist nötig und sie war unvermeidlich. Donald Trump hat sie nicht verschuldet. Er hat lediglich den Ballon der Illusionen angestochen.





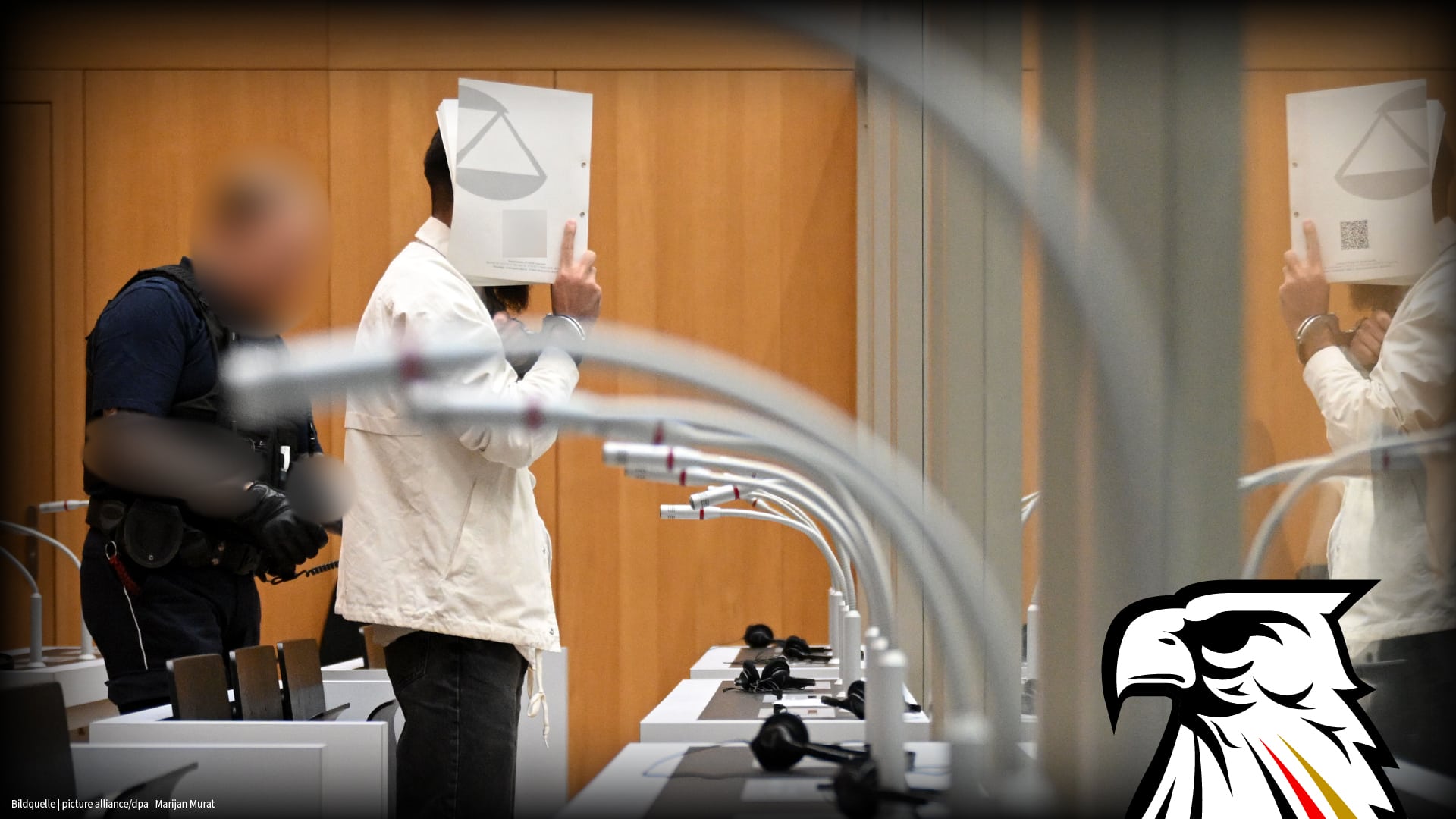




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























