
Bei der Betrachtung der öffentlichen Verschuldung blicken wir gewöhnlich auf eine statische Größe, die sogenannte Staatsschuldenquote. Sie setzt die bestehenden Verbindlichkeiten der öffentlichen Hand in eine Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Im Falle der Bundesrepublik, die im Moment eine Gesamtverschuldung von 2,7 Billionen Euro aufweist, ergibt dieser Quotient eine Staatsverschuldung von etwa 64 Prozent. Damit findet sich das Land im unteren Bereich des europäischen Schuldenrankings wieder.
Das Problem an der Staatsschuldenquote ist, dass sie eine statische Betrachtung darstellt, die Zahlungsverpflichtungen der Zukunft nicht einbezieht. Politisches Handeln, wie auch der Wettbewerb der Parteien untereinander, führt in der Regel zu zeitlichen Verzögerungen der Zahlungsverpflichtungen, die auf politische Versprechungen folgen.
Um daher die tatsächliche fiskalische Situation eines Staates präziser zu erfassen, lohnt es sich, bei der Kalkulation die Regeln der klassischen Unternehmensführung anzuwenden. Das bedeutet, sowohl die zu erwartenden Einnahmen als auch die bereits kontraktierten Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft abzuwägen.
Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen hat genau das in seiner Studie „Generationenbilanz: Deutschlands verheimlichte Schuldenlast“ getan und eine sogenannte Nachhaltigkeitslücke berechnet. Diese integriert sowohl die offenen als auch die verdeckten Staatsschulden in eine Gesamtrechnung und ermittelt, inwieweit diese durch Steuereinnahmen gedeckt sind.
Raffelhüschen quantifiziert die sogenannte Nachhaltigkeitslücke Deutschlands auf 19,5 Billionen Euro. Das entspricht rund 454 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Summe umfasst sowohl offene Staatsschulden als auch verdeckte Verpflichtungen aus Renten-, Gesundheits- und Sozialversicherungssystemen.
Folgt man den Zahlen, so befindet sich Deutschland längst in einer Schuldenspirale. Ändern sich die derzeitigen Finanzströme der Staatskassen nicht strukturell, wird diese Lücke bis 2040 um mehrere Billionen Euro anwachsen.
Raffelhüschens Gutachten sendet eine deutliche Warnung an die Bundesregierung: Die bisherigen Reformbemühungen reichten nicht annähernd aus, um eine drohende Finanzkrise abzuwenden. Zentraler Kritikpunkt Raffelhüschens bleibt demzufolge die politische Tatenlosigkeit: Die bisherigen Schritte zur Stabilisierung der Sozialkassen seien zu fragmentarisch und zielten nicht auf eine nachhaltige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ab.
Darüber hinaus bemängelt er die fehlende Transparenz: Die realen Schulden und zukünftigen Verpflichtungen werden seiner Ansicht nach oft nur unvollständig offengelegt, sodass Politik und Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Lage erhalten. Diese Intransparenz erschwere fundierte politische Entscheidungen und unterminiere das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Führung der Staatsfinanzen.
Nicht zuletzt der demografische Wandel stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Ohne entschlossene Reformen könnten Renten- und Gesundheitssysteme mittelfristig nicht mehr tragfähig sein, was den Finanzdruck weiter verschärfen wird – ein Teufelskreis, aus dem letztlich nur harte Reformen herausführen werden.
Auf Basis seiner Analysen formuliert Raffelhüschen konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik. Eine Maßnahme, die auf maximalen Widerstand vor dem Hintergrund der öffentlichen Debatte um die Armutszuwanderung in die deutschen Sozialsysteme stößt, ist das Einfrieren der Rentenbezüge zur Stabilisierung der Rentenversicherung.
Bemerkenswert ist, dass Raffelhüschen in seinem aktuellen Gutachten die Auswirkungen der Migration erneut unberücksichtigt lässt – obwohl sie eine zentrale Rolle für die Tragfähigkeit der Sozialsysteme spielt. In früheren Arbeiten betonte er, dass gezielte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte entscheidend ist, um Renten- und Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren. Dass dieses fundamentale Thema diesmal ausgespart wurde, schwächt die Aussagekraft der Analyse und lässt wichtige politische Handlungsfelder unbehandelt. Dieses fundamentale Problem wurde nicht thematisiert, was die Ergebnisse der Analyse massiv verzerrt.
Entscheidend bei der Reform der Rentenversicherung, so Raffelhüschen, sei die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 69 Jahre. Gleichzeitig empfahl er die Abschaffung von Subventionen für den vorgezogenen Ruhestand, die derzeit die Staatsfinanzen zusätzlich belasten. Gerade die Rente mit 63 gilt als eines der prominentesten Wahlgeschenke der letzten Jahre. Sie hat dem Arbeitsmarkt eine große Zahl an Fachkräften entzogen und die Finanzlage der Rentenkasse erheblich belastet. Das muss enden, so viel ist klar.
Im Gesundheitsbereich rät das Gutachten zu marktorientierten Reformen. Gesundheitsprämien sowie eine stärkere Einbindung steuerfinanzierter Elemente, um die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern, sollen den Weg aus der Finanzklemme weisen.
Die Bundesregierung zeigt sich bislang weitgehend untätig, obwohl die Krise der Sozialsysteme offenkundig ist. Bundeskanzler Merz machte auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen zwar deutlich, dass Deutschland über seine Verhältnisse lebe und harte Reformen zur Konsolidierung des Sozialstaats notwendig seien. Konkrete Strategien, wie die drohende Finanzlücke von 172 Milliarden Euro zwischen 2027 und 2029 geschlossen werden soll, blieb Merz jedoch schuldig.
Wie man einer Verschärfung der sich vertiefenden Rezession mit dramatischen Folgen für die Finanzlage der öffentlichen Kassen begegnen will, steht in den Sternen.


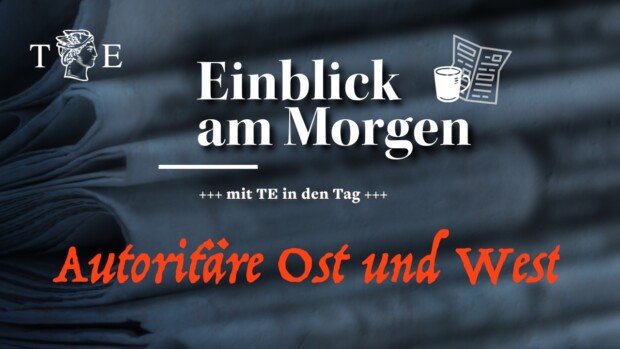



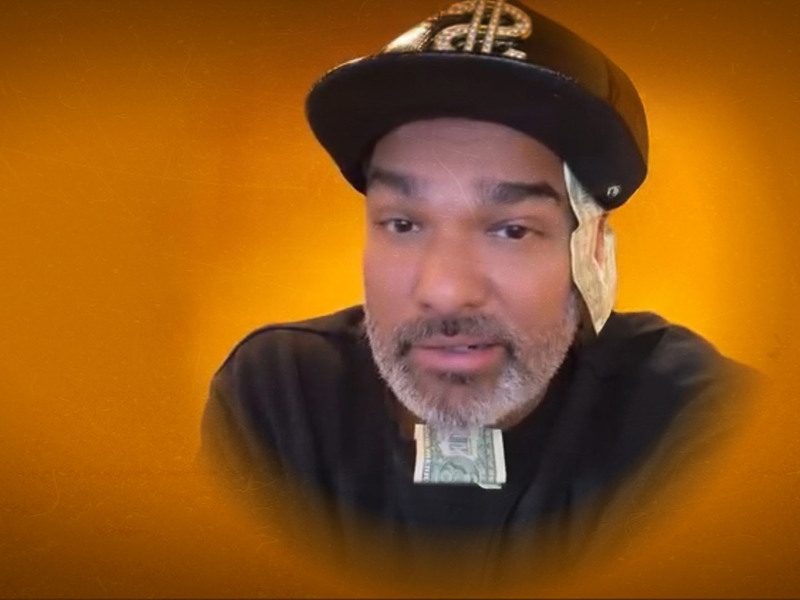


 PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM






























