
Die Organisatoren der liberal-konservativen Denkfabrik R21 verfügen über ein Händchen bei der Wahl ihrer Kongresstermine. Ihre Veranstaltung „Diagnosen für Deutschland“ fiel auf den 7. Mai, den Tag der Kanzlerwahl. Dass es mit der neuen Regierung keine „bürgerliche Reformagenda“ geben würde, für die R21 wirbt, wussten die beiden Gründer von R21 schon, der frühere Chef der CDU-Programmkommission Andreas Rödder und die ehemalige CDU-Familienministerin Kristina Schröder. Ihre Diagnosen zu Energie- und Wirtschaftspolitik, Sozialsystemen und Staatsüberdehnung wollten sie trotzdem stellen, verbunden mit Therapievorschlägen. Aber zum Start der Konferenz in der Berliner Friedrichstraße schauten fast alle Teilnehmer in kurzen Abständen auf die Displays ihrer Mobiltelefone. Dort hieß die Meldung des Tages: Friedrich Merz im ersten Wahlgang durchgefallen.
Plötzlich stellte sich die Frage, wann und ob es überhaupt eine neue Bundesregierung geben würde, von der Agenda einmal ganz abgesehen. Schon die vorhegenden R21 Veranstaltung Anfang Dezember 2024, in der es um einen Kurswechsel in der Migrationspolitik ging, fand an dem Tag statt, als Angela Merkel im „Deutschen Theater“ ihr Buch “Freiheit“ vorstellte und sich zufrieden bescheinigte, gerade bei der Einwanderung alles richtig gemacht zu haben. Ein paar Tage vorher endete Knall auf Fall die Ampel, also fielen die schon lange vorher geplanten Auftritte der CDU-Politiker Carsten Linnemann und Thorsten Frei plötzlich in den Wahlkampf.
Mittlerweile steht fest, dass es für den Vorschlag, den Frei damals auf dem Podium machte – nämlich, das individuelle Grundrecht auf Asyl in der Verfassung durch eine institutionelle Garantie zu ersetzen – zwar eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, aber nicht in dem Kabinett, dem Frei jetzt als Kanzleramtschef angehört. Auch die Idee Carsten Linnemanns, den Geldregen für das überwiegend linke NGO-Vorfeld durch das Programm „Demokratie leben“ ganz zu beenden, wanderte in die Ablage. Und Generalsekretär Linnemann blieb der wackligen Regierung des Friedrich Merz fern.
Der liberal-konservative Historiker Rödder, dessen Abgang als Vorsitzender der Programmkommission etliche einflussreiche CDU-Politiker der zweiten Reihe betrieben hatten, hielt sich am Dienstag nicht mit der Frage auf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit liegt, dass die Minister nebenan im Regierungsviertel die Vorschläge der CDU-nahen Denkfabrik begeistert aufgreifen. Er und die anderen auf dem Podium richten sich eher an die, wie er sagt, „bürgerliche Mitte“.
Nicht nur auf dieser Veranstaltung verkündet Rödder sein Credo: die Zeit der „grünen Hegemonie“ in Deutschland sei zwar vorbei, das bedeute aber noch lange keine bürgerliche Diskurshoheit. In seinem Vortrag umreißt er kurz die Lage, wie er sie zum Start der neuen Regierung sieht: Deutschland sei die „Aufstiegsdynamik verloren gegangen“, der „Irrweg der deutschen Energiewende“ gehe weiter, die konsequente Trennung von Asyl und Einwanderung stehe noch aus. Außerdem gebe es „schleichende staatliche Übergriffe auf die Meinungsfreiheit“ – er nennt als Beispiel die „Meldestellen“, die bekanntlich auch in CDU-regierten Bundesländern wie Berlin und NRW fortgeführt oder sogar neu eingerichtet werden. Das Wichtigste, meint der Historiker, sei der mentale Zustand des Landes: „Die Gesellschaft braucht ein positives Selbstbild.“ Wie kommt sie also aus wirtschaftlichem Abstieg, dem Energiesonderweg, der ungeordneter Migration und der Staatsüberdehnung wieder heraus?
Um es kurz zu machen: die Fachleute auf dem Podium machen wenig Hoffnung, dass es kurzfristig zu einer Wende kommt. Der Jurist Winfried Veil, in früheren Jahren im Innenministerium tätig, jetzt Mitarbeiter im neu geschaffenen Digitalministerium, zählt die Gründe auf, warum Künstliche Intelligenz zum neuen großen Geschäftsfeld in den USA und China werden dürfte, aber nicht in EU-Europa und besonders nicht in Deutschland: Dort gebe es zwar keine bedeutenden technischen Entwicklungen auf diesem Gebiet, aber schon das dichteste staatliche Regulierungsgestrüpp weltweit. Dass es sich schnell lichten lässt, glaubt er nicht, denn bei den meisten Vorschriften handle es sich um EU-Recht. Bekanntlich produzieren die Verantwortlichen in Brüssel ständig neue Regeln, schaffen aber so gut wie nie welche ab.
Russel A. Berman, Professor für German Studies am Hoover Institut in Stanford, wischte später in seinem Beitrag auf dem Podium die vor allem von deutschen Medien verbreitete Erwartung beiseite, demnächst würden viele US-Spitzenforscher nach Deutschland emigrieren. Die behauptete Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit an Universitäten, so Bermann, könne er nicht erkennen. Und IT-Spitzenkräfte würden wohl kaum nach Deutschland umziehen. „Vielleicht“, meint er, „kommen ein paar Genderwissenschaftler.“
Der Ökonom und Autor Daniel Stelter nahm sich die Energiewende vor: Es gebe weltweit kein einziges Land mit niedrigem Energieverbrauch und hohem Wohlstand. Ohne günstige und vor allem verlässliche Energie werde Deutschland kein Industrieland bleiben. Im Koalitionsvertrag, so Stelter, stehe allerdings zum Punkt Energie: weiter so. Friedrich Breyer, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Konstanz und Mitglied im Sachverständigenrat des Wirtschaftsministeriums, schilderte die Vorschläge des Rates zur Stabilisierung des Rentensystems und vor allem der schon jetzt extrem wackeligen Pflegeversicherung, die schon jetzt ein Milliardendefizit vor sich herschiebt. Ohne eine kapitalgedeckte Zusatzversicherung, so sein Fazit, werde es nicht annähernd genügend Mittel geben, wenn die Boomer-Generation ins pflegebedürftige Alter kommt. Aber auch hier wieder: nichts davon im Koalitionsvertrag.
So viel zu den Diagnosen; die Therapievorschläge lauten zusammengefasst: Die Republik müsste sich auf den meisten Politikgebieten in eine radikal andere Richtung bewegen.
Die Diskutanten widmen sich auch dem derzeit brisantesten politischen Thema: dem Umgang mit der AfD. Die Einstufung der Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ durch den Verfassungsschutz liegt frisch auf dem Tisch, auch wenn der Nachrichtendienst sie wenig später wegen eines Gerichtsbeschlusses nicht mehr öffentlich wiederholen darf.
Während die R21-Veranstaltung in der Friedrichstraße läuft, zwingt die SPD-Fraktion drüben im Reichstag die Union, zur Änderung der Geschäftsordnung die Linkspartei um Hilfe anzugehen. Denn ohne diese Änderung mit Zweidrittelmehrheit könnte es am gleichen Tag keinen zweiten Anlauf zur Kanzlerwahl geben, andererseits bestand die SPD strikt darauf, die Geschäftsordnungsänderung dürfte auf keinen Fall mit AfD-Stimmen zustande kommen. Mit beidem, Verfassungsschutzgutachten und erzwungener Öffnung von CDU und CSU nach links, bekam die Brandmauer gewissermaßen noch eine Stacheldrahtrolle obenauf.
Die Matadore auf dem Podium der Denkfabrik wissen allerdings, was eigentlich auch Friedrich Merz wissen müsste: ewig halten Sperranlagen dieser Sorte nicht. Der CDU-Mann Markus Kerber, ehemals Abteilungsleiter im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble und Staatssekretär im Innenministerium bei Horst Seehofer, rät seiner Partei, ihre unverhandelbaren Kernbestände zu definieren, und danach über die Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften zu entscheiden, aber keine Kooperation pauschal auszuschließen. Ex-Ministerin Schröder meint, es sein ein Fehler der CDU gewesen, dass sie sich schon in der Frühphase der AfD, als sie noch eine eurokritische Professorenpartei war, „in eine Brandmauerdebatte hat hineinquatschen lassen“. Ihr Resümee für die Gegenwart: „Im Moment schadet die Brandmauer nur der CDU und der FDP.“ Würde die Weidel-Partei anders behandelt, sagte sie, könnte sie sich vielleicht ähnlich wie Melonis Fratelli in Italien entwickeln: zur rechten, aber auch pragmatischen Kraft.
Dramaturg Bernd Stegemann, Autor mehrerer Bücher, die sich kritisch mit Identitätspolitik befassen, sekundiert: Es sei eine Illusion zu glauben, die AfD dauerhaft aussperren zu können. Die Isolation habe ihr Wachstum ganz offensichtlich nicht aufgehalten: „Hinter der Brandmauer wurde die AfD immer stärker und stärker.“ Rödder macht mit Blick auf die Verbotsdebatte einen originellen Vorschlag: Wenn eine Mehrheit im Bundestag die AfD für republikgefährend halte, dann sollten sie den Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht stellen, um die Frage klären zu lassen. Allerdings: falls sie mit ihrem Antrag scheitern, „dann muss es für die Verantwortlichen Konsequenzen geben – vor allem für den Verfassungsschutz.
Zum Schluss nimmt Welt- und Politico-Herausgeber Ulf Poschardt auf der Bühne Platz, wo er eine Kurzfassung seines Buchs „Shitbürgertum“ präsentiert, auf dessen Rückseite der 68er-Spruch steht: „Macht kaputt, was euch kaputt macht“. Diese Aufforderung bezieht er auf die Linke, die sich mit einem absoluten Moralanspruch gegen jede Kritik immunisiere. Der Journalist versichert, er wolle ja keine Menschen kaputtmachen, sondern nur das moralische Podest, mit dem sich diejenigen erhöhen, auf die er mit seiner Polemik zielt. Dann kommt er allerdings unvermittelt auf ein völlig anderes Thema: Tichys Einblick. „Wenn manche Tichys Einblick für die Zukunft der Medien halten – na dann gute Nacht“, ruft er ins Auditorium. Dabei ist TE ja Gegenwart – und auch dort erwartet keiner, dass demnächst alle Medien genauso schreiben.
Nebenbei: das wäre auch schlecht für die Medienvielfalt und die Konkurrenz um die Leser. Eine richtige Begründung für seine Attacke auf den Mitbewerber gibt es nicht. Das heißt, doch: TE habe sein Buch verrissen. Das tat die Autorin Cora Stephan zwar nicht, sie fand es sin ihrer Besprechung sogar unterhaltsam und über längere Strecken lesenswert. Die Autorin kritisierte nur, dass Poschardt noch vor nicht allzu langer Zeit zu genau dem Milieu gehörte – für Merkels Grenzöffnung, gegen Trump – das er heute frontal angreift. Die Reflektion über seine Wandlung, merkte sie an, komme in seinem „Shitbürger“-Buch etwas kurz. Aber gut: Dünnhäutigkeit gibt es in der Branche zwar nicht überall, aber auch nicht ganz selten. Bei „Tichys Einblick“ freut man sich immer, wenn das Medium andere aufregt, auf welche Weise auch immer.
Die Zukunft Deutschlands jedenfalls, lautet die Botschaft der Denkfabrik zum Regierungsstart in Berlin, sieht auf jedem Fall ganz anders aus als die Gegenwart: entweder durch einen Modernisierungsruck, der noch kommen muss – oder durch einen Abstieg, den das Land sonst auf jeden Fall erlebt.

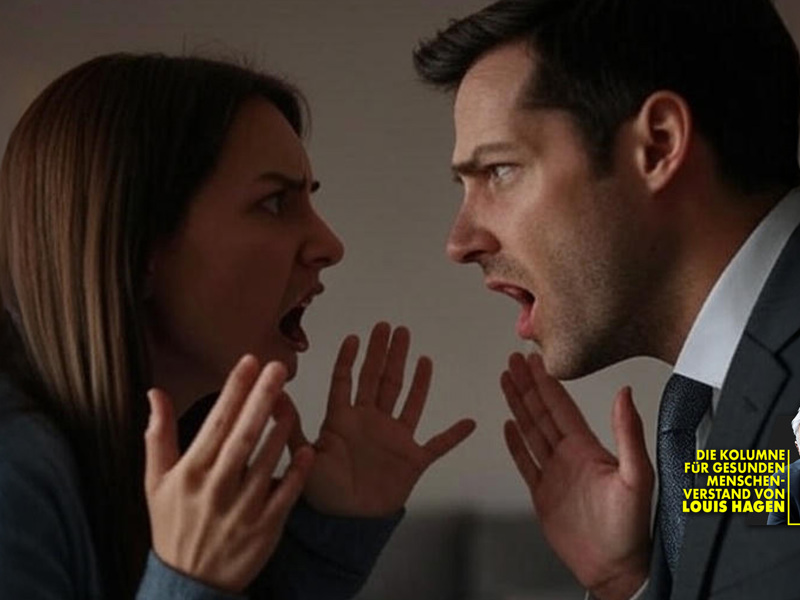







 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























