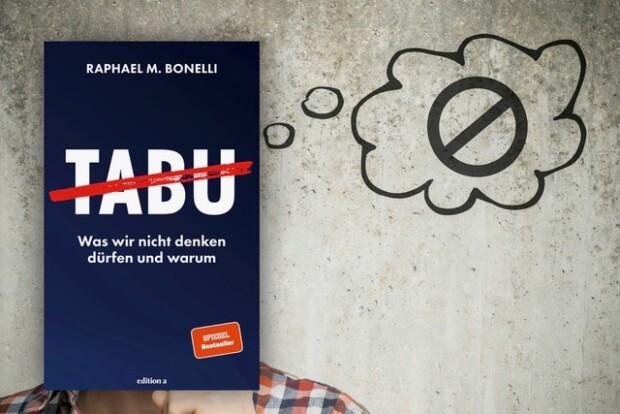
Herr Bonelli, das Wort „Tabu“ kam erst Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa, und zwar vom anderen Ende der Welt. Bedeutet das, dass es bis dahin keine Tabus in den europäischen Gesellschaften gegeben hat?
Mit Sicherheit gab es sie, es fehlte nur der geeignete Begriff dafür. Tabus haben in allen Kulturen schon lange vorher existiert, sind etwas zutiefst Menschliches und auch etwas ganz Normales. Das Wesen eines Tabus ist es, eine starke Abwehrreaktion auszulösen, über die dann auch gar nicht mehr nachgedacht werden muss. Gerade diese Unmittelbarkeit macht seine Wirkung aus.
Wenn alle Kulturen dieses Phänomen kennen, legt das den Schluss nahe, dass Tabus durchaus eine sinnvolle Funktion haben.
In der Tat. Eines der Hauptanliegen in meinem Buch ist es, den Unterschied zu verdeutlichen zwischen sinnvollen und sinnlosen Tabus, oder, wie wir in der Psychologie sagen, zwischen funktionalen und dysfunktionalen. Funktionale Tabus sind jene, die dem Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen und moralische Klarheit zu finden. Ein Beispiel ist etwa das Tötungstabu, das nicht nur Gesellschaften schützt, sondern auch die individuelle Freiheit des Menschen wahrt. Im Gegensatz dazu stehen dysfunktionale Tabus, die oft willkürliche und sinnlose Beschränkungen darstellen.
Das Tötungstabu ist ein klassisches Handlungstabu. Man hat aber den Eindruck, dass es bei vielen modernen Tabus eher um Denk- und Sprechverbote geht.
Wenn diese Tabus dysfunktional, also mehr oder weniger sinnlos sind, wer fordert sie dann ein und warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsache ist, dass kaum jemand davon profitiert, außer ein paar Moralaposteln, die gerne eine neue Moral konstruieren wollen. Es gibt das Phänomen eines moralischen Narzissmus, also das Gefühl: Wenn ich das Wort „Eskimo“ nicht mehr sage, dann bin ich besser als die anderen.
Wenn es wirklich nur darum geht, dann ist es aber doch erstaunlich, wie erfolgreich diese Tabuisierung ist, oder?
Sie ist erfolgreich, weil es viele gutmütige Menschen gibt, die sich sagen: Dann sag’ ich das Wort eben nicht mehr, ist ja nicht so schlimm. Aber dabei bleibt es ja meist nicht. Und wenn dann meine Kinder nicht mehr Winnetou lesen dürfen, muss ich mich wehren. Ich habe jedenfalls sicherheitshalber die Gesamtausgabe von Karl May jetzt dreimal gekauft, für den Fall, dass sie irgendwann verboten wird.
Sie sprechen auch davon, dass unterschiedliche Tabus in einen regelrechten Wettstreit geraten können.
Genau, das ist ein faszinierendes Dilemma. Ich habe dieses Phänomen zum ersten Mal während meiner Ausbildung erlebt, als eine Ärztin in der Gruppe darüber berichtete, dass ein Patient nach einem männlichen Arzt verlangt habe. Als sich die Gruppe daraufhin über diesen Macho empören wollte, fügte die Ärztin hinzu, es handele sich um einen Mann aus Syrien oder der Türkei. Plötzlich war die Runde wie gelähmt, denn sie wusste nicht mehr, welchem Tabu sie jetzt Folge leisten sollte. Eine ähnliche Sprachlosigkeit tritt beispielsweise ein, wenn Migranten durch Antisemitismus auffallen.
In Ihrem Buch sprechen Sie auch von einem „Gottestabu“. Was meinen Sie damit?
Spiritualität im Allgemeinen wird schon noch akzeptiert, insbesondere, wenn sie fernöstlich angehaucht ist. Wenn aber jemand als bibeltreuer Protestant oder als lehramtstreuer Katholik auftritt, ist das den Leuten extrem suspekt. Allein schon die Lehre über die Homosexualität, die fast alle Religionen teilen, ist ein gewaltiges Tabu. Ein katholischer Pfarrer in der Steiermark ging erst kürzlich mit einem Video viral, obwohl er in seiner Predigt im Grunde nur Allgemeinplätze des katholischen Lehramts vorgetragen hat. Viele waren begeistert, nur nicht seine Vorgesetzten.
Einige Beobachter sind der Auffassung, der Höhepunkt der Wokeness sei überschritten, die Rückkehr zur Normalität stehe bevor: Wunschdenken oder berechtigte Hoffnung?
Für mich steht jedenfalls fest: Wir Normalen sind in der Mehrheit und wir lassen uns diesen Unsinn nicht länger gefallen. Ich hätte mein aktuelles Buch vor einem Jahr nicht so leicht publizieren können wie heute.
Steht zu befürchten, dass das Pendel nun in die andere Richtung ausschlägt, dass wir also eine Gängelung von rechts erleben werden?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Schaut man sich allerdings die Liste von Worten an, die Trump nun nicht mehr in seinen Ministerien hören beziehungsweise lesen will, so sind das fast ausnahmslos woke Begriffe, die ohnehin erst kürzlich eingeführt wurden. Wenn er diese nun wieder abschafft, dann kehrt er im Grunde nur zu dem zurück, was wenige Jahre zuvor völlig normal war. Psychologisch ist Trump jedenfalls ein faszinierender Fall, weil er sich nicht im Geringsten um Tabus schert und genau damit Erfolg hat. Im Moment tut uns das, glaube ich, erst mal ganz gut.
Dieses Interview wurde von Sebastian Moll geführt und erschien zuerst in Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zur Übernahme. Jetzt drei Ausgaben kostenlos testen: Die Tagespost-Probeabo.
Raphael M. Bonelli, Tabu. Was wir nicht denken dürfen und warum. edition a. Hardcover mit Schutzumschlag, 160 Seiten, 20,00 €.



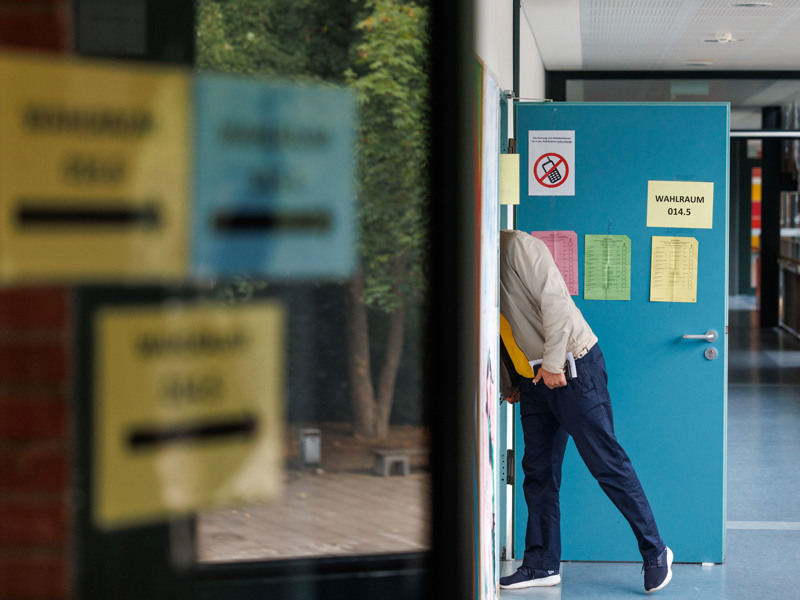




 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























