
„Wenn die Polizei vor der Tür steht, wird jedem Täter klar, dass Hasskriminalität Konsequenzen hat“, twitterte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 12. November anlässlich des „Aktionstags gegen Hasspostings“. Zahlreiche Bürger mussten an jenem Tag frühmorgens Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen. Doch sind öffentlichkeitswirksame Ermittlungsaktionen zur Abschreckung der Bevölkerung überhaupt rechtens? Und: Ist das Verhalten der Behörden bei derartigen Vergehen wirklich verhältnismäßig?
Bereits Faesers Wortwahl lässt anklingen, dass es der Innenministerin nicht um eine gerechte Behandlung der betroffenen Bürger geht – sondern vor allem um die einschüchternde Wirkung ihrer Aktionstage. Tatverdächtige werden zu Tätern, mutmaßliche Vergehen werden zu Hasskriminalität. Politische Härte, die viele Menschen an anderer Stelle von Nancy Faeser vermissen.
Eine NIUS-Anfrage dazu, ob die Zweckentfremdung von Ermittlungsarbeit zur Abschreckung der Bevölkerung nicht rechtswidrig sei, kommentierte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums (BMI) mit einer Floskel, die man in Faesers Haus inzwischen reflexhaft auf unsere Presseanfragen ausgibt: „Die Worte der Ministerin stehen für sich.“
Bundesinnenministerin Nancy Faeser
Da uns Leser aus Bayern besonders viele Hausdurchsuchungen mitteilten, fragten wir auch beim Bayerischen Justizministerium an: „Hält der Minister die Zweckentfremdung von Ermittlungsarbeit zur Abschreckung der Bevölkerung nicht für rechtswidrig?“
Ein Sprecher von Minister Georg Eisenreich (CSU) hatte zuvor gegenüber der Welt erklärt, hinter dem Aktionstag stecke die Idee einer „Generalprävention“. Übersetzt heißt das: die Abschreckung der Bevölkerung, um diese zu erziehen und Exempel zu statuieren. Dabei darf allenfalls die Strafe, die nach Abschluss eines Ermittlungsverfahrens verhängt wird, diesem Zweck dienen.
Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich.
In seiner Antwort hebt das Ministerium den Themenschwerpunkt „Antisemitismus“ hervor: „Durch einen solchen Aktionstag wird das Vertrauen von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in den Rechtsstaat gestärkt und möglichen Tätern signalisiert, dass antisemitische Straftaten konsequent verfolgt werden.“
Das Ministerium bestätigt damit, dass die gebündelten Ermittlungsaktionen vor allem der Außenwirkung dienen.
Bernd Schünemann, der als Koryphäe im Strafverfahrensrecht gilt, erklärt gegenüber NIUS: „Ein Aktionstag ist eine politische Veranstaltung, deren Zwecke in der Antwort des Justizministeriums zutreffend angegeben werden. Hausdurchsuchungen sind laut Bundesverfassungsgericht schwerwiegende Grundrechtseingriffe, die den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit genügen müssen. Ein für ihre Anordnung kausales Motiv, die quantitative Dimension eines ‚Aktionstages‘ zu verstärken, würde sie deshalb rechtswidrig machen.“
Heißt übersetzt: Da die zeitliche Bündelung von Ermittlungsmaßnahmen aus verschiedenen Verfahren keinen Gewinn im Hinblick auf die Aufklärung einzelner Straftaten bringt, sondern lediglich dem Zweck dient, die Außenwirkung zu verstärken, sind diese rechtswidrig. Dass der abschreckende Effekt das Ziel und kein bloßer Nebeneffekt war, ergibt sich aus dem konzertierten Vorgehen.
Auch dem Strafrechtsprofessor Holm Putzke haben wir die Antwort des Ministeriums vorgelegt. Er sagt: „Das Vertrauen wird durch eine ganzjährige konsequente Verfolgung von antisemitisch motivierten Straftaten gestärkt, nicht durch Aktionstage, bei denen aktionistisch Durchsuchungen stattfinden.“
Der Rechtswissenschaftler Holm Putzke, hier 2012 im Talk bei Anne Will.
NIUS fragte außerdem, ob Justizminister Eisenreich im Fall der Durchsuchung wegen des „Schwachkopf“-Memes die Verhältnismäßigkeit gewahrt sieht, und ob er Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen generell für verhältnismäßig hält. Die Antwort des Ministeriums: „Wir bitten um Verständnis, dass sich der Bayerische Staatsminister der Justiz und das Bayerische Staatsministerium der Justiz grundsätzlich nicht zu Einzelfällen äußern. Dies ist Aufgabe der zuständigen Staatsanwaltschaft bzw. des zuständigen Gerichts.“
Lesen Sie auch: Wie die Mächtigen Corona missbrauchten, um die Majestätsbeleidigung zurückzubringen
Rechtswissenschaftler Schünemann sagt: „Das trifft im Prinzip zu. Allerdings entscheidet der Ermittlungsrichter in so gut wie allen Fällen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wobei die ihm obliegende rechtliche Kontrolle nach Erkenntnissen der Praxis nur äußerst selten zur Ablehnung des Antrages der Staatsanwaltschaft führt. Als an das Recht gebundenes Justizorgan trägt diese deshalb ebenfalls Verantwortung für die von ihr beantragten Grundrechtseingriffe.“
Heißt: Auch, wenn die Gerichte unabhängig sind, winken sie für gewöhnlich die Anträge der Staatsanwaltschaften durch. Diese wiederum sind weisungsgebunden – und unterliegen damit sehr wohl dem Einfluss des Justizministeriums.
Professor Josef Franz Lindner ist in Augsburg Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie (Foto: Universität Augsburg).
Ähnlich sieht es der Augsburger Professor für Öffentliches Recht, Josef Franz Lindner: „Die Staatsanwaltschaft ist nach deutschem Recht weisungsgebunden. Das Justizministerium hat also durchaus Einfluss darauf, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen gewahrt wird und dass die Staatsanwaltschaft bei Peanuts wie dem Retweet des Schwachkopf-Memes von Strafverfolgung absieht. Die Politik könnte darauf einwirken, dass man hier nicht unbedingt mit der vollen Härte des strafprozessualen Besteckkastens vorgeht.“
Mehr NIUS: Gericht wollte verhindern, dass Pflegerin sich gegen Baerbock wehrt









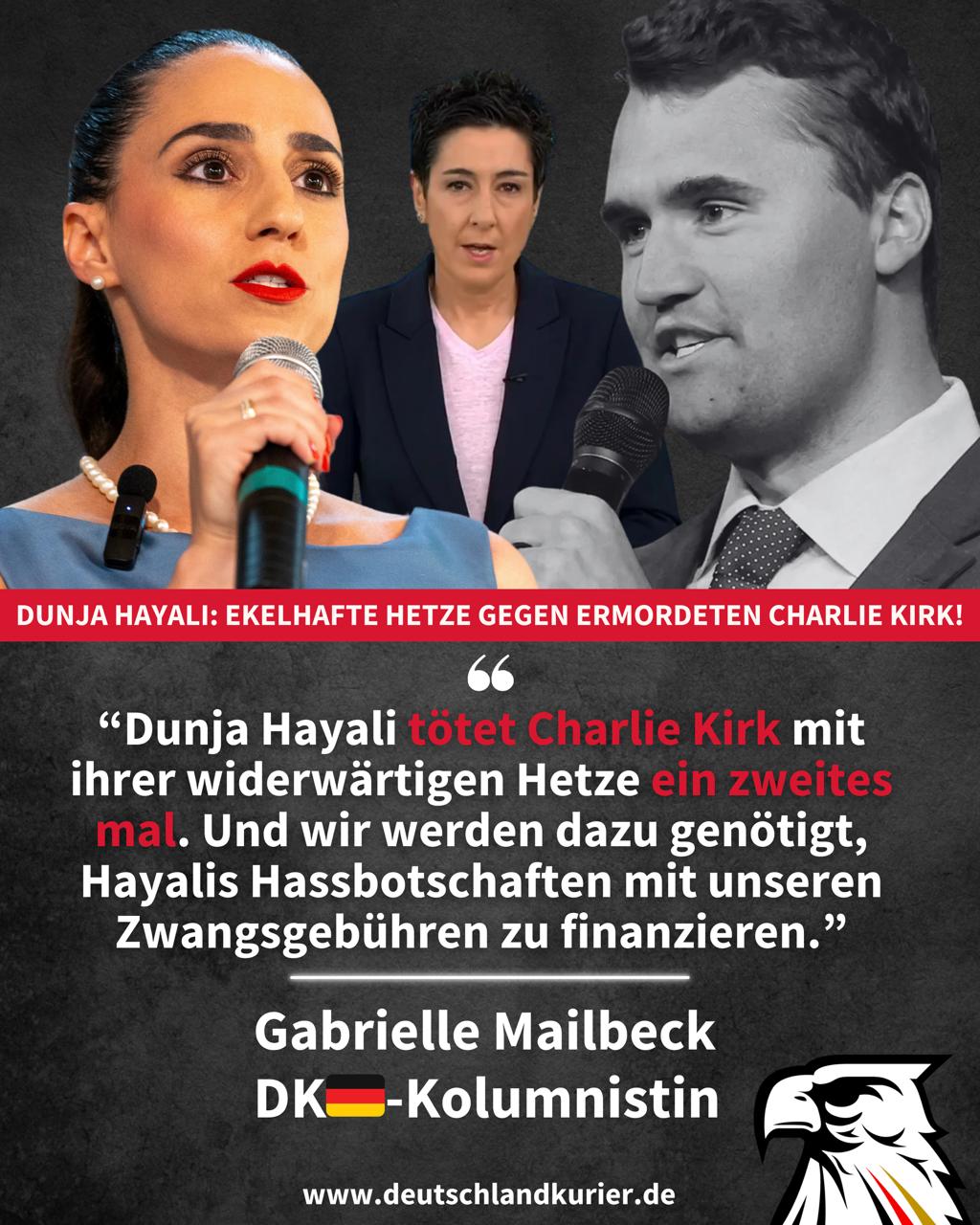
 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























