
Die wirtschaftliche Talfahrt bei der VW-Tochter Audi setzt sich fort. Wie der Konzern am Montag bekanntgab, sank die operative Umsatzrendite im ersten Quartal 2025 auf magere 1,5 Prozent – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 3,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Von den ambitionierten Zielvorgaben für dieses Jahr, die eine Marge zwischen sieben und neun Prozent vorsehen, dürfte man sich in Ingolstadt wohl nun endgültig verabschieden müssen.
Auch der Gewinn selbst schrumpfte weiter: Im Zeitraum Januar bis März verbuchte Audi auf Konzernebene – inklusive Bentley, Lamborghini und Ducati – lediglich 630 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konzern führt den Einbruch auf eine zunehmend aggressive Wettbewerbssituation und weltweite politische Verwerfungen zurück.
Zwar stieg der Umsatz leicht von 13,7 auf 15,4 Milliarden Euro, doch dieser Zuwachs ist wenig wert, wenn externe Faktoren die Gewinnmarge zunehmend unter Druck setzen. Ein zentraler Faktor, der Audi derzeit das Geschäft ruiniert, ist der sture Kurs in Richtung Elektromobilität. Der Autobauer weigert sich, auf technologische Offenheit zu setzen – und genau das droht ihm nun zum Verhängnis zu werden.
Ab 2035 greift das EU-weite Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor. Audi hatte sich früh als Vorreiter inszeniert und plante ursprünglich sogar, den Umstieg auf E-Mobilität vorzeitig zu vollziehen. Ab 2026 sollten keine neuen Verbrennermodelle mehr entwickelt, spätestens 2033 die Produktion herkömmlicher Antriebe vollständig eingestellt werden.
2025 sollte das Jahr des Durchbruchs werden: Audi wollte mit einem umfassenden Konzernumbau den Weg in die elektrische Zukunft ebnen. Doch der überhastete Kurs erweist sich zunehmend als strategischer Fehler. Die Konkurrenz aus China ist schlicht übermächtig: Hersteller wie BYD, Nio, Chery oder MG bieten vergleichbare Modelle zu einem Bruchteil des Preises. Teilweise sind diese Fahrzeuge bis zu dreimal günstiger.
Der Grund: massive staatliche Subventionen, extrem niedrige Lohnkosten, billiger Strom und nahezu uneingeschränkter Zugriff auf Seltene Erden. China kontrolliert über 90 Prozent der weltweiten Wertschöpfungskette und des Exports dieser Rohstoffe – und damit das Herzstück der E-Mobilität.
Angesichts dieser Standortvorteile sind deutsche Elektroautos auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. Die Verkaufszahlen deutscher E-Modelle brechen in der Volksrepublik regelrecht ein. Doch auch weltweit zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Folge des Absatzrückgangs: Hersteller wie Audi sehen sich mit massiven Gewinneinbußen und schrumpfenden Margen konfrontiert.
Allerdings sind den deutschen Autobauern die Hände gebunden: Das Klimadiktat der Europäischen Union – verkörpert durch das Verbrennerverbot und immer schärfere Flottengrenzwerte – zwingt Audi, VW & Co. zur Umstellung auf die E-Mobilität.
Mit dem Verbrenner hatten die deutschen Autobauer eine Vormachtstellung auf dem Markt, die über Dekaden unantastbar war. Die Automobilindustrie war das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mit der Klimapolitik auf EU-Ebene hat man sie zu Willen eines Klimaschutzes geopfert, der von Doppelmoral nur so strotzt: E-Autos sind nämlich nicht unbedingt klimafreundlicher. Häufig erhalten E-Autos erst nach knapp 100.000 Kilometern einen Umweltvorteil gegenüber Verbrennern. Das liegt besonders an der Batterieherstellung, die enorm emissionsintensiv ist.
Ein weiterer Belastungsfaktor, der die Gewinnmargen der VW-Tochter zunehmend unter Druck setzt, sind zweifellos die gestiegenen Betriebskosten. Verantwortlich dafür sind die ungünstigen Rahmenbedingungen am deutschen Industriestandort.
Insbesondere die hohen Energiekosten stellen ein ernstzunehmendes Problem dar. Deutschland weist mit die höchsten Industriestrompreise in der gesamten EU auf. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Strompreis für Industrieunternehmen hierzulande bei rund 23,3 Cent pro Kilowattstunde – deutlich über dem EU-Durchschnitt von etwa 18,7 Cent/kWh. Hauptursache dafür sind die massiven Steuern und Abgaben, die auf den Strompreis aufgeschlagen werden.
Dazu zählen vor allem die Netzentgelte, die inzwischen bis zu 28 Prozent des Strompreises ausmachen. Diese Gebühren werden von den Netzbetreibern erhoben, um Wartung und Ausbau der Stromnetze zu finanzieren. Besonders der Ausbau ist ein Kostenfaktor, der durch die Energiewende erheblich an Gewicht gewonnen hat. Denn um das Stromnetz für die stark schwankende Einspeisung durch Wind- und Solarkraft zu ertüchtigen, sind Milliardeninvestitionen erforderlich. Kurz gesagt: Den Ausbau der Stromnetze wälzt der Staat auf die Verbraucher ab.
Auch die erneuerbaren Energiequellen selbst stellen ein gewaltiges Problem dar und tragen maßgeblich zum Anstieg der industriellen Strompreise bei. Inzwischen machen diese Energieträger rund 60 Prozent des Strommixes aus. Besonders in wetterbedingten Phasen, in denen weder Sonne scheint noch Wind weht, wirkt sich das aber negativ aus.
Der Anteil von Solar- und Windkraft fällt in solchen Momenten nahezu auf null, was zu einem Nachfrageüberhang an den Strombörsen führt. Zu allem Übel müssen dann noch kostenintensive Gas-, beziehungsweise Kohlekraftwerke ans Netz genommen werden, die die Strompreise noch weiter in die Höhe treiben. Eine massive Belastung für Unternehmen wie Audi; aber auch private Verbraucher.
Erschwerend kommt die überbordende Bürokratie hinzu, welche die Marge von Audi weiter belastet. Die Automobilindustrie sieht sich mit einem wachsenden Dickicht aus Verordnungen und Auflagen konfrontiert. Melde- und Nachweispflichten in Bereichen wie Umweltvorschriften, Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Steuerwesen führen zu enormem administrativen, aber auch finanziellen Mehraufwand.
Gerade unter der Ampelregierung hat die Regulierungsdichte noch einmal spürbar zugenommen – und das, obwohl der Bürokratieabbau eigentlich als ein erklärtes Ziel der Koalition galt.
Um aus der Krise zu kommen, muss Audi das Unternehmen umstrukturieren. Das zieht auch einen erheblichen Stellenabbau in Deutschland mit sich. Bis 2029 sollen hierzulande bis zu 7.500 Jobs wegfallen. Außerdem soll die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter gekürzt werden.
Auch in der Fertigung will Audi konkret Kürzungen vornehmen. Bereits im Februar dieses Jahres wurde das Werk in Brüssel – ein bedeutender Standort für die Fertigung von E-Autos – vollständig geschlossen. Rund 3.000 Mitarbeiter verloren dadurch ihre Anstellung: Ebenso betroffen waren zahlreiche Arbeitsplätze bei den Zulieferbetrieben.
Audi steht mit seinen Problemen nicht allein. Die strukturellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der E-Mobilität und die ungünstigen Standortbedingungen in Deutschland betreffen die gesamte Branche. Erst vergangene Woche meldete der Mutterkonzern Volkswagen ebenfalls einen massiven Gewinneinbruch: Der Konzerngewinn brach im ersten Quartal um knapp 41 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro ein. Auch die Mitbewerber Mercedes-Benz und BMW sind schwach ins Jahr gestartet.
Wenn keine Kehrtwende erfolgt, droht der deutsche Automobilstandort in tausend Scherben zu zerbrechen. Nun liegt es an der sich neu formierenden Bundesregierung und der EU-Kommission, einerseits Deutschland wieder zu einem wirtschaftlich attraktiven Standort für die Autoindustrie zu machen – und andererseits Regulierungen wie das Verbrennerverbot aufzuheben oder zumindest deutlich zu entschärfen. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wie Audi wieder hergestellt werden.


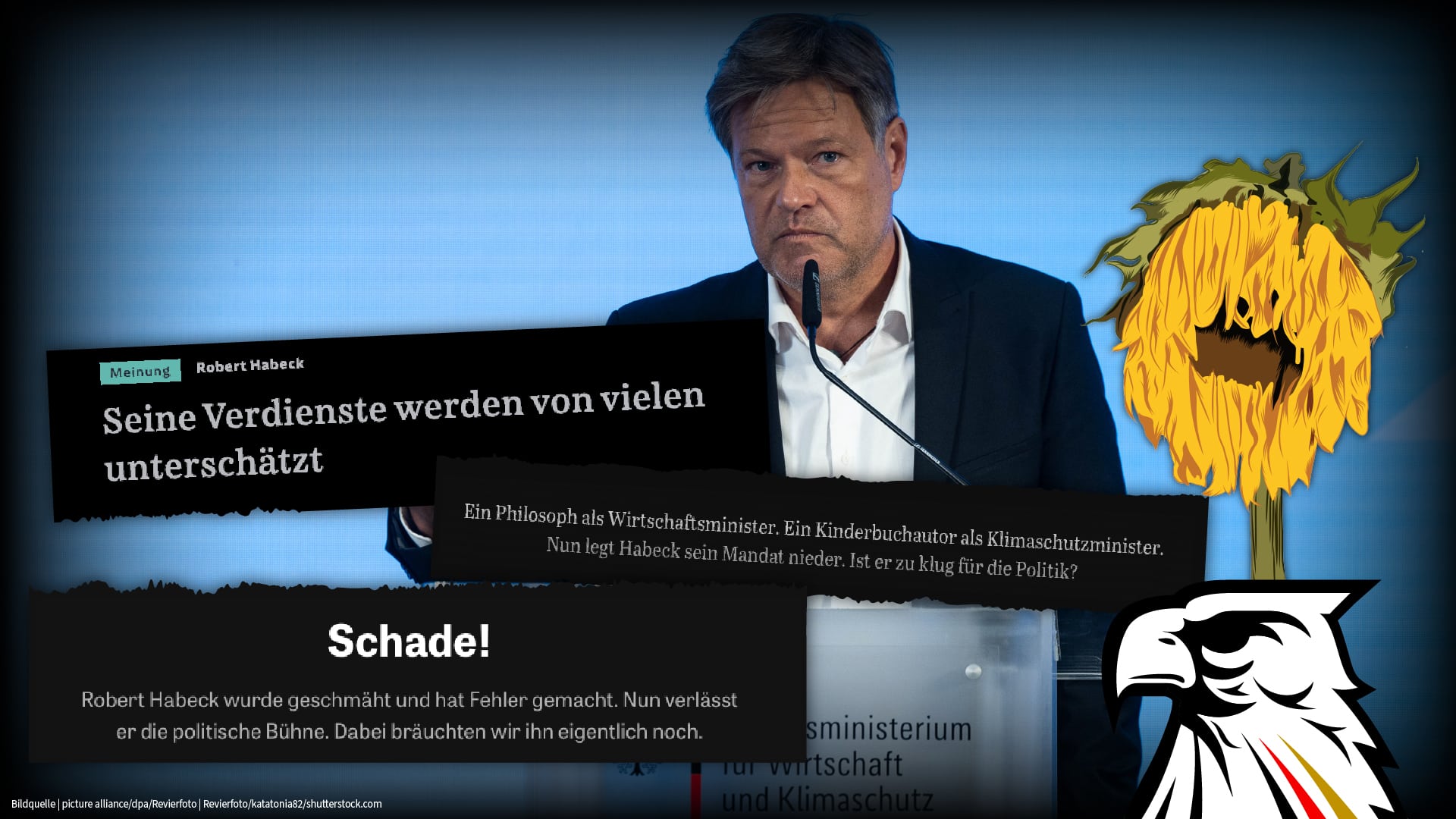







 DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM
DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM






























