
Eine aktuelle Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kommt zu dem Ergebnis, dass die Reparatur eines Elektrofahrzeugs nach einem Unfall im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent teurer ist als bei einem vergleichbaren Wagen mit Verbrennungsmotor. Für die Untersuchung hat der GDV insgesamt 53 ähnliche Modellreihen von E-Autos und konventionellen Fahrzeugen gegenübergestellt.
Der weiterhin bestehende Kostenunterschied lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass in Elektrofahrzeugen deutlich mehr komplexe Technik verbaut ist, wodurch die Reparatur aufwendiger wird und Ersatzteile oft teurer sind. Besonders ins Gewicht fällt dies, wenn der Akku ausgetauscht werden muss – in der Regel das teuerste Bauteil eines E-Autos, das bis zu ein Drittel des gesamten Fahrzeugwerts ausmachen kann.
Hinzu kommen weitere Faktoren: Spezialisierte Werkzeuge und geschultes Personal sind für die Instandsetzung erforderlich. Da viele Werkstätten erst in den Aufbau entsprechender Ausrüstung und Fachkenntnisse investieren müssen, entstehen zusätzliche Kosten, die am Ende an den Kunden weitergegeben werden.
Die hohen Reparaturkosten schrecken Verbraucher ab. Laut einer Dekra-Studie aus dem Jahr 2024 befürchten rund 56 Prozent der Autofahrer hohe Werkstattrechnungen bei Elektroautos. Das schlechte Image von E-Autos als kostenintensiv in der Reparatur hält sich hartnäckig in der Gesellschaft.
Für viele Fahrer sind diese hohen Reparaturkosten Grund genug, auf den Kauf eines Elektroautos zu verzichten. Weitere Argumente, die deutsche Verbraucher dazu bewegen, sich gegen die Anschaffung eines Stromers zu entscheiden, sind unter anderem die geringe Reichweite vieler Modelle, die unzureichend ausgebaute Ladeinfrastruktur in der Bundesrepublik sowie die insgesamt hohen Anschaffungskosten.
Auch Umweltbedenken spielen für viele Bürger, die den Kauf eines E-Autos erwägen, zunehmend eine Rolle. Während das Elektroauto gerne als umweltfreundliche Alternative zum Verbrenner dargestellt wird, ist es in Wirklichkeit keineswegs emissionsfrei – und in einem großen Teil seiner Lebensdauer sogar klimaschädlicher als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
Im Betrieb selbst stoßen E-Autos zwar – im Gegensatz zu Verbrennern – keine direkten Emissionen aus, dafür entstehen jedoch bei der Produktion erhebliche Treibhausgasemissionen. Ein Großteil der CO2-Emissionen in der Herstellung (über 50 Prozent) entfällt auf den Antriebsstrang, insbesondere auf die Batterieproduktion.
Nach einer Erhebung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) benötigen E-Autos eine Laufleistung von rund 90.000 Kilometern, um klimafreundlicher zu werden als herkömmliche Verbrenner. Zuvor sind sie klimaschädlicher.
Da E-Autos in Deutschland häufig geleast werden und nicht selten noch vor Erreichen der 90.000 Kilometer-Marke auf den Gebrauchtwagenmarkt gelangen – wo sie oft nur schwer verkauft werden können und zum Ladenhüter werden – wird der potenzielle Klimavorteil in vielen Fällen gar nicht realisiert.
Für zahlreiche deutsche Autofahrer überwiegen letztlich die Nachteile von E-Autos – von hohen Reparaturkosten bis hin zu einem vermeintlichen Klimavorteil, der sich in der Praxis oft nicht bestätigt.
Einer aktuellen McKinsey-Umfrage zufolge gaben im Mai dieses Jahres rund 52 Prozent der Befragten in Deutschland an, sich derzeit kein batterieelektrisches Fahrzeug anschaffen zu wollen und stattdessen den Verbrenner zu bevorzugen.




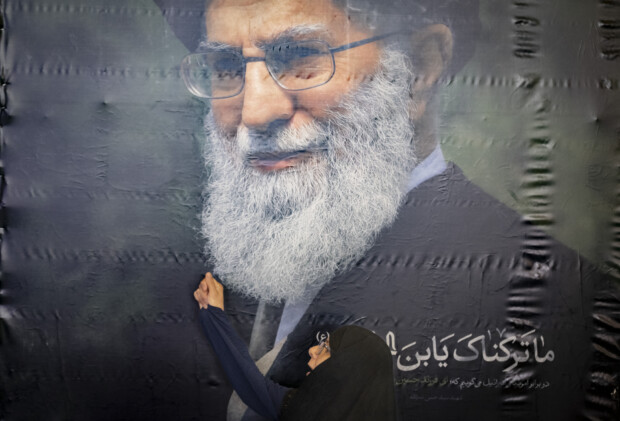




 Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?
Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?






























