
Rheinland-Pfalz rudert zurück. Nachdem das Innenministerium zunächst medienwirksam angekündigt hatte, AfD-Mitglieder grundsätzlich vom Staatsdienst auszuschließen, folgt nun die ernüchternde Klarstellung: Jeder Fall wird doch einzeln geprüft. Das Innenministerium bestätigte auf Anfrage des SWR, dass ein genereller Ausschluss nicht haltbar ist.
Noch am vergangenen Freitag hatte die Landesregierung anders getönt. Bewerberinnen und Bewerber mit AfD-Parteibuch seien „künftig ausgeschlossen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die politische Botschaft war klar: Demonstrative Härte gegen eine ungeliebte Partei.
Doch diese Strategie ist die Verfassung im Weg. Mehrere Staatsrechtler äußerten deutliche Kritik. Joachim Wieland, Professor an der Universität Speyer, stellte unmissverständlich klar: Eine pauschale Ablehnung aufgrund der Parteimitgliedschaft verstößt gegen das Grundgesetz. Das Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst hängt ausschließlich von Eignung, Befähigung und Leistung ab.
Josef-Franz Lindner, Staatsrechtler an der Universität Augsburg, ging noch einen Schritt weiter: Der Staat müsse mit jedem Bewerber sprechen, der AfD-Mitglied ist. Dabei müsse er klären, wie der Betroffene zu verfassungsrechtlich problematischen Äußerungen seiner Partei steht. Entscheidend sei, ob sich der Bewerber mit diesen Positionen identifiziere oder nicht.
Lindner betonte, dass ein pauschaler Ausschluss die notwendige Einzelfallprüfung unterlaufe. Diese Prüfung soll sicherstellen, dass Bewerber tatsächlich mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Alles andere sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Beamtenrecht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Auch Christoph Gröpl, Staatsrechtler von der Universität des Saarlandes, widersprach deutlich. Gröpl erinnerte daran, dass jeder Bürger einer nicht verbotenen Partei beitreten darf. Eine Mitgliedschaft allein dürfe kein K.O.-Kriterium sein. Ansonsten drohe eine gefährliche Aushöhlung demokratischer Grundrechte. Gröpl warnte zudem vor einem tiefgreifenden Missverständnis über die Pflicht zur Verfassungstreue. Ein Beamter müsse sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, ja – doch dies müsse individuell festgestellt werden. Es reiche nicht, eine Parteizugehörigkeit als Automatismus zu deuten.
Bemerkenswert ist: Selbst das Bundesinnenministerium sowie das Land Bayern schlossen sich dieser Linie an. Bayern, wo die AfD inzwischen auf einer Extremismus-Liste geführt wird, prüft trotzdem weiterhin jeden Fall einzeln. Eine reine Mitgliedschaft begründe noch keinen Zweifel an der Verfassungstreue.
Pikant: Die Verwaltungsvorschrift in Rheinland-Pfalz sah ursprünglich genau diese Einzelfallprüfung vor. Dennoch hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) öffentlich einen härteren Kurs verkündet. Offenbar wollte er ein besonders scharfes Zeichen gegen die AfD setzen – juristische Feinheiten störten da nur.
Die Staatsrechtler vermuten politische Motive hinter der Kommunikation. Lindner spricht von einem „Überschießen des Ziels“, Wieland warnt vor einer gefährlichen Symbolpolitik, die verfassungsrechtliche Grenzen überschreitet. Es gehe nicht um Recht, sondern um öffentlichkeitswirksame Signale. Damit bewegt sich Rheinland-Pfalz auf dünnem Eis. Ebling wollte entschlossen wirken, als Verteidiger der Demokratie auftreten – heraus kam ein Musterbeispiel für rechtlich fragwürdigen Aktionismus. Ein misslungener Spagat zwischen politischem Aktivismus und rechtsstaatlicher Verpflichtung.
Und genau hier beginnt der gefährliche Teil: Ausgerechnet jene, die vermeintlich Demokratie und Verfassung schützen wollen, treten diese mit Füßen, wenn es gegen einen politischen Gegner geht. Das Innenministerium nutzte seine Verwaltungsinstrumente als Waffe im Meinungskampf. Der Fall zeigt, wie sich Verwaltung, Legislative und politische Parteien immer stärker zu einem Machtblock verweben. Gesinnungsprüfungen, ursprünglich das Markenzeichen autoritärer Regime, feiern ihr Comeback unter dem Deckmantel demokratischer Hygiene.
Am Ende bleibt ein zerrüttetes Vertrauen. Bürger erkennen, wie leicht rechtliche Grundpfeiler zur Disposition stehen, wenn politischer Opportunismus regiert. Rheinland-Pfalz liefert damit einen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn Parteiraison über Recht und Verfassung gestellt wird.








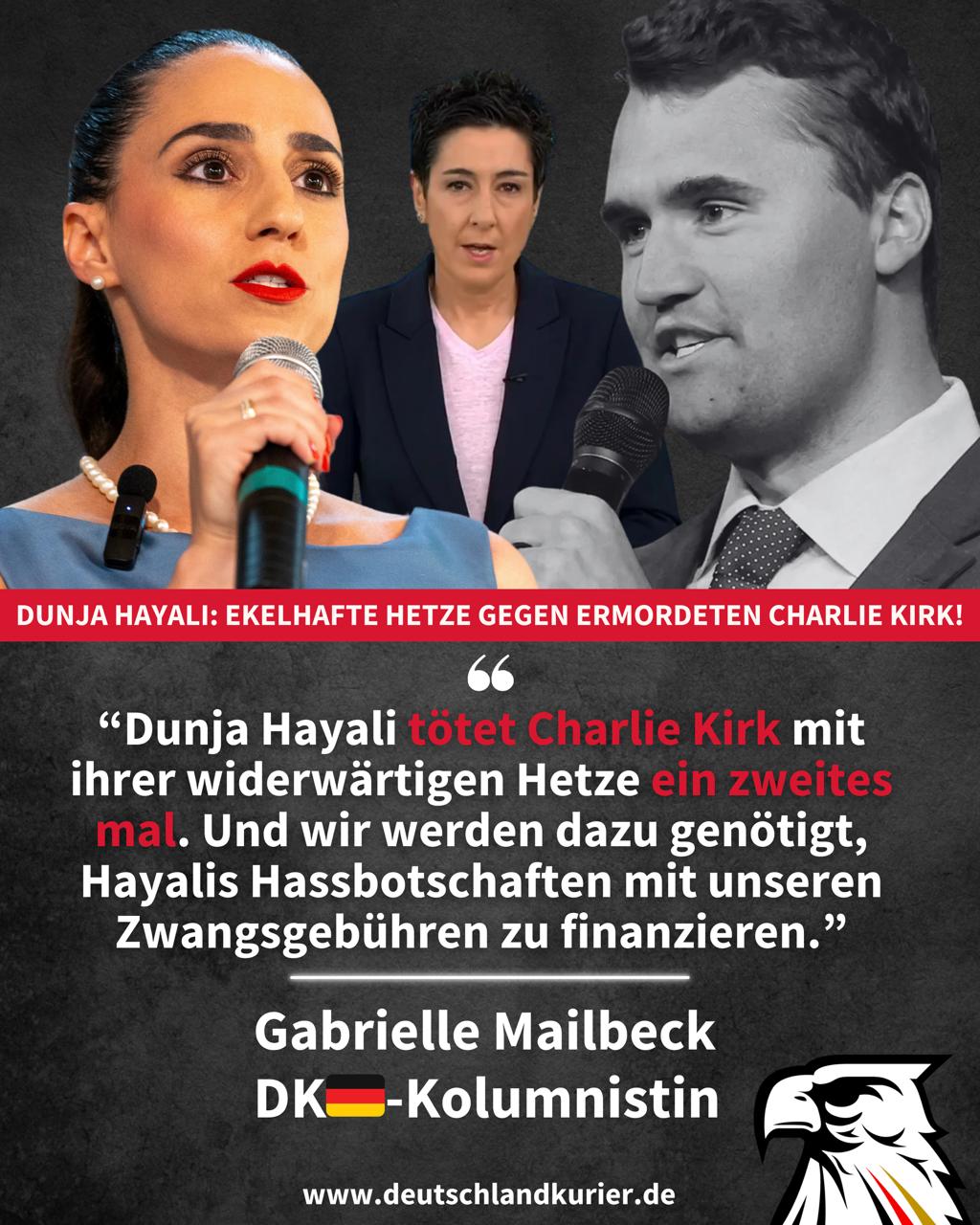
 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























