
Das Buch „Die Natur der Literatur. Zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität“ gehört zu den bekanntesten ungelesenen Werken in deutscher Sprache. Den Titel kennen mittlerweile ziemlich viele, seitdem sich der österreichische Plagiatsprüfer Stefan Weber über die auch in Buchform erschienene Promotion Robert Habecks hermachte. Der Politiker seinerseits erblickte darin einen Angriff auf seine Person mitten im Wahlkampf, die er mit einem eigens zu diesem Zweck produzierten Video beklagte. Aber was steht eigentlich in diesem Frühwerk des Kanzlerkandidaten d. D.?
Weber konzentrierte sich berufsbedingt darauf, welche Textteile sich ohne Quellennachweis bei Habeck finden, aber eben auch schon vorher bei vielen anderen Autoren. Die kritische Gesamtwürdigung steht bis heute aus. Möglicherweise fand sie auch niemals statt, noch nicht einmal in dem Promotionsverfahren vor 25 Jahren. Die Rezension kommt also schon deshalb nicht zu spät. Sie eröffnet uns nicht nur den Blick auf Habeck selbst, sondern auf einen bestimmten Aufsteigertypus, und ganz nebenbei auch auf einen akademischen Betrieb, der Texterzeugnisse dieser Sorte in ähnlicher Frequenz ausstößt wie ein chinesischer Frachter Temu-Pakete. Der Unterschied besteht vor allem im Interesse auf der Abnehmerseite.
„Robert Habeck“, heißt es in der Inhaltsangabe, „grenzt in diesem Buch literarische Verstehens- und Deutungsmuster gegen die visuellen Darstellungsformen neuer Medien ab. Die Untersuchung schließt an aktuellste medientheoretische Debatten an, nimmt aber in zweierlei Hinsicht eine Gegenposition zu den im Schwange befindlichen Theorieansätzen ein. Zum einen versucht sie nicht, eine alle Darstellungsformen unter seinen Begriff subsumierenden Rahmen zu schaffen, sondern die jeweilige Eigenständigkeit unterschiedlicher Kunstformen herauszuarbeiten. Zum anderen begründet sie deren Bedeutung nicht mit dem ontologischen Begriffsarsenal, sondern durch eine konstruktive Reformulierung überkommener Methoden. Schließlich fluchtet sie die gattungstheoretischen Fragen auf einen kulturellen Focus. Als tertium comparationis dient der Begriff der Natur, der als Anschauungsraum verstanden, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Füllungen erhalten hat, die nicht unabhängig von dem jeweils dominanten Darstellungsmedium sind.“
Bevor es hier um die spezifisch Habecksche Fülllung des Anschauungsraums geht, soll die ebenfalls besondere Plagiatsmethode noch eine Rolle spielen. Beides lässt sich nicht voneinander trennen.
Die Affäre um die Literaturangaben in der Doktorarbeit Robert Habecks – teils verschleiernd, teils aus anderen Fußnoten abgeschrieben – besteht aus zwei Teilen: Zum einen der Arbeit des damals noch jungen Germanisten selbst, für die der Doktorand viele der vom ihm zitierten Werke offenkundig nicht im Original konsultierte, sondern Lesefrüchte aus Sekundärquellen abschöpfte. Das ist nicht verboten – nur sollte der Autor in seiner Doktorarbeit eben kenntlich machen, auf welche Weise er zu seinem Wissen kommt, vor allem aber nicht seine Quellen absichtlich verschleiern. Die Verschleierung gelingt ihm allerdings nicht komplett, da er in etlichen Fällen nicht nur Quellenangaben von anderen abschreibt, sondern auch darin enthaltene Namens-, Zuordnungs- und Datierungsfehler übernimmt, die einem Kenner der Originalliteratur hätten auffallen müssen. Er hinterlässt auf diese Weise hier und da seine Fingerabdrücke am Material.
Teil zwei betrifft die Habecksche Selbstverteidigung, bei der er wiederum den Sachverhalt nach Kräften verwischte. „Die Anschuldigungen“, so der Autor und Politiker in einer Videobotschaft, „– übrigens nicht wie sonst Textplagiate, sondern Ungenauigkeiten in den Fußnoten – stammen vom Plagiatsjäger Stefan Weber. Wer ihn beauftragt hat und wer ihn bezahlt, weiß ich nicht, da er seine Geldquellen ja im Verborgenen lässt und über seine Geldgeber keine Transparenz herstellt.“ Mit der Formulierung „Ungenauigkeiten in Fußnoten“ versucht er Weber als Korinthenausscheider hinzustellen und vermutlich verfängt die Methode auch bei einem bestimmten Publikum.
Aber erstens handelt es sich bei einer wissenschaftlichen Arbeit bei den Quellenangaben – und genau die stehen bei ihm in den Fußnoten – um keine Nebensache, sondern eine tragende Säule des gesamten Textes. Und zweitens begeht jemand auch ein Plagiat, wenn er fremde Literaturangaben in Fußnoten per Copy and Paste übernimmt, abgesehen von dem einen Fließtextplagiat, das es bei Habeck auch gibt. Insgesamt zählt Weber 128 dieser nicht gekennzeichneten Übernahmen. Der Plagiatsforscher bietet in der Tat seine Gutachten über Dissertationen als Dienstleistung an. Aber genau deshalb existiert ja eine Veröffentlichungspflicht für Doktorarbeiten: Jeder soll sie überprüfen können, auch Jahre später.
Ob Weber dafür einen Auftrag bekam oder sich den Fall wegen der Prominenz des Kanzlerkandidaten-Autors vornahm, spielt also nicht die geringste Rolle für die Vorwürfe selbst, die Habeck auch in der Sache gar nicht bestreitet, sondern zu erledigen hofft, indem er die Nebelmaschine anwirft. Genau dieses rhetorische Wabern findet sich auch in seinem Text selbst, zunächst dort, wo er andere Werke abgrast, aber auf ganz ähnliche Weise auch in seiner Originalhabeckschen Abhandlung.
Um kurz die Abgreifmethodik zu skizzieren: Gleich in der Einleitung kopiert er die Verweise auf Texte von Marshall McLuhan, Bazon Brock und Vilém Flusser aus Jürgen Bräunleins „Bilde Künstler, rede nicht“. Bei Bräunlein finden sich die Fußnoten zu allen drei zitierten Autoren auf einer Seite, genau diese Fußnoten erscheinen auch alle zusammen auf einer Seite bei Habeck. Nur Bräunlein erwähnt er an dieser Stelle nicht. Dafür woanders und hier mit ordentlicher Quellenangabe, womit er dokumentiert, dass er dessen Werk kennt (die erwähnten Werke von McLuhan, Brock und Flusser aber offensichtlich nicht). Bei anderen Fußnotenübernahmen wandern die Fehler, siehe oben, gleich mit. Auf Seite 16 etwa übernimmt er nicht nur den Verweis auf Sylviane Agacinski aus einer Quellenangabe von Jonathan Culler, sondern auch dessen Falschschreibung („Agacinsky“).
Wer sich an der Textarbeit anderer Autoren bedient, übernimmt zwangsläufig auch deren Schwerpunktsetzung, was zu der Frage führt, worin die eigenschöpferische Leistung des Verfassers besteht. Davor steht aber noch ein ganz grundsätzliches Problem: Was will er überhaupt? Robert Habeck möchte die gattungsspezifischen Eigenheiten der Literatur herausarbeiten, um sie auf diese Weise gegenüber anderen Kunstformen abzugrenzen. Da aber niemand so recht das Gattungsspezifische der Literatur bestreitet, begibt er sich mit seiner Arbeit, um es höflich zu sagen, nicht gerade auf einen steinigen Pfad neuer Erkenntnisse, sondern auf ein sehr weites Feld, das dem Forscher kaum noch ein unbetretenes Fleckchen bietet. „Konstruktive Reformulierung überkommener Methoden“ – da deutet der Autor schon an, dass es ihm hauptsächlich darum geht, historische Expeditionsrouten noch einmal abzulaufen. Wie er das tut, das sagt vor allem etwas über ihn selbst. Es handelt sich also bei „Die Natur der Literatur“ in allererster Linie um die gattungspraktische Herleitung des Robert Habeck, aufwendig, aber nicht besonders kunstvoll verpackt. Ein paar Erkenntnisse springen am Ende trotzdem heraus.
Der Zeitverlauf in einem Text – für Habeck (und ganz allgemein) ein Merkmal des Literarischen – grenzt er von den „neuen Medien“ beispielsweise ab, indem er darauf hinweist, dass dort „Bildfolgen und Sequenzen“ das zeitliche Fortschreiten imaginieren. Das klingt dann so: „Die Simulation des Raums determiniert die temporale Struktur der linearen Abfolge.“ Wieso schon der Raum definieren soll, in welcher Reihenfolge beispielsweise bei einem Video von Tony Oursler die einzelnen Bildsequenzen stehen, erschließt sich nicht so recht. Jedenfalls will er sagen: Da kommt eins nach dem anderen. Er bemüht sich nicht nur an dieser Stelle um größtmögliche Umständlichkeit. Hier hantiert jemand mit Schaumstoffwürfeln, stöhnt und schwitzt aber dabei, als würde er Klaviere in den zehnten Stock schleppen. Das Buch enthält zahlreiche luzide Passagen – nur handelt es sich dabei durchweg um Zitate. Etwa den Satz von Norbert Bolz: „Wenn die Bilder das Ereignis ursupieren und vorprägen, entfällt das wesentliche Charakteristikum des Bildes – nämlich abbildend einzustehen für etwas Abwesendes.“
Den Gedanken könnte Habeck auch einfach so stehenlassen. Aber Moment, in einer Promotion geht es schließlich um das Eigene. Also wiederholt er Bolz mit eigenen Worten, er übersetzt ihn mit dem „Einstreichen der semiotischen Beziehung als solcher, nach der im allgemeinsten Sinn etwas durch etwas anderes bedeutet wird. Gibt man die Unterscheidung von Referenzebenen auf, wird es unmöglich, die Struktur der Interpretationsbeziehung en zu analysieren.“ Das Einstreichen des Textes wiederum hätte dem Werk durchaus genutzt, übrigens auch die Formulierung „der Referenzebenen“, denn sie sollen ja voneinander unterschieden werden und nicht von etwas, das zu einer anderen Kategorie gehört.
Mit dem Zitieren von McLuhan, Derrida, Blumenberg, Hegel und vielen anderen bringt unser Reformulierer schon einmal gut die Hälfte seiner Arbeit herum. Was er präsentiert, stellt eher eine Art Literaturrecherche dar, bei der auffällt, was beziehungsweise wen sie alles nicht enthält. Roland Barthes Begriffe Punctum und Studio – ersteres das, was aus der Kunst direkt in uns dringt, das zweite, was nur „höfliches Interesse“ hervorruft – hätte der Autor mit Gewinn nutzen können, um erst einmal das Kunstspezifische näher zu bestimmen, ehe er zum gattungsspezifischen der Literatur weiterschreitet. Denn von Literatur und bildlichen Darstellungen bis zum Video gibt es schließlich Werke in großer Zahl, die zwar formal zur Gattung gehören, aber nicht zur Kunst, weil ihnen die Schöpfungshöhe fehlt.
An vielen Stellen erklärt Habeck mit der ihm eigenen Ungelenkigkeit, das Literarische erschöpfe sich nicht in der Abbildung, sondern entstehe erst durch einen ästhetischen Überschuss (was aber auch für andere Gattungen gilt). Darüber, wie ein poetischer Überschuss aus der Sprache selbst wächst (und wie er durch schlechte Übersetzungen wieder verloren gehen kann), verfasste Rainer Kirsch 1976 ein heute nur noch antiquarisch verfügbares schmales und großartiges Werk, „Das Wort und seine Strahlung“. Auch das kommt in dem Konvolut nicht vor. Wem diese Leerstellen auffallen, der kann sich kaum noch gegen den Verdacht wehren, dass Habeck nicht nur sehr viele Texte oder vielmehr deren Fragmente nur aus zweiter Hand konsumierte, sondern darüber hinaus auch gar nicht erst nach Quellen suchte, die er in seinem Sekundärliteraturstudium nicht schon fertig angerichtet vorfand, auf die ein angehender neugieriger Germanist aber hätte stoßen müssen. Dort, wo Habeck sich abmüht, schreibt Kirsch klarer und elegant; eigentlich sagt er zumindest zum Gattungsspezifischen der Lyrik alles Nötige.
An etlichen Ausführungen Habecks findet sich nichts Falsches, nur liegen dazu fast immer auch besserer Texte anderer Autoren vor. Solange er sich am Bekannten entlangtastet, geht nichts wirklich schief, einmal abgesehen davon, dass hier jemand durch Gefilde zu streifen versucht, der vor Gespreiztheit kaum laufen kann. Schlimm wird es erst, wenn er es mit dem „Denken ohne Geländer“ (Hannah Arendt) versucht, beispielsweise in einer Passage über Fiktionalität. „Auf der anderen Seite ist die Folge der Selbstreferenz als Konstitutionsbedingung der Literataur (sic), dass sie ihren Bedeutungsanspruch nur behaupten kann, wenn es ihr gelingt, die Bedingungen ihrer Möglichkeit vergessen zu machen. Die literarische Fiktion muss die Erinnerung an ihr Zustandekommen tilgen.“
Hier serviert er einen solchen Quatsch mit dünnster Bedeutungssoße, dass es jedem Doktorvater genauso hätte auffallen müssen wie der Druckfehler „Literataur“. Natürlich imaginiert fiktionale Literatur immer eine Erzählperspektive – was denn sonst? Aber genauso selbstverständlich tilgt der Autor nicht die „Erinnerung an ihr Zustandekommen“ (beim Leser, das meint Habeck ja offenkundig). Ein Leser weiß, dass sich Thomas Mann nicht wirklich für „Joseph und seine Brüder“ auf die Zeitreise ins pharaonische Ägypten begeben hatte, dass Swift sich niemals nach Lilliput einschiffte, ja noch nicht einmal Gulliver selbst. Die Leser der „Göttlichen Komödie“ nahmen auch schon vor hunderten Jahren nicht an, Dante und Vergil wären durch sämtliche Höllenkreise spaziert. Die Fiktion verdrängt nicht die sachliche Ebene der Alltagserfahrung. Sie überlagert sie, ohne sie auszulöschen. Der Reiz ergibt sich gerade dadurch, dass niemand diese Ebene „vergisst“, sondern dass sie immer durch die Imagination schimmert. Erst durch die Spannung zwischen beiden Qualitäten entsteht der höhere Energiezustand, der Literatur von einem rein informativen Text unterscheidet.
Zum Beginn der Passage fragt sich der Leser, wem Habeck eigentlich meint erklären zu müssen, dass Fiktion in erzählender Prosa und in der Lyrik eine zentrale Rolle spielt. Denn dieser Versuch mutet im ersten Moment so an, als ob ein angehender Doktor der Mathematik seine Dissertation unter anderem damit füllen würde, lang und breit die Winkelsumme im Dreieck zu erörtern. Dann stellt sich aber heraus, dass sich unser Polyhistor schon bei der Erklärung einer Banalität hoffnungslos verheddert. Oder – auch das lässt sich nicht ausschließen, vor allem nach Würdigung des Gesamtwerks – er versteht wirklich nur Bahnhof, und das schon bei den Grundlagen. Da hilft auch das lauteste Klappern mit Derrida- und Hegel-Zitaten nichts. Stattdessen drängt sich ein bekannter Satz von Karl Kraus auf: „Es genügt nicht, sich keine Gedanken zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.“
Unter den wiederkehrenden Problemen in Habecks Texten nimmt der immer wieder aufs neue vergeigte Objektbezug eine Sonderstellung ein „Deutlich wird das“, schreibt er beispielsweise, „an der Parallelität zu der Geschichte der Religion nach der Hegels Modell der romantischen Kunst konstruiert worden ist.“ Abgesehen vom fehlenden Komma: Geht es nun um die Geschichte „der Religion, nach der Hegels Modell konstruiert ist“? Oder konstruierte Hegel sein Modell anhand der Religionsgeschichte? Diese beiden wirklich sehr unterschiedlichen Möglichkeiten lässt der gallertige Satz offen.
Andererseits findet sich keinerlei Beleg dafür, wie Hegel von dem wirklich sehr breiten Terrain der Religion und dem noch weiteren der Religionsgeschichte auf das vergleichsweise schmale Brett der romantischen Kunst in Deutschland kommt. Schade, denn davon läse man wirklich mit Interesse. Aber es geht schon weiter atemlos durch den Schacht; der angehende Doktor wirft sich jetzt auf die Religion, zumindest auf das, was er glaubt davon verstanden zu haben. „Das aus der Kunst der abendländischen Moderne ablesbare Selbstverständnis des Menschen“, fährt er gleich nach dem Hegel-Satz fort, „findet sein Pendant im protestantischen Christentum, nach dessen Glaube Gott nicht mehr eine abstrakte Erhabenheit ist, sondern in Christus eine reale, sterbliche, d. h. zeitliche Existenz angenommen hat.“ Wenn er das für speziell protestantisch hält – woran glauben dann nach Habecks Meinung um Himmels Willen die Katholiken und die Orthodoxen? Das Konzil von Nicäa, das bekanntlich als verbindliche Glaubenslehre beschloss, Christus sei ganz Mensch und ganz Gott, liegt nun schon eine Weile zurück, nämlich genau 1700 Jahre. Es fand also nicht nur ein gutes Stück vor der Reformation statt, sondern auch vor dem Morgenländischen Schisma von 1054. Welcher Christ egal welcher Kirche hält Gott für eine „abstrakte Erhabenheit“? Die Inkarnation der Botschaft Gottes durch den göttlichen und gleichzeitig menschlichen Jesus Christus steht überall im Zentrum des Glaubens.
Was Habeck sich hier zusammenreimt, nimmt in Form und Inhalt schon seine späteren Aussagen zur Entfernungspauschale und zum Insolvenzrecht kongenial vorweg. Statt sich mit einer Angelegenheit zu befassen, spekuliert er unbeholfen herum, macht sich lächerlich, reagiert aber höchst eingeschnappt, wenn ein bayerischer Rentner den dafür passenden Fachbegriff verwendet. Wie konnte dieser Kokolores im Quadrat eigentlich durch ein Promotionsverfahren rutschen? Was denken sich die Verantwortlichen der Universität dabei? Schämen sie sich wenigstens heimlich ein bisschen?
Erst ziemlich zum Ende beschäftigt sich Habecks Arbeit überhaupt mit literarischen Texten. Einer davon, Hölderlins „Brod und Wein“ zählt zu dem Schönsten der deutschsprachigen Dichtung überhaupt. Hier legt der Doktorand nun seine gattungsspezifische Elle an. „Formal lässt sich diese dekonstruktivistische Argumentation sehr gut in Fortführung des selbstreflexiven Bezugs von Brod und Wein als Text, der die Einsetzung eines neuen Gottes nicht nur beschreibt, sondern an sich vornimmt und sich damit selbst an die Stelle Gottes setzt, nachzeichnen“, heißt es da. Wie: Der Text setzt sich an die Stelle Gottes? Höchstens kann sich das lyrische Ich dorthin setzen, aber nie und nimmer eine Elegie. Hölderlin hielt allerdings das Göttliche und Gott nicht für Dasselbe. Ein verständnisvoller Doktorvater hätte dem Promovenden hier sanft geraten, sich einmal näher mit dem Begriff der Theosis zu befassen. Oder besser: erst einmal ganz grundsätzlich bestimmte Zeilen der Elegie auf sich selbst zu beziehen: „So komm! daß wir das Offene schauen/Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.“
Es wäre vergebene Liebesmühe gewesen. Habeck weiß vermutlich selbst, dass er damals ein nichtgelesenes und niemals zu lesendes Rummelblatt der Promotionsgeschichte ablieferte, beziehungsweise gleich sehr viele davon, einen ungenießbaren Auflauf aus Renommierbegriffen, Zettelkästen, Banalitäten und purem Quark. Die Quellenplagiate vervollständigen das Bild, machen die Angelegenheit aber nicht wesentlich schlimmer. Seine Hoffnung ruhte vermutlich darauf, dass kein Mensch dieses Konvolut je zur Hand nehmen würde. Das klappte ja lange recht gut; der Verlag Königshausen & Neumann, der die Doktorarbeit in Buchform herausgab, sparte sich ganz offensichtlich sogar den Lektor.
Journalisten, die sich offenkundig nie die Mühe machten, wenigstens ein Stück der Habeckschen Doktorarbeit zu lesen, rühmen ihn gerade mit Verweis auf seine Promotion als philosophischen Kopf. Von seiner späteren Autorentätigkeit fiel in ihren Texten meist ein milder Glanz auf den Politiker, der so ganz anders denkt und redet als andere in diesem Metier. Da, so lässt sich die Botschaft zusammenfassen, ist jemand Schuldenmacher und Poet dazu, beziehungsweise eigentlich umgekehrt: Ein Denker und Autor, der sich in den Niederungen der Tagespolitik für die Bürger aufopfert. Das legt einen Blick nicht nur in die Promotion, sondern auch in die späteren Werke Robert Habecks nahe, die er stets zusammen mit Ehefrau Andrea Paluch verfasste.
Es wird ein Schnelldurchgang, versprochen. In „Hauke Haiens Tod“, verfasst 2001, heißt es: „Im öligen Morgenlicht schwamm das Meer.“ Das Licht breitet sich also vor allem unter dem Meerwasser auf, denn sonst könnte es nicht darauf beziehungsweise in ihm schwimmen, wie immer man sich schwimmendes Wasser nun vorzustellen hat. Vermutlich so ähnlich wie öliges Licht. Dann grüßt auch wieder der Objektbezug: „Die Geschichte, die Iven so lange ruhig gestellt hatte, ging ihm jetzt nicht mehr aus dem Kopf.“ Wer stellt hier wen ruhig: Iven die Geschichte oder die Geschichte ihn? Und: Wenn sie ihn so lange ruhiggestellt haben sollte – nehmen wir diese Variante mal an – muss sie sich schon die ganze Zeit in seinem Kopf befunden haben. Im Kinderbuch „Der Ruf der Wölfe“ von 2019 heißt es: „Zwischen den dichten Stämmen steht die Stille. Nur die rieselnden Schneeflocken klirren leise. Der Vollmond gießt ein farbloses Licht über Himmel und Erde. Der Wald verschließt sich hinter einer schwarzen Mauer aus Kiefern.“ Für denjenigen, der Schneeflocken klirren hört, gib’s die Courths-Mahler-Medaille in Gold, gestiftet vom deutschen Akustikerverband. Aber wie und warum verschließt sich der Wald hinter einer Mauer von Kiefern? Damit man endlich den Wald vor lauter Nadelbäumen nicht mehr sieht? Selbst wenn in irgendeiner Welt lebendige Kiefern eine Art Limes bilden könnten, dann würde diese Mauer den Wald verschließen, aber nie und nimmer der personifizierte Wald sich selbst.
Im Jahr 2006 verfassten Habeck/Paluch für die taz eine Art poetologisches Credo, das es unbedingt verdient, für diese Gesamtschau noch einmal hervorgezottelt zu werden. Es fängt nämlich schon gut an mit der Beschreibung der Landschaft, an der unser Paar webt und wirkt: „Dort, auf der Geest, wo bis zur Erfindung des Kunstdüngers noch nicht mal Weizen wuchs, wohnen wir. Und damit nicht genug. Wir wohnen ganz oben an der dänischen Grenze, wo das Land dünn besiedelt ist und im nördlichsten KZ Schleswig-Holsteins die Nazis Menschen beim Torfstechen verrecken ließen.“
Vom Kunstdünger zur Siedlungsdichte bis zum KZ in nur drei Sätzen: die Sinneinheiten wirken in den Gemeinschaftstexten öfter wie ineinandergeschobene und ineinander verkeilte Waggons nach einem Eisenbahnunfall. Und damit nicht genug:
„Seitdem leben wir hier. In einer untypischen Lebensgemeinschaft, die an Ted Hughes und Sylvia Plath, Sartre und de Beauvoir erinnert, sich aber nicht wie diese Paare in eine Konkurrenz treiben lässt, die nicht zwischen Kinder ins Bett bringen und dem Abschlusskapitel des neuen Romans wertet, die also immer als gemeinsamer Lebensentwurf auftritt (also eher wie Lennon/McCartney oder vielleicht Marx und Engels).“
Die „Lebensgemeinschaft“ selbst lässt sich also nicht in die Konkurrenz treiben, sie wertet nicht und tritt als etwas auf. Nach genau diesem Stussmuster schwimmt auch schon das Meer im Öl, das Licht ist, und der Wald schließt sich hinter der Kiefermauer ein. Was den Sachverhalt angeht: Vermutlich wollen uns die Dioskuren sagen, dass sie es beide für genauso wichtig halten, ihre Kinder ins Bett zu bringen, wie ihren nächsten schlechten Roman abzuschließen. Nur bekommen sie diese ziemlich schlichte Aussage buchstäblich nicht auf die Reihe. Dafür aber ein reichliches halbdutzend Klingelnamen, denen sich das Autorenpärchen auf der Geest ganz nah fühlt: Hughes und Plath, Sartre, Beauvoir resp. „vielleicht Marx und Engels“. Letztere verband zwar nie eine Lebensgemeinschaft, sondern vor allem die Bereitschaft Engels, Marx’ Leben in London zu finanzieren. Aber mit historischen Details schlagen sich Habeck/Paluch schon mal gar nicht herum. Das ziemt sich nicht für einen großen Geist, würde Astrid Lindgrens Karlsson vom Dach sagen. Der besaß bekanntlich Witz und einen umschnallbaren Propeller auf dem Rücken, mit dem er fliegen konnte.
Dass es Robert Habeck erst zum Doktortitel, dann zum Vizekanzler der drittgrößten Wirtschaftsnation der Welt und zwischendurch noch zum Börne-Preisträger brachte, müsste einem fast Respekt abnötigen. Aber eben nur fast. Sein Aufstieg erzählt mehr über die katastrophale Elitenrekrutierung in dieser Gesellschaft als über ihn selbst. Seine Karriere verdankt er weniger seinen Texten, sondern hauptsächlich seinem Schaumschlag vor allem bei weiblichen Wählern, die gar nicht erst vom Öllicht lesen müssen, um seinem wollpulloverigen Charme zu erliegen. Selbst bei der Zeit zählt man nicht seine Derrida-Zitate, sondern lieber die Löcher in seinen Socken.
Robert Habeck, tief beleidigt von seinen Nichtwählern, überlegte in den letzten Wochen, ob er nicht ganz an den heimischen Schreibtisch retirieren sollte, um dort mit seiner friedrichengelsgleichen Gattin weiter die Schneeflocken klirren zu lassen. Jetzt bleibt er dem Vernehmen nach erst einmal doch in Berlin. Keine Bange. Solange das Zeitalter des Scharlatans andauert, bleibt auch er dort, wo der Windbeutel im sanften Medienlicht ganz oben schwimmt.





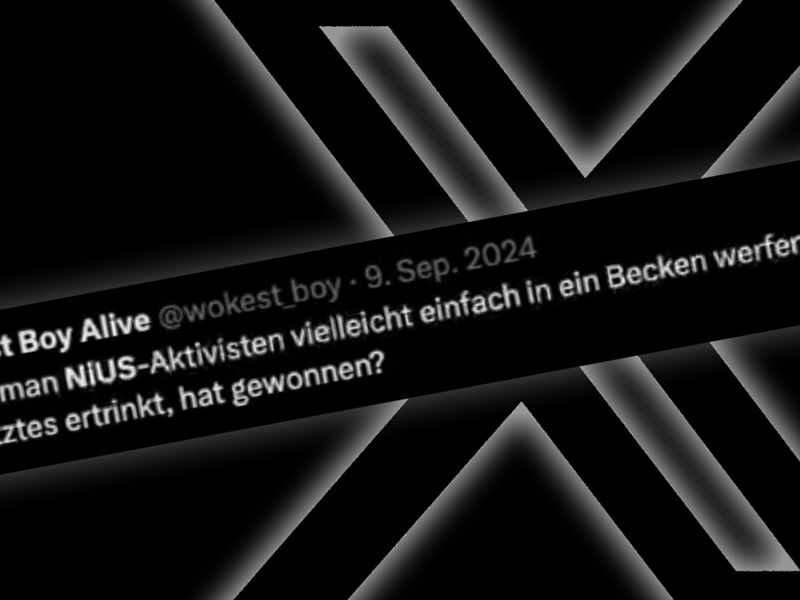

 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























