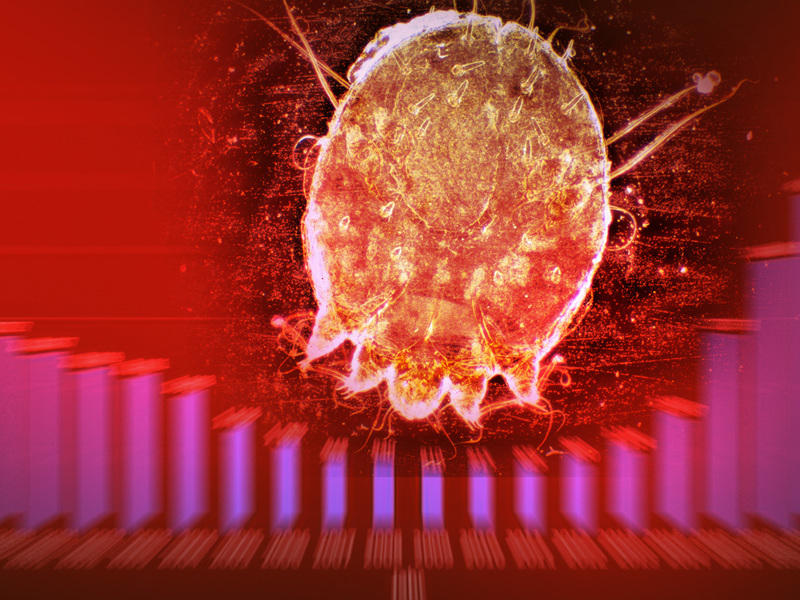
Die Krätze, medizinisch als Skabies bezeichnet, war in Deutschland über Jahre hinweg kaum noch ein Thema – doch nun kehrt die ansteckende Hautkrankheit zurück. Die Ostsee-Zeitung zitierte kürzlich den Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner mit den Worten: „Wir sehen seit einiger Zeit insgesamt eine steigende Tendenz bei den Fällen.“ Er fährt fort: „Für mich ist es nicht richtig erklärbar, woran das liegt.“
Doch woran liegt es? Hat die Rückkehr der Krätze möglicherweise etwas mit der Migrationsbewegung seit 2015 zu tun? NIUS widmet sich dieser Frage und führt Daten und fachliche Einschätzungen zusammen.
Die Datenlage belegt zweifellos einen signifikanten Anstieg der Skabies-Fälle in Deutschland – insbesondere seit Mitte der 2010er Jahre, zum Zeitpunkt der Grenzöffnung durch Angela Merkel. Eine Erhebung des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt, dass 2018 bei über 380.000 Patienten Skabies diagnostiziert wurde – etwa neunmal so viele Fälle wie noch im Jahr 2009. Besonders stark betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene, bei denen sich die Diagnosen in diesem Zeitraum sogar mehr als verelffacht haben, informiert das RKI. (Stand 28.06.2021)
Eine Studie (PMC Journal) aus dem Jahr 2021 beschreibt den Anstieg noch genauer: „Im ambulanten Bereich findet sich ein Anstieg zwischen 2010 und 2015 von 52,8 % auf etwa 128.000 Behandlungsfälle. Stationär werden aktuell jährlich über 11.000 Fälle mit Skabies als Hauptdiagnose dokumentiert.“
Die Entwicklung der stationären Fälle (2000–2017) visualisierten die Studien-Autoren folgendermaßen:
Quelle: PubMed Central
Die Studienautoren schreiben dazu: „Im Verlauf von 2000 bis 2017 zeigt sich ein U‑förmiger Verlauf: Während in den Jahren 2000 bis 2006 noch über 1000 Fälle als stationäre Hauptdiagnosen dokumentiert wurden, sank dieser Anteil nachfolgend bis auf 810 im Jahr 2009.“ Und weiter: „Seit dem Jahr 2014 ist wieder ein markanter, bisher anhaltender Anstieg zu verzeichnen.“
Die stationären Skabies-Fälle gingen zwischen 2000 (2.727 Fälle) und 2009 (810 Fälle) stetig zurück. Ab 2014 zeigt sich ein auffälliger Anstieg: von 1.587 Fällen in 2014 über 2.773 in 2015 auf 4.884 in 2017 – ein Anstieg um über 200 Prozent in nur drei Jahren. Dieser Wendepunkt fällt zeitlich mit der großen Fluchtbewegung nach Europa zusammen.
Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Fluchtmigration werden in Fachquellen genannt: Die Gelbe Liste Pharmindex führt aus, dass Krätze besonders dort auftrete, wo Menschen über längere Zeit in engem Kontakt leben – etwa in Pflegeheimen, Obdachloseneinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften. Auch Flüchtlingsunterkünfte werden hier explizit genannt:
„Flüchtlingsbewegungen wie 2015/2016, in denen hunderttausende Menschen aus Ländern des Nahen Ostens und Afrikas südlich der Sahara nach Europa flohen, nehmen bezüglich Skabies eine besondere Stellung ein. Einerseits kommen sie häufig aus Regionen mit hoher Skabies-Prävalenz, andererseits werden die Parasiten während den beengten, körpernahen Fluchtverhältnissen rasch übertragen, insbesondere unter Kindern und Jugendlichen.
Schätzungen zufolge sind Flüchtlinge bei der Ankunft im Zielland öfter von Skabies betroffen als die hiesige Bevölkerung. Dennoch wird das Risiko von Krätze-Ausbrüchen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften als gering eingestuft.“
So sieht ein von Krätze befallener Fuß aus.
Der Münchner Dermatologe Prof. Dietrich Abeck sagt zur besonderen Gefahr für Asylbewerber, sich mit Krätze anzustecken: „Das passiert aber natürlich auch bei Flüchtlingen, die während der Überfahrt nach Europa eng aneinander gepfercht über das Mittelmeer mit Booten anreisen.“ Prof. Hartwig Mensing aus Hamburg hebt hervor, dass bei betroffenen Flüchtlingen auch kulturelle Hürden hinzukommen: „Häufig ausgesprochen schwierig ist es, diese über die Notwendigkeiten aufzuklären, woraus eine unvollständige Therapie aller Kontaktpersonen resultieren kann“, so der Facharzt für Hautkrankheiten auf derma.plus.de. Derma.plus verweist zudem auf internationale Beispiele – wie etwa im Jahr 2015, als ein Pariser Flüchtlingscamp nach einem Skabies-Ausbruch aufgelöst wurde, um eine Weiterverbreitung nach Großbritannien zu verhindern.
NIUS fragte das RKI nach der Datenlage zwischen 2013/2014 und heute und nach möglichen Ursachen für den Anstieg. Es verwies in seiner Antwort auf die öffentlichen RKI-Informationen. Darin erkennt das Institut zwar den starken Anstieg der Fallzahlen an, bleibt bei der Ursachenbewertung aber zurückhaltend: „Wie die Zunahme im langjährigen Vergleich zu bewerten ist, ist unklar. Die lokale Häufigkeit der Skabies unterliegt langjährigen Zyklen, deren Ursachen jedoch unklar sind.“
Die Rückkehr der Krätze ist sicherlich ein komplexes Phänomen; einen klaren Anstieg der Skabies-Fälle, insbesondere ab 2014/2015, zeigen die Daten jedoch eindeutig. Die zeitliche Korrelation mit der Flüchtlingskrise legt die Migration als einen entscheidenden Faktor nahe – vorwiegend durch die beengten Lebensverhältnisse während der Flucht und in Erstunterkünften. Fachquellen bestätigen diesen Zusammenhang, betonen aber, dass auch andere Faktoren – wie Hygienemängel, Versorgungslücken oder mangelnde Aufklärung – eine Rolle spielen.
Migration allein erklärt den Anstieg zwar nicht allein – doch sie ist ein entscheidender Bestandteil des Gesamtbildes.
Lesen Sie auch:In 48 dramatischen Stunden zerschellt die Migrationswende von Friedrich Merz an der SPD








































