
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat ihren Hauskanon schnell gelernt. Wer die Rolle des Bundeswirtschaftsministers sachgerecht ausfüllen will, muss die Phraseologie von Bürokratieabbau, Wachstum als sozialem Stabilitätsfaktor, niedrigen Energiekosten und Investitionen in die Infrastruktur gekonnt beherrschen. Immer wieder neu miteinander kombiniert, situationsgebunden angepasst, ergibt sich aus den Gedankenstrichen die kurante Rhetorik eines Ministeriums, das für alles und nichts zuständig ist.
Reiche ist ein Medienprofi. Ein paar Kostproben gefällig? Auf dem Energie-Kongress im Mai sagte sie: „Energiepolitik ist weit mehr als Klimapolitik. Sie ist eine Sicherheitsfrage.“ Auf der Homepage der CDU heißt es: „Wachstum hat viele Facetten – und es ist unsere Verantwortung, dieses Wachstum in seiner ganzen Breite zu unterstützen und zu ermöglichen.“ Das sind klangstarke, druckreife Leerphrasen, universell kompatibel und eingebettet in wärmende Zukunftsrhetorik – ein Simulakrum politischer Kompetenz und Steuerbarkeit.
Das Problem: Wir kennen diese Phrasen aus der Vergangenheit zur Genüge. Sie überlagern gekonnt, was jeder mit Blick auf die Wirtschaft längst weiß: Es handelt sich um Funktionärs-Rhetorik – geübte Sprachspiele, die, spiegelt man sie mit der wirtschaftlichen Gegenwart, keinen Sinn mehr ergeben. Diese ist geprägt vom Aufbau einer Kontroll- und Steuerungsbürokratie und invasiver Dauerintervention, die die deutsche Wirtschaft in die Rezession getrieben haben.
Für diejenigen, die an einen starken Staat glauben und an seine Fähigkeit, über Infrastrukturinvestitionen reales Wirtschaftswachstum zu erzeugen, ist das mit 10 Milliarden Euro ausgestattete Wirtschaftsministerium viel zu klein dimensioniert. Für die Verfechter der reinen Marktlehre handelt es sich bei diesen 10 Milliarden Euro schlichtweg um rausgeschmissenes Geld. Es ist politisch gebundenes Kapital, das im Zweifelsfalle der Privatwirtschaft entzogen und vom freien Kapitalmarkt abgezweigt wurde. Eine Werbemaschine für marktwirtschaftliche Schönwetter-Propaganda, die sich der Steuerzahler leistet, um noch immer in der Illusion zu leben, Deutschland betreibe eine rationale Wirtschaftspolitik.
Für das entscheidende wirtschaftspolitische Feld, die Infrastruktur, wurde einmal das Verkehrsministerium geschaffen. Hier liegt die eigentliche Schaltstelle der aktiven Wirtschaftspolitik. Selbst die Bereiche der Landwirtschaft und Entwicklungshilfepolitik führen ein ministeriales Eigenleben. Bliebe noch der hochsensible Sektor der Energiewirtschaft. Amtsvorgänger Robert Habeck hatte sich die Kompetenzen für den Umbau der deutschen Energieerzeugung ins Wirtschaftsministerium geholt, wo sie sich auch nach wie vor befinden.
Hier führt Brüssel mit seiner Agenda des „Green Deal“ das Regiment. Reiche wird im extern gesetzten Rahmen einige Hundert Millionen Euro an Subventionen verteilen, die dann spektakulär zu einem späteren Zeitpunkt in Rauch aufgehen, wie im Falle des Subventionsfiaskos Northvolt. Das alles hat mit klassischer Ordnungspolitik, einer rahmensetzenden Schiedsrichterfunktion des Staates, nichts zu tun. Der Markenkern der christdemokratischen Wirtschaftspolitik ist längst verblasst, aufgegangen im Subventions- und Interventionsstaat sozialdemokratischer Provenienz.
Die deutsche Privatwirtschaft investierte im vergangenen Jahr ein Brutto-Volumen von ca. 906 Milliarden Euro. Setzen wir das Investitionsvolumen des Bundeswirtschaftsministeriums großzügig mit 9 Milliarden Euro an, so macht das, gemessen an der Privatwirtschaft, etwa 1 Prozent der Investitionen aus. Das sind Quisquilien im großen Spiel der Märkte. Es spielt im Grunde gar keine Rolle, was dort im Ministerium an klimaintelligenter Investitionssteuerung ausgeheckt wird. Es ist lediglich verlorenes Kapital, investiert an Stellen, die die Privatwirtschaft so niemals gewählt hätte.
Seit den Tagen Ludwig Erhards hat sich vieles geändert. Der Wirtschaftsminister ist heute ein König ohne Land. Er ist zuständig für Propaganda im Markt-Sound, um einer interventionistischen Politik marktwirtschaftliches Dekorum zu verleihen. Ein Schönwetter-Ministerium mit einer Pressestelle, die hilft, das Wirtschaftsressort in den Redaktionsstuben mit Inhalt zu versorgen.
Ein Evergreen unter den zahlenmäßig limitierten Sprachspielen und rhetorischen Routinen, die ein Wirtschaftsminister beherrschen muss, ist der des Bürokratieabbaus. Die Forderung nach einer Reduktion der kafkaesken Verwaltungsstrukturen der Bundesrepublik ist sicherlich konsensfähig. Aber es ist wohlfeile Rhetorik, inhaltsleer, irrelevant.
Das ifo Institut schätzt, dass die Wirtschaft jährlich mit Bürokratiekosten in Höhe von 146 Milliarden Euro belastet werde. Man lässt sich den regulatorischen Fortschritt und den Interventionismus, an dem auch das Bundeswirtschaftsministerium einen nicht unerheblichen Anteil hat, etwas kosten. Und da es sich um Geld des privaten Sektors handelt, lässt man in Berlin der Regulierungskreativität freien Lauf.
Den vielfach beschworenen Rückbau der Verwaltung wird es aus unterschiedlichen Gründen nicht geben. Deutschland verliert jedes Jahr mehr als 100.000 Arbeitsplätze. Das macht den öffentlichen Dienst zur letzten Verteidigungslinie der Politik, bevor es am Arbeitsmarkt zu heiß wird. Der Politiker, der in dieser Situation öffentliche Stellen zusammenstreicht, muss erst noch geboren werden.
Und in Deutschland dürfte die Mileische Kettensäge im Wahlvolk (noch) nicht mehrheitsfähig sein. Die deutsche Seele ist noch immer bewegt von der heimlichen Hoffnung, ein weiser Staatsmann käme (ein libertärer Kyffhäuser?), die großen Probleme des Landes aus der Welt zu schaffen. Selbstverständlich ist dies naiv Glaube. Aber es ist auch der Grund dafür, dass sich zu viele Bürger mit fadenscheinigen Gründen abspeisen lassen und dem Wachstum des Hyperstaats tatenlos zusehen.
Die Bedeutung der Bürokratie als Exekutive der übergriffigen Regulierungspolitik ist nicht zu unterschätzen. Bürokratien entwickeln ein Eigenleben, kämpfen um Budgets, finden gemeinsam mit ihrer politischen Repräsentanz überzeugende Rechtfertigungsrhetorik für ihre Existenz. Ein gutes Beispiel sind die Zollbehörden. Nach dem Wegfall der Grenzkontrollen durch die Schengen-Regeln suchte und fand man neue Betätigungsfelder, zum Beispiel den Kampf gegen die Schwarzarbeit in der Bauwirtschaft. Bürokratien verschwinden niemals, solange die Haupteinnahmequellen des Staates, das Steueraufkommen und die Verschuldung als zweiter Finanzierungsarm, munter weitersprudeln.
Und bislang kann die Regierung auf den deutschen Steuerzahler setzen. Das Steueraufkommen steigt kontinuierlich (auch dank der Inflation), der Reformzwang wird mit frischem Kredit gemildert. Die harte Kritik der OECD an der deutschen Wirtschaftspolitik wirkt da noch immer wie fernes Wetterleuchten. Es fehle an strukturellen Investitionsanreizen, heißt es im jüngsten Länderbericht über die deutsche Wirtschaftspolitik. Genehmigungsverfahren nähmen zu viel Zeit in Anspruch, eine lähmende Bürokratie ersticke ebenso wie das Steuerdickicht private Initiative. Alles bekannt und hundertmal von der Politik souverän übergangen.
Was zählt, ist der milliardenschwere Befreiungsschlag, den Finanzminister Lars Klingbeil in diesen Tagen vorbereitet. Die giganteske Schuldenorgie wird dabei helfen, Kritiker und offenkundige Probleme der Wirtschaft für einige Zeit in Schach zu halten. Kredit ersetzt Reformen, Staatswirtschaft verdrängt den freien Markt – so stellt sich die Regierung Merz den Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft vor.
In diesem Umfeld dominiert das Finanzministerium als Geldverteiler. Das Wirtschaftsministerium kann lediglich darauf hoffen, von der Kreditflut in seiner Funktion als eine von Klingbeils Subventionsaußenstellen zu profitieren. Das alles hat nichts mehr mit Ordnungspolitik zu tun. Deutschlands Wirtschaftspolitik ruht in den Händen überzeugter Zentralplaner und Lenker.
Schafft das Wirtschaftsministerium endlich ab.




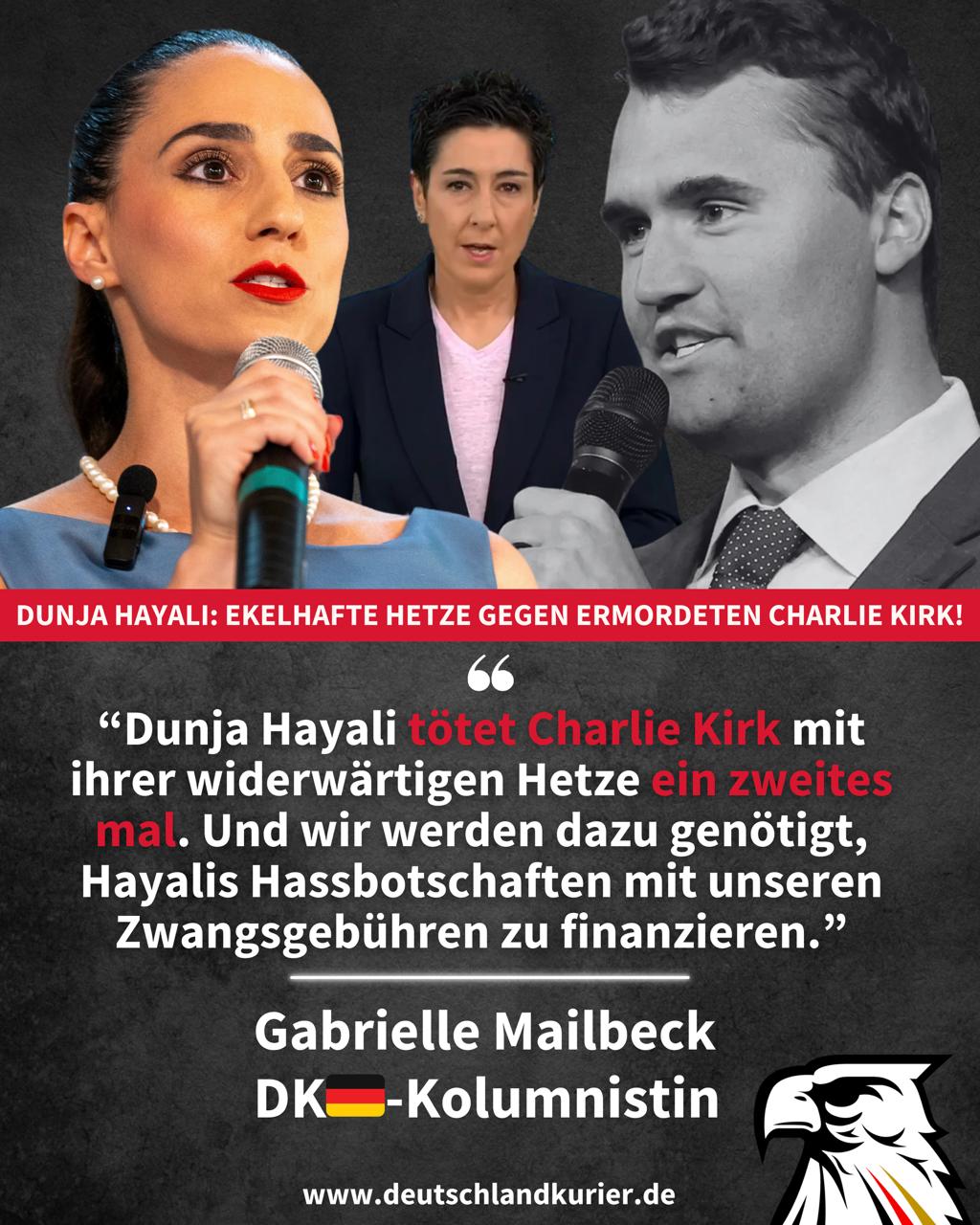




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























