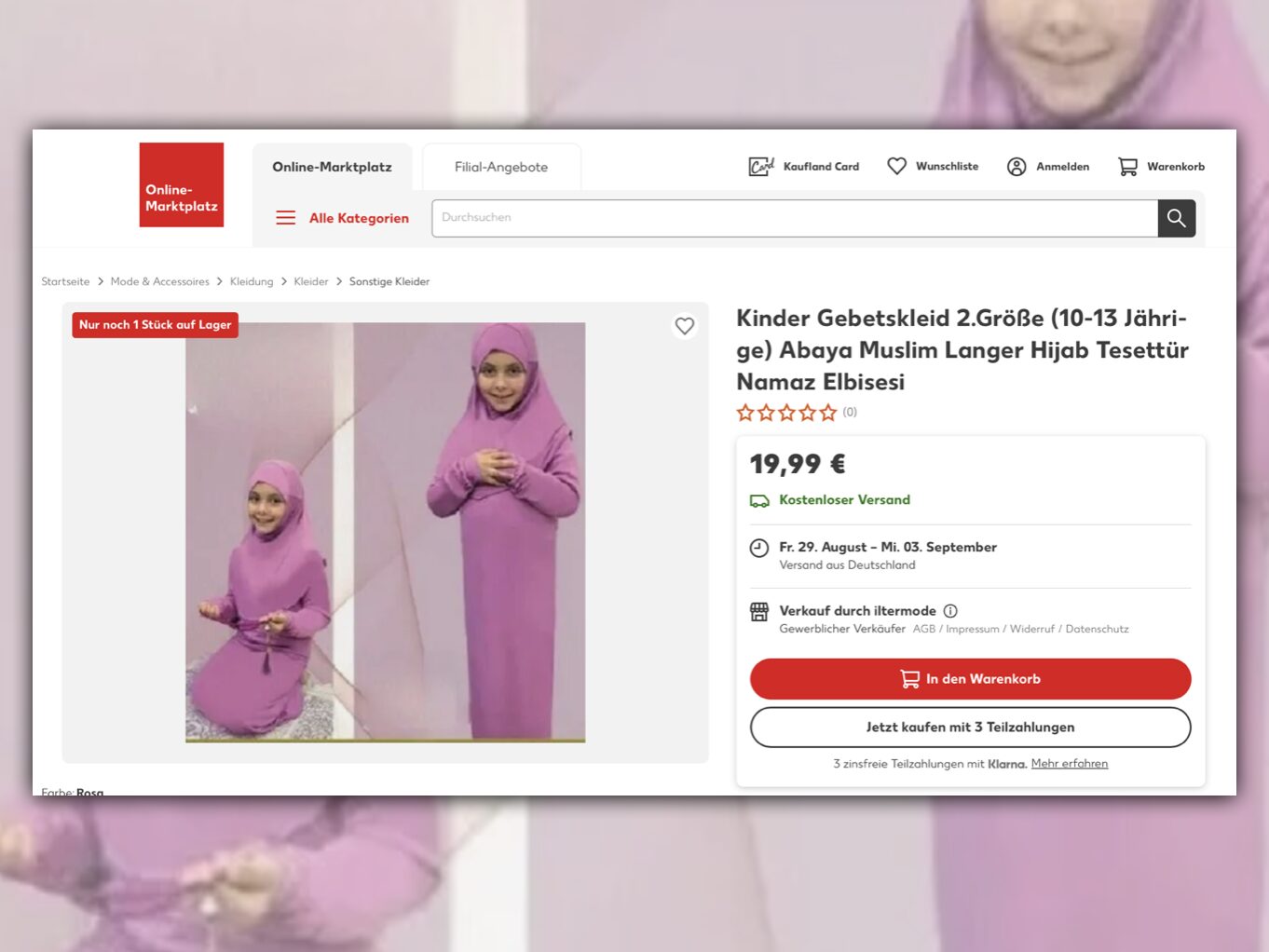Als im Zuge der fortdauernden Migrationskrise Millionen von Menschen nach Europa strömten, entdeckte die Politik das Christentum für sich, das sonst doch eher ein Randdasein fristet im bundesrepublikanischen Alltag. Angela Merkel sprach von Gott und stellte ihr Handeln als Ausdruck des Glaubens dar; und ausgerechnet die taz zitierte die Bibel und schalt den damaligen Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken dafür, dass er die Instrumentalisierung der christlichen Botschaft zur Legitimation von ungesteuerter Migration ablehnte.
Mit solcher Hellsichtigkeit stand Alois Glück weithin allein. Der deutsche Episkopat freute sich darüber, einmal nicht mit Negativschlagzeilen konfrontiert zu sein, sondern sich positiv positionieren zu können. Der Erzbischof von Hamburg, zugleich Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen, bezeichnete noch im Juli 2025 Merkels Handeln als „alternativlos“. Für die EKD, parapolitische Vorfeldorganisation der Grünen, gab es in dieser Hinsicht ohnehin kein Halten.
Nun ist das Bedürfnis zu helfen, ob man nun Christ ist oder nicht, lobenswert. Und für ersteren ist Nächstenliebe nicht optional, sondern eine Pflicht. Doch was einfach klingt und von der Politik auch dankbar in dieser Simplizität angenommen wurde, ist in der Realität durchaus komplexer. Denn um zu erkennen, was Nächstenliebe gebietet, muss man einerseits wissen, wer der Nächste ist, und andererseits, was Liebe bedeutet.
Ersteres Problem thematisierten Kritiker früh. Sie stießen sich an der „Liebe zum Übernächsten“, oder an der „Fernstenliebe“, daran, dass das deutsche Weltrettersyndrom sich nicht dem tatsächlich hilfsbedürftigen Nächsten widmete, sondern jeweils dem, der in den Medien am präsentesten auftrat, und dem, mit dem man sich am besten schmücken konnte. Hinzu kommt, dass Nächstenliebe zuerst eine persönliche Beziehung ist. Sie ist nicht kollektiv und auch nicht institutionell, auch wenn unzählige kirchliche Institutionen aus diesem Impuls heraus gegründet wurden.
Der Gedanke, man könne „den Flüchtlingen“ Nächstenliebe erweisen, indem man sie nach Deutschland hole, vernachlässigt, dass jeder dieser Menschen ein Indiviuum ist, dem mit der Ankunft in Deutschland noch lange nicht geholfen ist, sondern der dann Zuwendung, Unterstützung bei der Integration und vieles mehr benötigt. Es war abzusehen, dass dem enthusiastischen Bewerfen der Neuankömmlinge mit Teddybären und der überschießenden Hilfsbereitschaft eine stabile Grundlage fehlte, die auch dann noch trüge, wenn der Reiz der Moralinüberflutung nachgelassen haben würde. Für viele war das, was hier als Nächstenliebe firmierte, in Wirklichkeit ein egoistischer Akt, nämlich eine Selbstversicherung über die eigene moralische Güte, in der der Migrant lediglich als Instrument und Statist fungierte.
Das zeigt sich auch daran, dass bis heute Opfer der Konsequenzen ungesteuerter Migration marginalisiert werden. Allein schon aus Angst davor, als „rechts“ gegeißelt zu werden, thematisiert kaum jemand das Leid von Terror- oder Messeropfern: Hier wird ein leidender Nächster im Straßengraben liegen gelassen, weil die Beschäftigung mit ihm unangenehm ist, und die Bequemlichkeit des eigenen „christlichen“ Gebahrens entlarvt.
Noch weniger Interesse wecken jene Zuwanderer, die von anderen Migranten drangasaliert werden: Frauen und Mädchen, die in Flüchtlingsunterkünften Opfer sexueller Übergriffe werden, Christen oder Jeziden, die hier auf jene treffen, vor denen sie fliehen mussten, christliche Konvertiten, deren Asylverfahren scheitern, weil ihre muslimischen Übersetzer bewusst oder unabsichtlich falsch übersetzen: Sind all diese Menschen Nächste zweiter Klasse? Wird Nächstenliebe auf Kosten und zum Nachteil anderer geübt, dann ist es offensichtlich keine.
Dass die Hilfsbereitschaft derart selektiv ist, und dann auch noch häufig Täter ermächtigt, statt Opfer zu schützen, macht es noch bitterer, dass pauschal jene des Egoismus und des unchristlichen Verhaltens bezichtigt wurden (und werden), die sich kritisch äußerten.
Was zur völlig vernachlässigten Frage führt, was Liebe in diesem Kontext eigentlich bedeutet. Ist es liebevoll, Menschen aus ihrem vertrauten sozialen Umfeld herauszulocken, und ihnen ein Leben fern von der Familie aufzubürden? Zumeist in Gesellschaften, in denen Vereinzelung weit fortgeschritten ist, wo die gewohnten sozialen Netze weitgehend ersatzlos wegfallen? Ist es ein Ausdruck von Liebe, zu befördern, dass diese Menschen das Vermögen ihrer Familie und ihr Leben kriminellen Schleppern anvertrauen, sie der Gefahr aussetzen, als Sklaven in Libyen zu enden, in der Wüste zu sterben, im Meer zu ertrinken? Wem erweist man Liebe, indem man zulässt, dass Terroristen und Kriminelle über die Migrationsrouten einreisen?
Und schließlich muss man jene fragen, die beteuern, es handle sich doch um eine Win-Win-Situation, die in Europa den Fachkräftemangel behebe: Selbst wenn der Großteil der Zuwanderer dazu geeignet wäre, hier einen Beitrag zu leisten, wäre es nicht absolut gewissenlos, dieses Potential abzuziehen aus Ländern, die Ärzte, Pfleger, Ingenieure, Facharbeiter dringend brauchen?
Dass selbst in kirchlichen Kreisen die Mär vom Migranten als Fachkraftersatz gepflegt wird, obwohl die Heuchelei an dieser Stelle deutlich hervortritt, ist skandalös. Spätestens hier hätten Zwischenrufe die Migrationsromantik durchbrechen müssen.
Zudem ist der Mensch kein unbeschriebenes Blatt, keine Maschine, die man bedenkenlos hier und dort platzieren kann, wie es internationale Migrationsströme vorgeben. Menschen haben Wurzeln, Menschen brauchen Bindung. Es gab immer den Abenteurer und den Ausreißer – aber die wenigsten sind kosmopolitische Nomaden, die in Bangladesch ebenso aufblühen wie in Nordsibirien, die in Nairobi ebenso daheim wären wie in Böblingen.
Hätten Kirchenvertreter darauf hingewiesen, hätten sie konservative Gläubige vor dem Vorwurf geschützt, sich der Pflicht zur Nächstenliebe entziehen zu wollen, und sie hätten die Gesellschaft vor absehbaren Folgen gewarnt – auch und gerade als differenzierte Töne in der allgemeinen Emotionalisierung untergingen.
Der christlichen Botschaft hat man mit der Verweigerung von Differenzierung einen Bärendienst erwiesen. Angesichts der Folgen der Migration stellt sich diese einmal mehr als weltfremd und naiv, als unrealistisch und irrational dar – weil man der Gesellschaft – wieder einmal – nur eine verkürzte Version dieser Botschaft hatte zumuten wollen.
Mit den jüngsten zaghaften Versuchen der neuen Bundesregierung, in Sachen Migration eine Wende herbeizuführen, wird aus den ablehnenden Reaktionen aus dem Kirchenapparat auch ersichtlich, dass neben Gutgläubigkeit und Menschenfurcht ein dritter, ganz handfester Faktor eine Rolle spielt: Geld.
Die EKD und die katholische Kirche unterhalten in Deutschland riesige caritative Systeme, denen der Zustrom an Hilfsbedürftigen gelegen kommt. Dementsprechend beteiligen sich kirchliche Akteure, allen voran die EKD, über das Bündnis „United4Rescue“ sogar an der Schlepperei, die sie Seenotrettung nennen: Himmelschreiender Zynismus, insbesondere, da die katholische Kirche als Weltkirche ohnehin, aber auch die EKD beste Verbindungen in den globalen Süden unterhält – beide wären ideale Vermittler, um Menschen von der „Flucht“ abzuhalten.
Doch in der ihnen eigenen Mischung aus Naivität, Anbiederung und dem Bestreben, dem kirchlichen Apparat so viel Geld wie möglich zuzuführen, um Systeme zu erhalten – wie dysfunktional die auch sein mögen –, haben die beiden großen Konfessionen in der Flüchtlingskrise letztlich versagt.
Sie haben sich die Chance entgehen lassen, dem christlichen Glauben echte Relevanz zu verleihen, ihn zum Wohl der Gesellschaft und letztlich zum Wohl aller zu verkünden, und seiner unverkürzten Botschaft treu zu bleiben.