
Ein Mann steht hinter einer Bezahlschranke in der Londoner U-Bahn und fragt einen Schwarzfahrer, warum er sich durchgedrängt habe, anstatt eine Fahrkarte zu kaufen. Einige der vielen Schwarzfahrer, die er anspricht, sagen ihm, er solle verschwinden. Andere drohen ihm mit Gewalt. Irgendwann ist von einem Messer die Rede.
Während der Mann die Schwarzfahrer konfrontiert, schauen Mitarbeiter des Transport for London zu. Einer sitzt hinter einem Schalter, die Beine auf dem Tisch, und starrt auf sein Handy.
Statistisch gesehen nimmt man an, dass jeder 25. Passagier im öffentlichen Nahverkehr in London ohne Fahrkarte fährt, was die Stadt jedes Jahr Millionen kostet.
Der Mann im Video ist Robert Jenrick, Abgeordneter der Konservativen und Schatten-Justizminister. Damit wäre er im Falle eines Wahlsiegs seiner Partei für Gefängnisse und Gerichte zuständig. Der ehemalige Anwalt ist Abgeordneter für Newark in den East Midlands, eine Kleinstadt in der Nähe des bekannten Sherwood Forest.
In der Folgezeit kandidierte Jenrick für den Posten des neuen Vorsitzenden der Konservativen, unterlag jedoch in einem knappen Rennen Kemi Badenoch. Diese ernannte ihn daraufhin zu ihrem Schatten-Justizminister.
Jenrick begann, Videos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Diese änderten sein Image grundlegend. Vom konservativen Politiker, der gegen den Brexit gestimmt hatte, wurde er nun zu einem versierten rechten Aktivisten. Er sprach vor allem Themen an, die für die Bürger relevant sind, aber von der Presse ignoriert werden – zum Beispiel den Diebstahl von Werkzeugen von Arbeitern. Ein großes Problem für Wähler aus der Arbeiterklasse, die eben auf ihre Werkzeuge angewiesen sind.
Gegenüber TE berichtet eine Quelle aus der Nähe des Teams Jenrick, die namentlich nicht genannt werden möchte, Jenrick habe bewusst „Themen ausgewählt, die die Öffentlichkeit frustrieren, über die aber in Westminster niemand spricht“.
Videos zu drehen ist in der britischen Politik nichts Neues, doch Jenricks professionelle Clips erzielen spürbare Wirkung. Nach seinem Video über Schwarzfahrer bemerkten Online-Nutzer, dass an U-Bahn-Stationen mehr Polizei eingesetzt wurde, um Schwarzfahren zu verhindern. Andere Videos wirkten wie Mini-Dokumentationen, wie beispielsweise sein virales Video über den Chagos-Inseln-Deal, in dem die Regierung auf Grundlage einer höchst umstrittenen völkerrechtlichen Entscheidung bestimmt, der winzigen Insel Mauritius mehrere strategisch wichtige Inseln und Milliarden Pfund zu überlassen.
Die Labour-Partei hat über 400 Sitze im britischen Unterhaus inne, die Konservativen verfügen lediglich über 120. Das gibt ihnen nur begrenzte Möglichkeiten, die Regierung im Parlament zu bekämpfen. Internet und soziale Medien hingegen bieten eine Verbreitung weit über traditionelle Medien hinaus.
Jenrick etwa nutzte diesen Ansatz, um Wähler direkt anzusprechen, ihren Ärger zu kanalisieren und die Regierung zu Zugeständnissen zu zwingen, die sonst nicht umsetzbar gewesen wären. Die bereits zitierte Quelle aus Jenricks Umfeld nennt als Beispiel die Kehrtwende der Regierung in Bezug auf Grooming-Gangs, bei der Online-Wut aufgegriffen wurde, um Druck auf die Regierung auszuüben und sie zu einer nationalen Untersuchung zu drängen, obwohl sie diese zunächst ausgeschlossen hatte.
Deutsche Politiker könnten von Jenrick lernen. Noch ist undenkbar, dass ein deutscher Politiker sich dazu herablässt, auf Schwarzfahren im öffentlichen Nahverkehr aufmerksam zu machen. Aber warum eigentlich? Obwohl einige rechte Politiker in den sozialen Medien Erfolg haben, bleibt dieser meist harmlos, da die öffentlich-rechtlichen Medien bewusst nicht darauf reagieren. Doch der Schlüssel könnte darin liegen, eben viel näher an den Problemen der Bürger dranzubleiben und dem gezielten Herunterspielen durch den ÖRR entgegenzuwirken.
Man denke nur an die sexuellen Übergriffe an Seen und in öffentlichen Schwimmbädern in Deutschland: Wenn sich Politiker hier vor Ort sehen lassen und deutlich machen würden, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nehmen, könnten sie damit Vertrauen zurückgewinnen und über die sozialen Medien viele Menschen erreichen, die sich vom öffentlichen Rundfunk ohnehin abgewandt haben.
Oder wenn sie zum Beispiel medial auf Probleme wie Ladendiebstahl aufmerksam machen würden, der Unternehmen und Konsumenten Milliarden kostet, aber oft rechtlich folgenlos bleibt. Das Wegschließen der Waren, die strenge Überwachung der Läden und zusätzliche Sicherheitskräfte: Langsam aber sicher nähert sich Deutschland Zuständen wie im Vereinten Königreich, wo mittlerweile sogar Fleisch mit einem Diebstahlschutz versehen wird.
Jedenfalls haben die wenigsten, vor allem konservative, Politiker das Potenzial der sozialen Medien bisher für sich ausnutzen können. Manche, wie Maximilian Krah (AfD) oder Heidi Reichinnek (die Linke) versuchen, sich dort effektiv einzubringen – mit Erfolg. Vor allem für Wähler der Generation Z, Millenials und sogar für die Generation X werden die sozialen Netzwerke das Schlachtfeld um die Stimmen der Zukunft sein. Diese Generationen sind die Nettosteuerzahler der Gegenwart. Ihre Interessen werden politisch so gut wie gar nicht aufgegriffen, während sie für den komplett aus dem Ruder gelaufenen Sozialstaat und die Kosten der Massenimmigration die Zeche zahlen. Eventuell entscheidet sich das politische Schicksal Deutschlands gerade deshalb in den sozialen Medien.
Elisabeth Dampier ist freie Journalistin und schreibt für britische Print- und Onlinemedien wie The Spectator, The Daily Telegraph und The Critic.

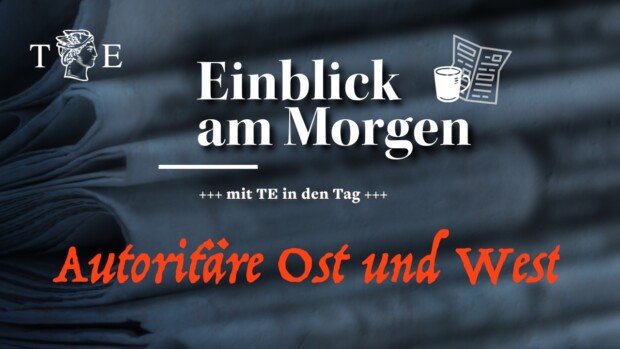



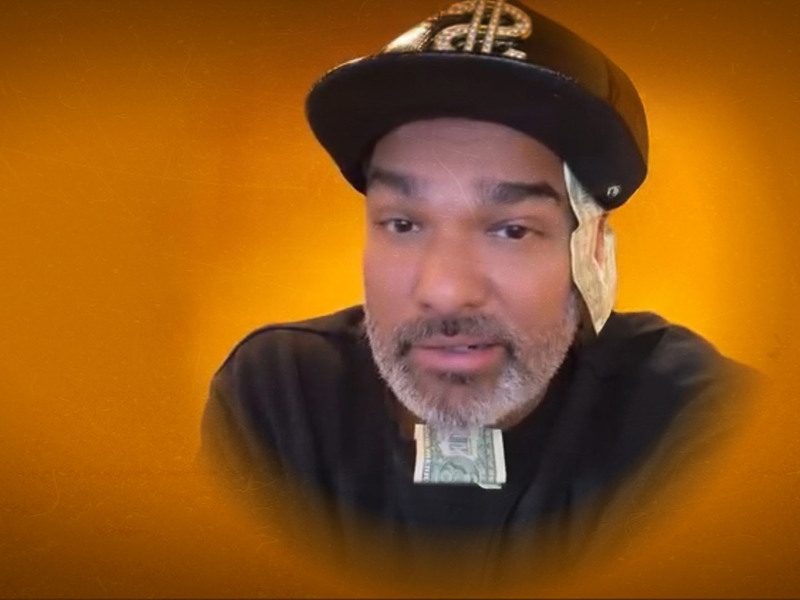


 PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM






























