
Deutschland hat gewählt. Das Ergebnis ist Schwarz-Rot. Zumindest ist es die einzige Zweier-Koalition, die aktuell realistisch im Raum steht. Schwarz-Blau hätte ebenso im Bundestag eine Mehrheit, wurde aber von der Union kategorisch ausgeschlossen. Und mit den Grünen alleine kann CDU/CSU nicht regieren.
Auf den ersten Blick keine bahnbrechende Veränderung: Die SPD, seit 1998 mit einer Unterbrechung in der Bundesregierung, wird mit der Union, seit 2005 mit einer Unterbrechung in der Bundesregierung, regieren. Durch die Stärke der AfD und den jüngsten Aufschwung der Linken ist diese vermeintliche „Große Koalition“, aber recht klein. Bei der letzten solchen Koalition 2017 hatte man noch eine Mehrheit von knapp 80 Prozent der Mandate – jetzt sind es nur noch 52 Prozent. Der Krux nun: Selbst mit den Grünen kommt man so nicht auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit.
AfD und Linke – Außenseiter im politischen Berlin, etwa in außenpolitischen Fragen – haben also eine Sperrminorität von über einem Drittel der Sitze im Bundestag. In entscheidenden Fragen können sie nun mitreden – und blockieren. Grundgesetzänderungen ohne zumindest eine von beiden Parteien sind unmöglich. Thema Nummer eins dürfte hier ein neues Bundeswehr-Sondervermögen sein. Bereits gegen das erste solche Sondervermögen, das per Verfassungsänderung die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse umging, stellten sich mehrheitlich beide Parteien.
Gerade angesichts der aktuellen Verhandlungen rund um einen Waffenstillstandsdeal für die Ukraine und die Debatte um Deutschlands sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA, haben dabei Union, SPD und Grüne weitere Verteidigungsausgaben ins Visier genommen. Aber sie hätten im neuen Bundestag nun nicht mehr die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für so ein zweites Sondervermögen. Natürlich könnte man Militärausgaben durch Einsparungen etwa bei den Sozialausgaben finanzieren, aber das ist mit der SPD wohl kaum machbar.
Geht man nun also auf Linke oder AfD zu? Oder auf die Suche nach fragwürdigen Methoden, um sie doch noch zu umgehen? Die Grünen bringen jetzt etwa ins Spiel, dass der alte, bereits abgewählte Bundestag ein entsprechendes Sondervermögen beschließen solle.
So meint Grünen-Politiker Özdemir jetzt etwa: „Wir haben keine Zwei-Drittel-Mehrheiten mehr im neuen Deutschen Bundestag, um die Verfassung zu ändern […]. Wir könnten aber noch in diesem Monat mit dem bestehenden Bundestag uns zusammensetzen mit Bündnis 90/Die Grünen, mit der CDU/CSU, mit der SPD, um dafür zu sorgen, dass wir mehr ausgeben können für die Landesverteidigung.“
Auch wenn abgewählt, ist der alte Bundestag formell noch im Amt, bis sich der neugewählte konstituiert hat. Dafür bleiben nach dem Grundgesetz 30 Tage Zeit. Im Schnelldurchgang wäre ein solcher Beschluss also möglich – aber politisch wohl schwer vertretbar. Schließlich haben die Wähler gerade ein neues Parlament gewählt.
Nicht ganz ausgeschlossen wäre auch, dass Union und SPD mit einfacher Mehrheit die Schuldenbremse im neuen Bundestag aussetzen. Das geht laut Grundgesetz etwa „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“.
Zum Einsatz kam diese Regelung etwa in der Corona-Pandemie. Womöglich nutzt man diese nun wieder unter Berufung auf eine „außergewöhnliche Notsituation“ angesichts von Trumps Verhandlungen rund um einen Ukraine-Deal und Zweifeln an der NATO-Bündnistreue der USA. Rechtlich wäre das wohl wacklig und dürfte am Ende in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht landen.
Neben Verfassungsänderungen hat die neue Sperrminorität von Linken und AfD aber auch Auswirkungen auf das Bundesverfassungsgericht selbst. Bisher werden die Richter dort nämlich je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt. Bisher lief das nach Absprachen unter den Parteien – nach einem festgelegten Schlüssel wurden Richter von der Union, SPD, Grünen oder FDP vorgeschlagen und dann von den anderen Parteien mitgewählt. Linke und AfD hatte man von diesem Verteilungsschlüssel bisher ausgeschlossen. Jetzt wäre das nicht mehr so einfach – denn auch von ihnen bräuchte man jetzt Stimmen im Bundestag.
Genau für so einen Fall hatte man aber erst zum Ende des letzten Jahres das Grundgesetz geändert: Kommt eine solche Richterwahl durch den Bundestag innerhalb eines Quartals nicht zustande, kann stattdessen der Bundesrat den Richter wählen – auch wenn dieser Posten eigentlich dem Bundestag zusteht. Im Bundesrat kommen nämlich Bundesländer mit Koalitionen aus Union, SPD, Grünen und FDP auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit.
Ebenfalls denkbar wäre eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Dort ist bisher einfachgesetzlich die Wahl der Richter mit Zwei-Drittel-Mehrheit vorgeschrieben. Mit einfacher Schwarz-Rot-Mehrheit im Bundestag könnte man also diese Regelung ändern und die Richterwahl-Mehrheit so etwa heruntersetzen – auf 60 oder 50 Prozent etwa, worüber Union, SPD und Grüne im neuen Bundestag verfügen.
Das könnte aber ebenfalls auf Widerstand stoßen, denn eine überparteiliche Wahl wäre dann wohl kaum noch nötig. Würden Verfassungsrichter künftig etwa nur mit einfacher Mehrheit gewählt, könnte die Regierungskoalition zumindest alle dem Bundestag zustehenden Richterposten ohne Zugehen auf die Opposition alleine besetzen.
All diese Fragen werden dabei nicht erst in entfernter Zukunft auftreten, sondern dürften bereits ab der ersten Sitzung den Bundestag beschäftigen: Denn aktuell ist bereits eine Richterstelle in Karlsruhe nur geschäftsführend besetzt. Auf die Wahl des Nachfolgers von Verfassungsrichter Josef Christ, dessen Amtszeit bereits mit dem November 2024 endet, hat man sich bisher noch nicht geeinigt. Den CDU-Richterkandidaten Robert Seegmüller wollten SPD und Grüne bisher nicht mittragen, er war ihnen zu asylkritisch. Durch die Verschleppung der Wahl eines Nachfolgers für Christ wird jetzt wohl der neue Bundestag entscheiden müssen – und dort eben ohne schwarz-rot-grüne Zwei-Drittel-Mehrheit.





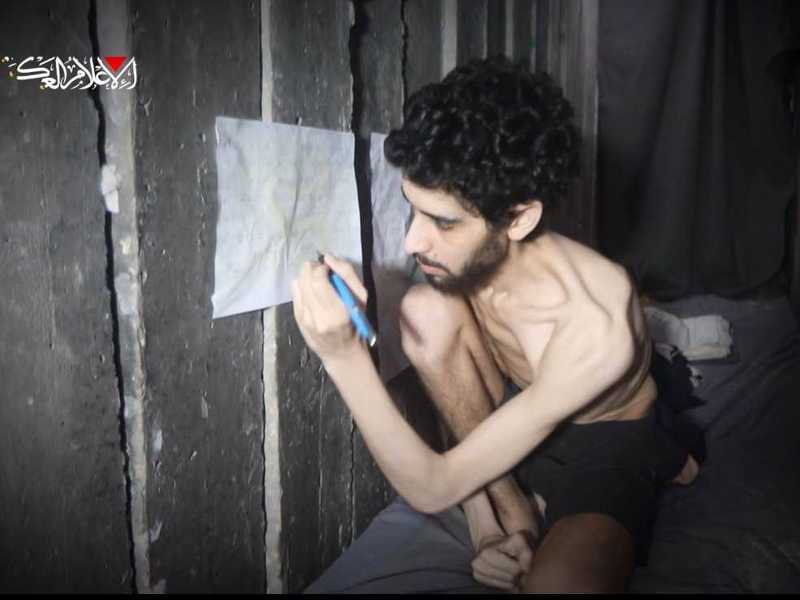

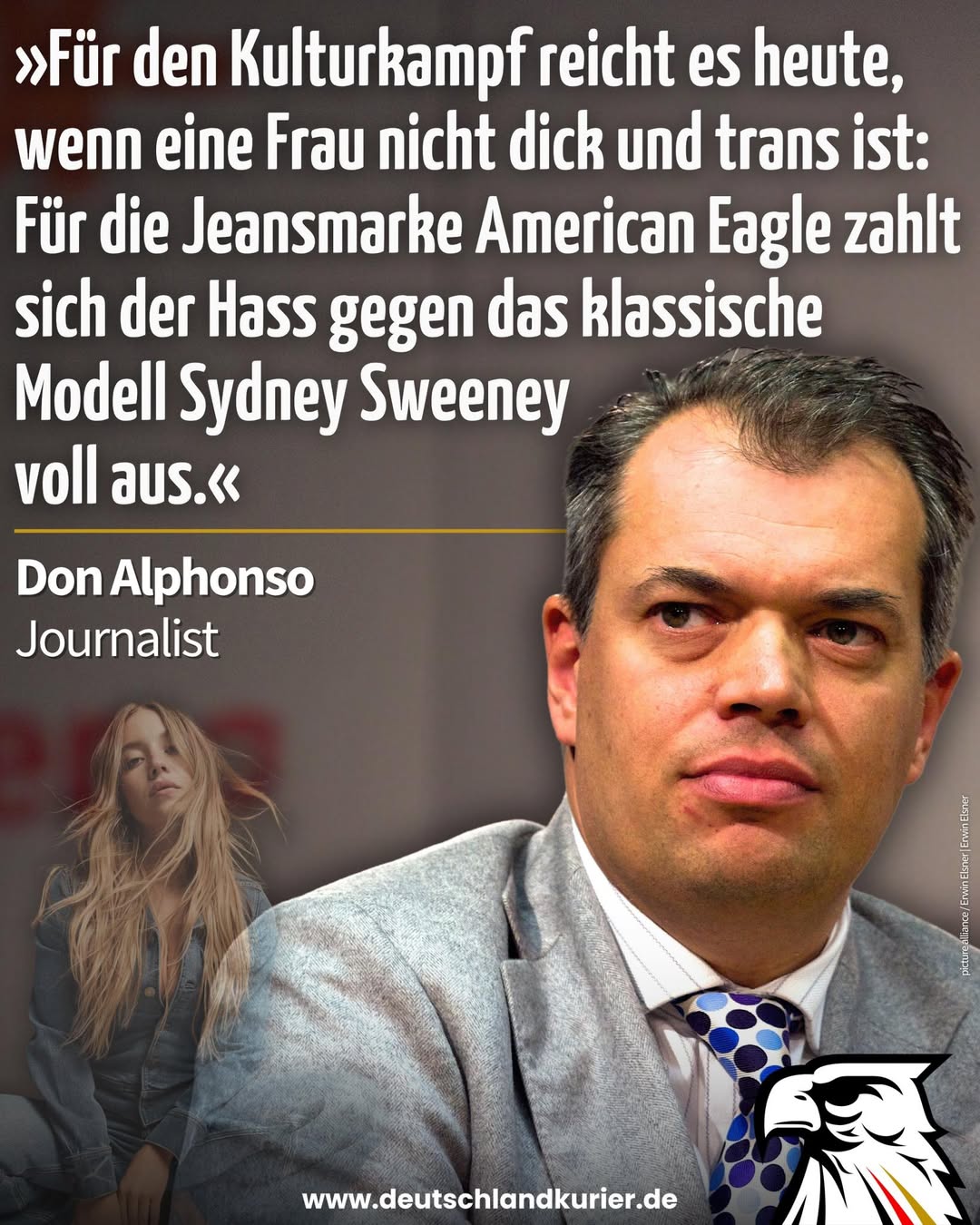


 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























