
Was passiert mit dem Geld für das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“? Gibt es in fünf Jahren keine maroden Brücken mehr? Sind die Krankenhäuser in gutem Zustand? NIUS-Kolumnist Markus Brandstetter wirft einen Blick auf die Zahlen im Haushalt – und glaubt nicht an die Versprechungen der CDU.
Bei der CDU setzt man die Tradition der Brüder Grimm fort und erzählt gerne Märchen. Natürlich keine Märchen, in denen Könige, Prinzessinnen und Hexen vorkommen, sondern solche – die CDU ist ja hochmodern –, in denen es um Wirtschaft, Wachstum und eine wunderbare Zukunft geht. So hat Helmut Kohl am 1. Juli 1990 im thüringischen Suhl den Menschen das Märchen von den blühenden Landschaften erzählt, die bald überall in Deutschland wieder entstehen werden – elysische Gefilde, auf die viele bis heute warten.
Helmut Kohl 1990 in Suhl
Angela Merkel hat 15 Jahre lang das Märchen von niedrigen Strompreisen, grüner Energie und braven Einwanderern erzählt, deren Integration wir auf jeden Fall schaffen. Und die Merz-CDU erzählt seit Mai das Märchen von Rekordinvestitionen, durch die Schulen und Kitas, Bahnstrecken und Straßen, Forschung und Digitalisierung im ganzen Land so richtig aufblühen sollen und ganz nebenbei auch noch klimaneutral werden. Wir leben also, glauben wir der CDU, zur besten Zeit im besten aller Länder. Oder etwa nicht?
Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel posierte 2015 in einer Erstaufnahmeeinrichtung mit einem Flüchtling. Das Foto ging viral.
Noch nicht ganz. Das ist auch den anonymen Werbepoeten des Bundeskanzleramtes aufgefallen, die in einem Anfall von Ehrlichkeit eingestehen:
„Kaputte Straßen, marode Brücken, zu langsames Internet: In vielen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur sind deutliche Mängel offensichtlich. Da die Investitionen im letzten Jahrzehnt gering ausgefallen sind, muss Deutschland nun aufholen. Ziel ist es, das Land zu modernisieren, den Wohlstand zu sichern und mit mehr Wachstum die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken. Mit den dringend notwendigen Investitionen werden künftige Generationen entlastet, denn sie können auf eine intakte und modernisierte Infrastruktur setzen.“
Hinter dieser gepflegten Politprosa versteckt sich das altbekannteste Muster so vieler Politikersprüche: Ja, im Moment läuft es nicht so gut, aber bald, sehr bald schon wird alles viel besser werden – und wir wissen, wie das geht.
Schauen wir uns einmal an, wann, wo und wie die neuen blühenden Landschaften entstehen und wer das Ganze bezahlt. Wir beginnen mit dem Geld.
Das Geld für unsere wunderbare Zukunft – in Summe 500 Milliarden Euro – stammt aus einem Sondervermögen. Das ist in unserem CDU-Märchen schon die erste Zauberei beziehungsweise der erste Schwindel: Der Ausdruck „Sondervermögen“ ist nämlich ein Widerspruch in sich. Denn: „Vermögen“ bezeichnet immer Geld oder Anlagegüter, die bereits vorhanden oder bezahlt sind. Aber das Sondervermögen, mit dem jetzt 30 Jahre Verfall, Rückschritt und Stillstand aufgeholt werden sollen, ist gar kein Vermögen, sondern ein riesiger Kredit des Bundes – ein Kredit noch dazu, der ganz bewusst so gestaltet wurde, dass er die Schuldenbremse im Grundgesetz umgeht. Deshalb musste das Sondervermögen im März dieses Jahres mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag beschlossen und das Grundgesetz (Art. 143h GG) dafür extra geändert werden.
Lars Klingbeil und Friedrich Merz am 13. März im Bundestag abseits einer Sondersitzung zur Änderung des Grundgesetzes
Was soll jetzt mit diesem Geld passieren?
Die Gesamtsumme soll über zwölf Jahre ausgegeben werden (also bis 2037), wovon 300 Milliarden an den Bund, 100 Milliarden an Länder und Kommunen und die restlichen 100 Milliarden in Infrastruktur- und Klimainvestitionen gehen. (Die 100 Milliarden Euro Klimainvestitionen waren übrigens die Bedingung für die Zustimmung der Grünen zur Grundgesetzänderung.) Diese grobe Verteilung, die bislang durch die Presse geistert, sagt nichts darüber aus, was mit den Mitteln zukünftig passiert und ob sie sinnvoll eingesetzt werden. Bis dato präsentiert sich das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität als ein großer, obskurer Topf, aus dem über viele Jahre hinweg riesige Summen abfließen sollen – nur weiß keiner genau, wohin und was mit denen dann genau geschieht.
Was also sind all diese zukunftsträchtigen Projekte, die damit finanziert werden? Werden sie jemals umgesetzt? Und was bringen sie uns dann eigentlich?
Wer (wie ich) am Wochenende nichts Besseres zu tun hat, als den Entwurf des Haushaltsgesetzes 2025 durchzulesen, der sieht hier auf dünn bedruckten 48 Seiten zum ersten Mal einige konkrete Zwecke, für welche die aus fiskalischer Luft geschöpften Milliarden eingesetzt werden sollen. Hier eine Auswahl:
In Summe sollen also noch in diesem Jahr 37,2 Milliarden Euro in die Ertüchtigung der Infrastruktur fließen, 2026 sollen es dann rund 21,3 Milliarden Euro sein, 2027 20,9 Milliarden Euro, 2028 20,9 Milliarden Euro und 2029 18,7 Milliarden Euro. Das ergibt in toto rund 120 Milliarden Euro – was nicht einmal die Hälfte der geplanten 300 Milliarden Euro ist.
All das verheißt nichts Gutes. Das fängt schon mit den Plänen für 2025 an. Dass in diesem Jahr noch 37,2 Milliarden Euro in die Modernisierung der Infrastruktur fließen sollen, ist schlichtweg nicht zu glauben. Wann wäre das genau und in welche Projekte, die dann wann genau fertig werden sollen? Und auch in den kommenden Jahren geht es weder besser noch konkreter weiter. Die Milliardenbeträge stehen zwar auf dem Papier, aber viele Programme sind noch nicht einmal mit greifbaren Vorhaben oder fassbaren Umsetzungsplänen hinterlegt. Teilweise gibt es nur Titel (z. B. „Digitalpakt 2.0“, „klimafreundlicher Neubau“) – ohne Förderrichtlinien, ohne Projektlisten, ohne Zeitrahmen. Das bedeutet: Kein Mensch weiß heute, was wann wo genau gebaut, modernisiert oder gefördert werden soll.
Die sogenannten „Verpflichtungsermächtigungen“ (ein Wort, von dem es im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2025 nur so wimmelt) bedeuten lediglich: Der Bundestag erlaubt der Bundesregierung (bzw. einer Behörde), bereits heute Verträge einzugehen, aus denen in künftigen Haushaltsjahren Zahlungsverpflichtungen entstehen – auch wenn für diese Jahre noch kein Haushalt beschlossen wurde. In der Praxis heißt das: Das Geld kann irgendwann ausgegeben werden – muss aber nicht. Die Verteilung auf Einzelprojekte, Regionen, Zuständigkeiten oder Zeitachsen ist völlig offen. Gerade bei langfristigen Summen (bis 2035 oder länger) fehlt jede belastbare Aussage zur praktischen Umsetzung.
Um Merz' wunderbare Investitionsoffensive einschätzen zu können, betrachten wir jetzt die Situation bei den Brücken. Mehr als 10.000 der rund 40.000 Brücken, die Autobahnen und Bundesstraßen überspannen, sind marode und müssen dringend saniert werden. Dafür stehen in diesem Jahr zweieinhalb Milliarden Euro zur Verfügung. Wie weit reicht jetzt dieses Geld? Wie viele der 10.000 kaputten Brücken können mit den Mitteln aus dem Jahr 2025 saniert werden? Antwort: Fünf große und etwa zwanzig mittlere.
Die Rahmede-Autobahnbrücke im Sauerland wird saniert.
Wie komme ich auf diese Zahl? Ganz einfach: Die Sanierung fünf großer und bekannter Brücken während der letzten Jahre – Leverkusener Rheinbrücke (500 Millionen Euro), Salzbachtalbrücke Wiesbaden (200 Millionen Euro), Talbrücke Rinsdorf (36 Millionen Euro), Rahmede-Talbrücke Lüdenscheid (275 Millionen Euro), Hochstraße Süd Ludwigshafen (500 Millionen Euro) – hat in Summe 1,511 Milliarden Euro verschlungen. Ziehen wir diesen Betrag von den in diesem Jahr zur Verfügung stehenden 2,5 Milliarden Euro ab, dann bleiben noch 989 Millionen Euro übrig. Mit denen ließen sich dann exakt 19 Brücken mittlerer Größe sanieren – wie beispielsweise die Talbrücke Eisern an der A45 in NRW, deren Sanierung 44 Millionen Euro kostete und die damit exemplarisch für diese Größenordnung steht.
Rechnen wir abschließend hoch, wie viele Brücken mit den bislang eingeplanten 9 Milliarden Euro bis 2032 saniert werden können, dann ergibt sich: Selbst bei einem realistischen Mix aus großen und mittleren Brücken – also etwa sieben große Brücken (à ca. 250 Millionen Euro) und 288 mittlere Bauwerke (à ca. 25 Millionen Euro) – lassen sich mit dem Sondervermögen nur rund 295 von über 10.000 maroden Brücken sanieren. Das sind weniger als drei Prozent – der Rest bleibt gesperrt, einsturzgefährdet oder dem Verschleiß überlassen. Und das ist bereits eine optimistische Rechnung, denn die Kosten für die Brückensanierung steigen jedes Jahr um fünf bis acht Prozent. Allein von 2020 bis 2023 sind die Preise für Brücken- und Ingenieurbauten um rund 25 Prozent gestiegen – Tendenz weiter steigend.
Ganz egal also, wie wir rechnen: Weder bei den Brücken noch bei der Bahn oder bei den Breitbandnetzen, weder bei der Digitalisierung noch bei den Krankenhäusern werden die ausgelobten 300 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren viel bewirken. Und obwohl Geld auch hier das größte Problem darstellt, ist es bei Weitem nicht das einzige. Denn alle größeren Projekte in Deutschland werden durch einen immer dichter werdenden Dschungel von Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlassen und technischen Regeln entweder gleich ganz verhindert oder aber auf Jahre hinaus erschwert, verzögert und verteuert.
Der größte Feind von Modernisierung und Fortschritt sind längst Ämter, Behörden und Bürokraten – und damit der Staat selbst.
Auf der systemischen Ebene, also ganz oben, sind selbstverständlich der Bundestag, die Minister und ihre Ministerien für Deutschlands marode Infrastruktur verantwortlich, wobei die Hauptschuldigen im Verkehrsministerium, im Bauministerium und im Umweltministerium sitzen und in den Bau- und Verkehrsministerien der Länder. Aber Regierungen, Mehrheiten und Minister kommen und gehen – und trotzdem wird nie etwas besser. Woran liegt das?
Der Grund dafür liegt auf der administrativen Ebene und ihren Schreibtischtätern, denen die große Politik herzlich egal ist – solange sie nur bei den täglichen Verwaltungsentscheidungen ihren beschränkten Horizont hartnäckig und stur durchsetzen können. Verantwortlich für den flächendeckenden Sanierungsstau in Deutschland sind deshalb die Referatsleiter im Bundesbauministerium, die Abteilungsleiter für Straßenbau in den Landesverkehrsministerien, die Prüfingenieure der Bauaufsichtsbehörden, die Sachbearbeiter der Naturschutzbehörden und die Leiter des technisches Gebäudemanagements in kommunalen Bauämtern.
Diese Zauderer, Zögerer und Verhinderer, von denen es in Deutschland 15.000 gibt, sind 50 bis 60 Jahre alt, meist männlich (außer in den Naturschutzbehörden – da sind die Frauen unter sich), haben in der Regel studiert und ihr ganzes Arbeitsleben in Ministerien, Ämtern und Behörden verbracht. Vom Charakter her sind sie konfliktscheu, sicherheitsbedürftig, regelorientiert, fantasielos und langweilig. Fortschritt, Verantwortung und Innovation sind ihnen ein Graus, Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand sind ihnen egal (denn ihr Geld kommt ja vom Staat) und Zuversicht und Optimismus ihrem Wesen fremd. Ihr Wahlspruch lautet: Was wir nicht genehmigen, kann nicht schiefgehen.
Diese 15.000 Schmalspurdenker, die für die freie Wirtschaft nicht gut genug waren, deren dürftige Talente in Ämtern und Behörden aber blühen und gedeihen, sind die Hauptverantwortlichen dafür, dass Deutschlands Infrastruktur verrottet und verfällt, unser Wohlstand schwindet, die Deutsche Bahn im Ausland als ein Witz gilt und das deutsche Breitbandnetz ein Trauerspiel darstellt.
Diese Behördenschranzen sind dafür verantwortlich, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg erst nach einer Verzögerung von zehn Jahren und Mehrkosten von sieben Milliarden Euro eröffnet werden konnte, weil die Genehmigung der Brandschutzanlage über Jahre hinweg hartnäckig verweigert wurde. Diese Paragrafenreiter sind schuld daran, dass beim Bau des neuen Stuttgarter Bahnhofs Tausende von Mauereidechsen teuer umgesiedelt werden mussten, was die erforderlichen Baugenehmigungen um Jahre verzögerte und zu Milliardenkosten führte. Diese Nachtwächternaturen haben beim Lückenschluss der A 14 zwischen Magdeburg und Schwerin durch nachträgliche Naturschutzauflagen, etwa zum Schutz der Feldlerche, ein einwendungsfreies Verfahren, das bereits 2013 gestartet wurde, jahrelang verschleppt. Der Abschnitt sollte längst fertig sein, doch durch immer neue Prüfungen, Planergänzungen und artenschutzrechtliche Gutachten verzögert sich der Bau nun bis mindestens 2030.
Aber selbst wenn es die neue, langersehnte Brücke, die jetzt mit den Milliarden aus Merz’ neuem Füllhorn gebaut werden soll, nach Jahren durch das Planungsfeststellungsverfahren geschafft hat (und somit von den Behörden genehmigt ist), heißt das noch lange nicht, dass jetzt gebaut werden kann – denn betroffene Bürger und die immer gleichen Umweltverbände haben längst Klage dagegen erhoben. Kein Autobahnteilstück, keine Großbrücke, keine Bahnstrecke und kein Kraftwerk kann in Deutschland gebaut werden, ohne dass nicht die üblichen Verdächtigen alles in Grund und Boden klagen. Hier sind sie:
Diese Verbände tragen nach unserer byzantinischen Bürokratie Mitverantwortung dafür, dass sich in Deutschland schon lange nichts mehr bewegt, die Infrastruktur verkommt, die Wirtschaft leidet und unser Wohlstand schwindet.
Hier sind drei aufschlussreiche Beispiele dafür, was passiert, wenn selbsternannte Umweltschützer und dauerbetroffene Bürgerinitiativen so richtig zur Sache gehen: Die Rheinbrücke Karlsruhe-Maxau (Verzögerung: ca. 5,5 Jahre infolge einer Umweltklage des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Mehrkosten: geschätzt 50 bis 80 Millionen Euro durch Planung, Umleitungen und Zeitverlust), die Gauchachtalbrücke bei Döggingen im Schwarzwald (Verzögerung: ca. 3 bis 4 Jahre aufgrund einer Klage des Verkehrsclubs Deutschland gegen den Planfeststellungsbeschluss, Mehrkosten: mindestens 20 bis 30 Millionen Euro durch Nachplanungen, Inflation und Baupreisanstieg) und die Hochmoselbrücke bei Ürzig (Verzögerung: ca. 20 Jahre durch langjährigen politischen Widerstand unter starkem Einfluss von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, Mehrkosten: über 150 Millionen Euro gegenüber ursprünglicher Planung).
Mit diesem Wissen im Hinterkopf werfen wir jetzt nochmals einen Blick auf die von Kanzler Merz groß angekündigte Investitionsoffensive für das ganze Land und fragen: Was davon ist harte Realität – und was nur heiße, politische Luft?
Meine Antwort darauf lautet: Dieses Verhältnis lässt sich anhand der bekannten Pareto-Verteilung abschätzen. Die Pareto-Verteilung (benannt nach dem italienischen Volkswirt und Mathematiker Vilfredo Pareto) ist die bekannte 80/20-Regel, die aus der Beobachtung resultiert, dass auf vielen Gebieten 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent Einsatz erreicht werden, zum Beispiel, dass bei einem Unternehmen 80 Prozent des Umsatzes von 20 Prozent der Kunden kommen. Wenden wir die Pareto-Regel auf Merz’ Infrastrukturinitiative an, dann werden nach meiner Schätzung mit 80 Prozent der Mittel des Sondervermögens 20 Prozent der versprochenen Projekte umgesetzt. Der Rest fällt flach – obwohl das Geld weg ist.
Sind die zwölf Jahre rum, das Jahr 2036 ins Land gegangen und die 500 Milliarden Euro ausgegeben und verbraucht, dann werden wir weder viele sanierte Brücken noch pünktliche Züge noch frisch geteerte Autobahnen noch schnelles Internet bis ins letzte Dorf haben – sondern eine Menge halbfertiger Projekte, die viel mehr gekostet haben als geplant und viel länger dauerten. Wachstum und Wohlstand jedoch werden nicht größer sein als heute.
Aber das sollte niemanden überraschen – denn nicht alle Märchen haben ein Happy End. Am wenigsten die der CDU.




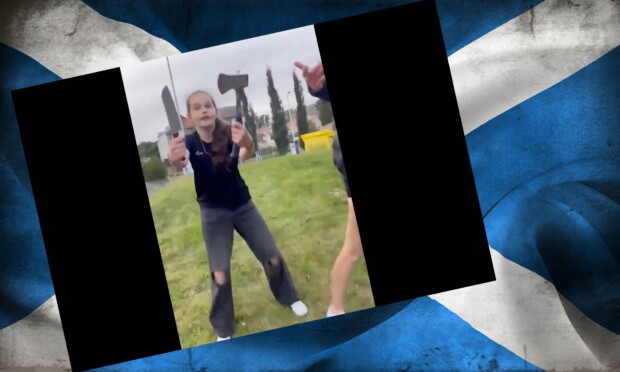

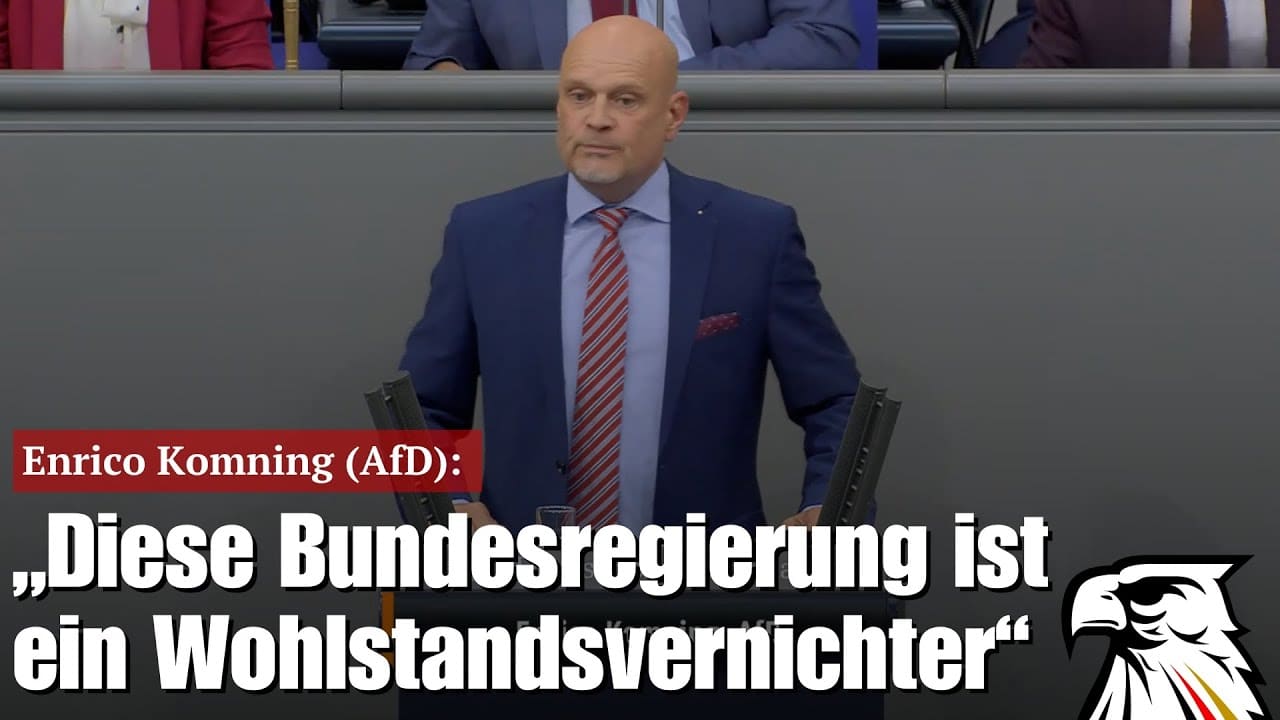


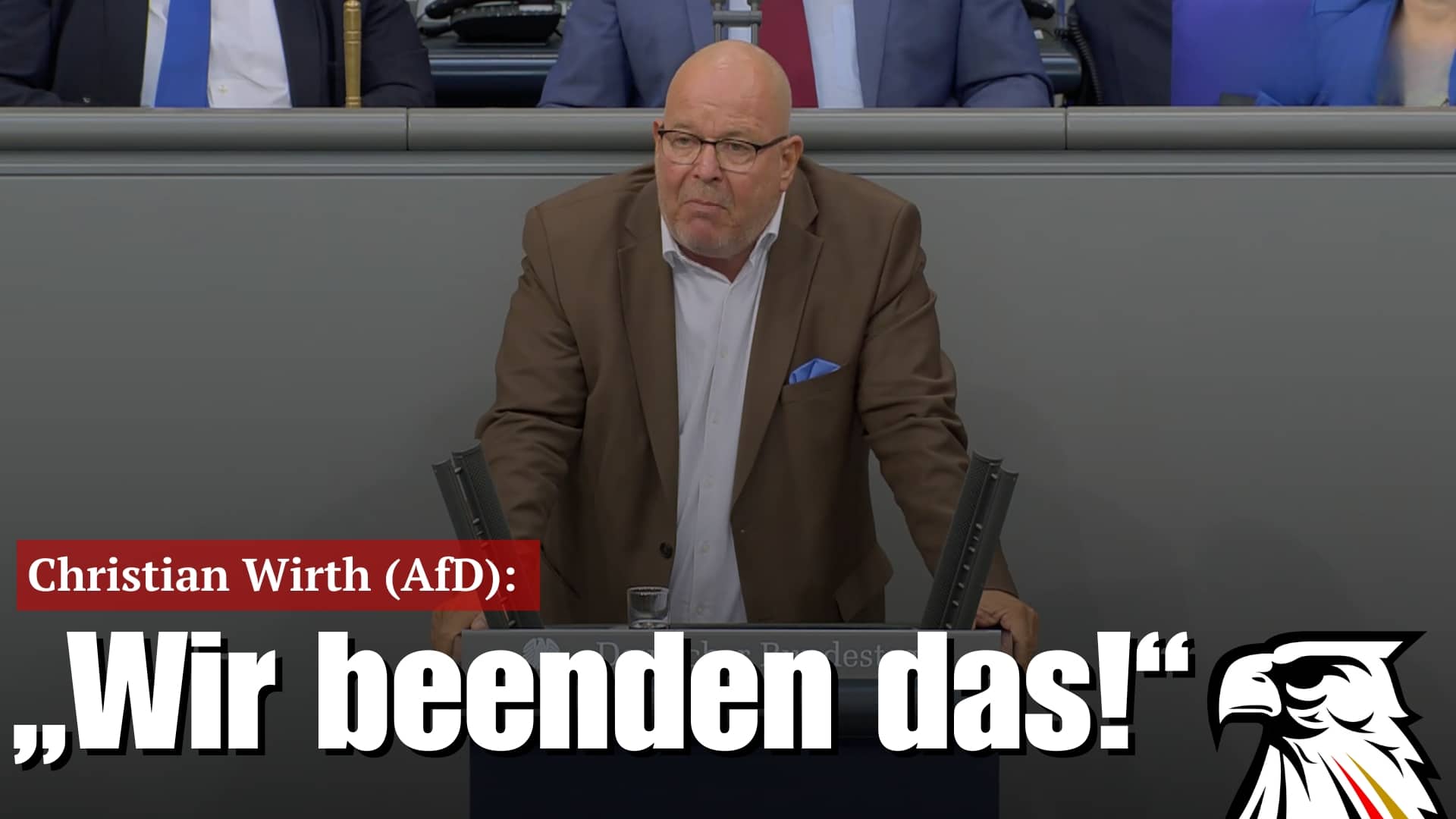
 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























