
Die Diskussion über die staatliche Förderung von Medien in Deutschland hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. War es lange Zeit ein Tabu, private Medien direkt mit öffentlichen Geldern zu unterstützen – nicht zuletzt aufgrund des verfassungsmäßig verankerten Prinzips der Staatsferne der Medien –, so hat sich die Debatte in den letzten Jahren verschoben. Ein Wendepunkt war 2020, als das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der Corona-Hilfen 220 Millionen Euro zur Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens bereitstellen wollte. Letztlich scheiterte der umstrittene Vorstoß aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken.
Nun sorgt ein Vorschlag der SPD für Unruhe. Während der Koalitionsverhandlungen drängt die Partei darauf, einen staatlichen Innovationsfonds zu schaffen, um „vertrauenswürdige Medien“ zu fördern, wie Table.Media berichtet. Damit sollen ausgewählte Medienhäuser bei der Transformation ins digitale Zeitalter unterstützt werden. Nachdem die Unionsvertreter das Vorhaben in der Arbeitsgruppe abgelehnt haben, könnte es nun in der Chefrunde der Parteivorsitzenden diskutiert werden.
Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm konkrete Pläne zur Medienförderung formuliert. „Private Medienunternehmen sind eine wichtige zweite Säule und sollen durch gute regulatorische und ordnungspolitische Rahmenbedingungen unterstützt werden“, heißt es darin. Der Staat könne beispielsweise die „wirksame Moderation von Plattformen einfordern“ und auch „unabhängige Medien fördern, die unter anderem auch Faktenchecks durchführen“. Genau dafür könnte ein Medieninnovationsfonds genutzt werden. Die Partei schreibt: „Wir wollen, dass man sich auf Fakten in den Nachrichten verlassen kann.“ Dahingehend wird vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk als vertrauenswürdiger Akteur genannt.
Doch diese Vorschläge werfen zentrale Fragen auf: Was bedeutet „vertrauenswürdig“? Wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien? Bei einer solchen Förderung, die im Übrigen auch dem „Kampf gegen Desinformation“ dienen soll, dürfe „kein Gefühl von staatlicher Zensur aufkommen“, heißt es im Wahlprogramm lediglich. Wie eine solche Förderung ohne politische Einflussnahme gewährleistet werden kann, bleibt unklar. Klar ist nur: Die SPD möchte, dass der Staat aktiv in die Medienlandschaft eingreift, und zwar nicht nur durch Regulierung, sondern durch direkte Finanzierungsmaßnahmen.
Ein Blick auf Österreich zeigt, wie staatliche Medienförderung praktisch aussehen kann. Im Nachbarland ist die Abhängigkeit von staatlicher Presseförderung zur Realität geworden – ohne diese Unterstützung wären viele private Anbieter wahrscheinlich nicht überlebensfähig. Bereits 1975 führte Österreich eine direkte Presseförderung ein, die bis heute einzigartig in Europa ist. Diese Förderung umfasst sowohl finanzielle Zuschüsse als auch indirekte Maßnahmen wie die Vergabe von Inseraten durch öffentliche Behörden und Ministerien.
In der Vergangenheit kam es in Österreich wiederholt zu Missbrauchsfällen. So sollen ab 2016 unter der Regierung von Sebastian Kurz und der ÖVP Budgetmittel des Finanzministeriums rechtswidrig verwendet worden sein, um gefälschte Meinungsumfragen zu finanzieren und mit positiver Berichterstattung in der Mediengruppe Österreich zu verknüpfen. Ziel war offenbar, Kurz‘ Aufstieg zum Kanzler zu unterstützen. Auch die Stadt Wien, regiert von der SPÖ, wurde für hohe Ausgaben für Inserate kritisiert. Sie zählt zu den größten Werbekunden in österreichischen Medien.
Auch die FPÖ zeigte fragwürdige Praktiken. Während ihrer Regierungsbeteiligung zahlten FPÖ-geführte Ministerien insgesamt über 100.000 Euro an Steuergeldern für Inserate in parteinahen Medien. Der aktuelle Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp drohte nach einer Recherche der Tageszeitung Der Standard jüngst öffentlich, deren Presseförderung zu streichen. Er schrieb auf X: „5 gute Jahre, wenn es mit diesem ‚Scheißblatt‘ endlich vorbei ist.“
Die politische Einflussnahme durch staatliche Inserate ist in Österreich nicht auf Bundesebene beschränkt, sondern auch auf kommunaler Ebene verbreitet. Der Einfluss auf die Arbeit in den Redaktionen, insbesondere im Boulevardbereich, ist enorm.
Die Abkehr vom marktwirtschaftlichen Prinzip im Journalismus birgt erhebliche Risiken. Wenn Medien nicht mehr den Lesern verpflichtet sind, sondern dem Staat – vertreten durch eine Regierung –, entsteht eine gefährliche Abhängigkeit. Die Regierung könnte definieren, welche Inhalte als „qualitativ hochwertig“ gelten und entsprechend gefördert werden.



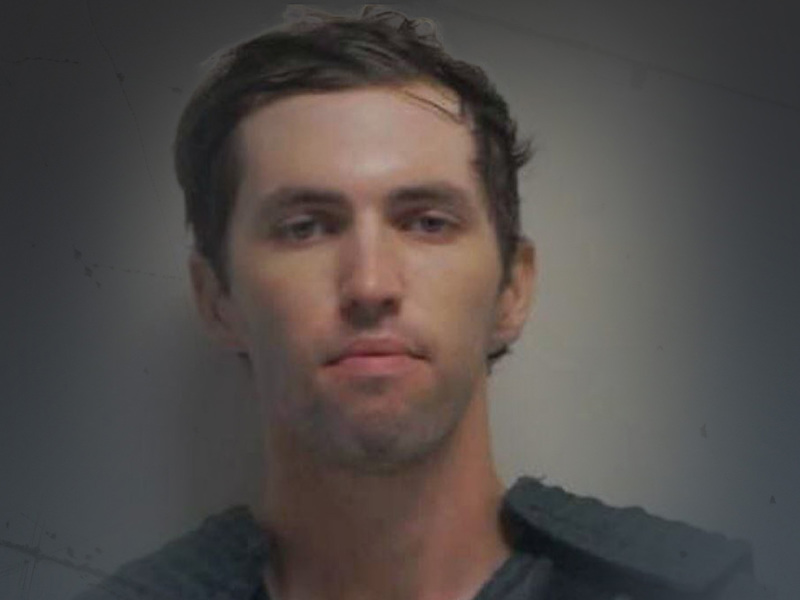






 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























