
Die wirtschaftspolitischen Forderungen und Ziele von Olaf Scholz und auch die von Wirtschaftsminister Robert Habeck scheinen aus einer anderen Realität zu kommen. Ökonomen und Unternehmen und auch zunehmend Arbeitnehmervertreter, die den Verlust von Arbeitsplätzen mittlerweile auch nicht mehr schönreden können, schütteln den Kopf. Dabei berufen sich die Vertreter der rot-grünen Regierung auf verschiedene „Missionen“ und sogar auf eine eigene Theorie und Methode.
Im anlaufenden Wahlkampf überbieten sich Noch-Bundeskanzler Scholz und Noch-Wirtschaftsminister Habeck mit Forderungen nach Subventionen, Investitionen, Fonds und sogar mit Ideen, bei welchen Unternehmen der Staat so alles einsteigen könnte. Bundeskanzler Scholz schloss kürzlich einen Einstieg des Staates bei dem taumelnden Stahlunternehmen ThyssenKrupp nicht aus. Er nehme jetzt keine Option vom Tisch sagte er. Solche Beteiligungen hätte es immer wieder gegeben, zuletzt bei der Meyer Werft in Papenburg, aber auch bei Energieunternehmen oder während der Corona-Pandemie bei der Lufthansa, ließ Scholz verlauten.
ThyssenKrupp hat massive Probleme mit seiner Stahlproduktion in Deutschland. Grund dafür sind extrem hohe Kosten wegen hoher Energiepreise in Deutschland. Die Stahlproduktion ist wie jede Schwerindustrie energieintensiv. Hinzu kommen noch umfangreiche Auflagen und Vorschriften für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die das Unternehmen erfüllen muss. Und diese Vorschriften kommen von der deutschen Regierung und auch von der Europäischen Union mit ihrem „Green Deal“. Als ob das noch nicht genug wäre, soll ThyssenKrupp jetzt auch noch den Umstieg auf eine CO2 freie Stahlproduktion mittels Wasserstoff und 100 Prozent erneuerbaren Energien hinkriegen. Das verschlingt enorme Summen für Investitionen und verteuert dann auch im laufenden Betrieb die Stahlproduktion.
Es sind also die Rahmenbedingungen und vor allen Dingen die Vorgaben und die gesetzlichen Auflagen des Staates, die ThyssenKrupp in diese missliche Lage bringen und sogar existenzgefährdend sind. Und nun kommt der Kanzler eben derjenigen Bundesregierung, die zusammen mit der EU-Kommission alle diese Vorschriften zu verantworten hat und will mit Staatsgeld bei dem Konzern einsteigen, um ihn zu „retten“.
Das wäre so, als wenn ein Arzt einem gesunden Patienten mit Absicht schädliche Medikamente verschreibt, nur um sich dann öffentlichkeitswirksam als der Rettungssanitäter aufspielen zu können.
Sozialdemokrat Olaf Scholz setzt auf staatliche Subventionen, um Firmen vor der staatlich verschuldeten Krise zu bewahren.
Das ist aber nur ein Beispiel von vielen. Denn Kanzler Scholz will noch mehr Unternehmen und Branchen retten. Dafür soll es einen Industriestrompreis geben, in dem die Netzentgelte für die Übertragung von Energie gedeckelt werden. Das soll die Kosten für Unternehmen angeblich in einem erträglichen Rahmen halten. Die Zeche für diese faktische Subvention zahlen dann wir alle als Steuerzahler, die wir ebenfalls seit Jahren unter hohen Energie- und Treibstoffpreisen leiden.
Auch die deutschen Autohersteller, die unter mehr oder weniger den gleichen Problemen wie die Stahlindustrie leiden, müssen natürlich gerettet werden. Denn so langsam wird es auch für den Sozialdemokraten heikel, weil tausendfach Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Hierzu verkündet der Kanzler im Interview mit der Funke Mediengruppe: „Ich bin dagegen, dass Beschäftigte entlassen werden sollen, nur um Geld zu sparen.“ Jeder normal denkende Mensch mit etwas wirtschaftlichem Sachverstand fragt sich hier natürlich, warum denn sonst Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, wenn nicht um Kosten zu sparen. Der Kanzler fragt sich das nicht. Und damit ist er auf dem gleichen ökonomischen Niveau wie sein Wirtschaftsminister, der ja auch behauptete, eine Insolvenz sei nicht schlimm, denn Unternehmen müssten ja einfach nur aufhören zu produzieren ...
Für diese ganzen Rettungs- und Subventionsorgien stellt sich der Kanzler einen neuen großen Deutschlandfonds vor, der mit 100 Milliarden Euro ausgestattet werden soll. Woher das Geld kommt ist unklar, aber es gehört nicht viel Fantasie dazu, darauf zu kommen, dass das sicherlich über neue Schulden finanziert werden soll. Unterstützt wird er dabei tatkräftig von seiner Parteivorsitzenden, SPD-Chefin Saskia Esken, die ebenfalls kostengünstige Energie und Milliardeninvestitionen für die Modernisierung in einem Interview mit der neuen Osnabrücker Zeitung einforderte.
Von vielen Seiten wird den führenden Köpfen der verbliebenen rot-grünen Restregierung Realitätsverlust unterstellt. Dafür gibt es auch mehr als genug Anzeichen. Allerdings ist hier ein Spruch aus Shakespeares Hamlet angebracht: „Ist’s Wahnsinn auch, so hat es doch Methode.“
Denn Habeck, Scholz und Co. folgen einer ganz besonderen Lehre einer italienischen Wissenschaftlerin, die sie konsequent umsetzen, wie das typisch ist für linksideologische Heilsversprechen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Denn zum Glück ist man ja nicht nur moralisch auf der richtigen Seite, sondern angeblich auch wissenschaftlich auf fundiertem Terrain. Auch wenn die Realität in Deutschland zeigt, dass die Ideologie zu Deindustrialisierung, Abstieg, Verlust und Niedergang führt. Die Rede ist hier von der Ideologie der Mariana Mazzucato, sozusagen die Säulenheilige der grün-ökologisch-sozialen neuen Planwirtschaft.
Mazzucato argumentiert in ihren Theorien, dass der Staat eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Innovationen spielt, die oft als privatwirtschaftliche Errungenschaften betrachtet werden. Sie kritisiert die vorherrschende Ansicht, dass Innovation hauptsächlich aus dem Privatsektor stammt. Stattdessen betont sie, dass staatliche Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) entscheidend sind für den Fortschritt in vielen Schlüsselindustrien, einschließlich der Technologie- und Gesundheitsbranche. Der Staat sei also der bessere Erfinder und auch der bessere Unternehmer. In ihren Veröffentlichungen, darunter das einflussreiche Buch „The Entrepreneurial State“ (Der unternehmerische Staat) von 2013, führt sie für ihre Thesen viele angebliche Beispiele an. Als ein Beispiel gilt für sie, wie öffentliche Institutionen wie die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) in den USA maßgeblich zur Entwicklung der Internet-Technologie beigetragen haben, die später von privaten Unternehmen kommerzialisiert wurden.
Mazzucato fordert daher eine Neubewertung der Rolle des Staates als aktiver Innovator und nicht nur als Regulierer oder Unterstützer des Marktes.
Mariana Mazzucato beim World Economic Forum
Mazzucato kombiniert die Lehren von älteren Ökonomen wie Johannes Schumpeter und John Maynard Keynes, der eine starke antizyklische Wirtschafts- und Finanzpolitik des Staates propagierte und argumentiert für staatliche Intervention und Investitionen in Innovationssysteme. Besonders die Staaten des Westens mit den entwickelten und technologisierten Volkswirtschaften sollten diese Zentralität des Staates anerkennen, weil nur aus erfolgreichen Innovationen das Wachstum und der Wohlstand der Zukunft entstehen kann. Genauso wie Entwicklungsländer erfolgreich planen könnten, um zu westlichen Nationen aufzuschließen, könne auch jeder Staat die Entwicklung von technologischen Lösungen und die Förderung von praktischem Wissen in einem bestimmten Sektor vorantreiben, indem er einfach eine vernetzte Wirtschaft dazu anregt, sich an vielfältigen Innovationen zu beteiligen. Anders als in einer sich entwickelnden Wirtschaft, in der die Technologie bereits anderswo in der Welt verfügbar ist, kennt ein unternehmerischer Staat noch nicht die Details der Innovation, aber er kennt einen allgemeinen Bereich, der reif für die Entwicklung ist, oder in dem eine Überschreitung der Grenzen des Wissens wünschenswert ist. Der Staat habe hier also eine unternehmerische Aufgabe zu erfüllen.
Mazzucato schlägt daher vor, die Gleichgewichte von Risiken und Gewinnen zu ändern. Erstens sollte der Staat Lizenzgebühren aus der Anwendung von staatlich finanzierten technologischen Durchbrüchen erhalten und die Erträge aus diesen Lizenzgebühren sollten in einen „nationalen Innovationsfonds“ einzahlen. Zweitens sollte der Staat Kredite und Zuschüsse an Bedingungen knüpfen, wie zum Beispiel die Rückzahlung eines Teils der Gewinne, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten und der Staat sollte sich an den Unternehmen, die er unterstützt, beteiligen.
Wenn Olaf Scholz die Möglichkeit einer Staatsbeteiligung an ThyssenKrupp ankündigt, dann spielt er genau dieses Spiel.
In ihrem Buch „Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism“ (2021) formuliert Mazzucato ihre Vision für eine neue Art der Wirtschaftspolitik, die sich an großen gesellschaftlichen Herausforderungen orientiert. Sie schlägt vor, dass Regierungen „Missionen“ definieren sollten, um gezielt Innovationen zu fördern und gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Die SPD hat diese Missions-Marktwirtschaft in ihrem Programm schon offiziell übernommen. Im November 2022 hat sich die SPD vier Missionen gegeben:
Mit der dritten Mission wird die unkontrollierte Einwanderung gerechtfertigt. Mit der zweiten Mission wird die zunehmende Überwachung von Meinungsäußerungen und Kommunikation im Internet gerechtfertigt. Und mit der ersten Mission wird die zunehmende Staatswirtschaft und Regulierung gerechtfertigt. Die Grünen waren schon lange vor der SPD auf diesem Weg, ihre selbst definierten Missionen zu erfüllen. Und alle diese Politikansätze finden sich in den Lehren von Mazzucato wieder, die Olaf Scholz schon während seiner Zeit als Finanzminister in der Merkel-Regierung „beraten“ hat.
Der Staat hat laut Mazzucato die Fähigkeit, Risiken einzugehen, die private Unternehmen oft scheuen würden, da diese auf kurzfristige Gewinne fokussiert sind. Sie plädiert dafür, dass Regierungen proaktive Maßnahmen ergreifen sollten, um Innovationen gezielt zu fördern und gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen.
Mazzucato nennt verschiedene Bereiche, in denen solche „Missionen“ sinnvoll wären, darunter Klimawandel, Gesundheit und Bildung. Durch die Fokussierung auf konkrete Ziele könnten Ressourcen effizienter eingesetzt und Innovationen gezielt gefördert werden. Genau das ist der ideologische Überbau für alle Aussagen die wir aus der SPD und von den Grünen immer wieder hören. Bezeichnet wird das dann als Transformation. Egal, ob bei der Stahlproduktion in der Automobilwirtschaft oder bei der Energieversorgung: Die Bundesregierung treibt ihre „Missionen“ nach dem Vorbild von Mazzucato immer weiter voran, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Verluste werden viel mehr noch den Unternehmen in die Schuhe geschoben, die angeblich aus Gier oder wahlweise wegen unfähigem Management für die Misere verantwortlich seien und die Mission einfach nur noch nicht richtig verstanden und nicht richtig umgesetzt hätten.
VEB Barkas-Werk in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 1974: Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft haben in Deutschland Tradition – im Dritten Reich war es die Lenkwirtschaft, in der DDR die Zentrale Planwirtschaft und heute die Missions-Marktwirtschaft.
Mazzucato kritisiert auch immer wieder traditionelle Finanzierungsmodelle, die oft auf kurzfristige Renditen abzielten und langfristige Investitionen in Innovationen behindern würden. Stattdessen fordert sie neue Ansätze wie öffentlich-private Partnerschaften und sogenannte Impact-Investments, um notwendige Mittel zu mobilisieren. Mazzucato argumentiert auch dafür, Fonds einzurichten, die speziell für die Unterstützung von Missionen genutzt werden könnten. Diese Fonds sollten darauf abzielen, Risiken zu teilen und Investitionen in Bereiche zu lenken, die für das Gemeinwohl entscheidend sind.
Auch hier können wir wieder sehr gut sehen, wie Olaf Scholz seiner Prophetin folgt und, wie oben beschrieben, gleich noch einen neuen 100 Milliarden Euro schweren Deutschlandfonds ankündigt.
Mazzucato argumentiert, dass private Unternehmen durchaus eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Missionen spielen können, jedoch auch Verantwortung für soziale und ökologische Auswirkungen tragen müssen. Mazzucato betont die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und dem Privatsektor, um Synergien zu schaffen und Innovationen voranzutreiben. Das bedeutet im Klartext, dass Unternehmen lediglich dazu da sind, die missionarischen Vorgaben der Politik zu befolgen und diese zu „erfüllen“. Planerfüllung – das kommt sicherlich vielen bekannt vor. Aus der DDR zum Beispiel. Mazzucato kritisiert ganz offen die Meinung, dass Unternehmen allein für Innovation verantwortlich sind und hebt hervor, dass staatliche Unterstützung oft den Grundstein für unternehmerischen Erfolg legt. Unternehmen müssen also dankbar sein, dass der Staat sie gnädigerweise in die Erfüllung seiner Mission mit einbezieht. Durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung können Firmen nicht nur profitabel sein, sondern auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, so die Italienerin. Was verantwortungsvoll ist, definiert natürlich die Politik.
Vor dem Hintergrund dieser Missionsideologie, werden viele Forderungen und Ziele der rot-grünen „Transformationspolitik“ besser und klarer durchschaubar. Der Wahlkampf wird voll davon sein. Lebensgefährlich für den Standort Deutschland und dessen Zukunft sind und bleiben sie aber dennoch allemal. „Ist´s Wahnsinn auch, so hat es doch Methode.“
Mehr Wirtschafts-Mohring:Ausgerechnet bei Wirtschaftsfragen ignoriert die Regierung wissenschaftlichen Rat ... und gefährdet den Wohlstand!





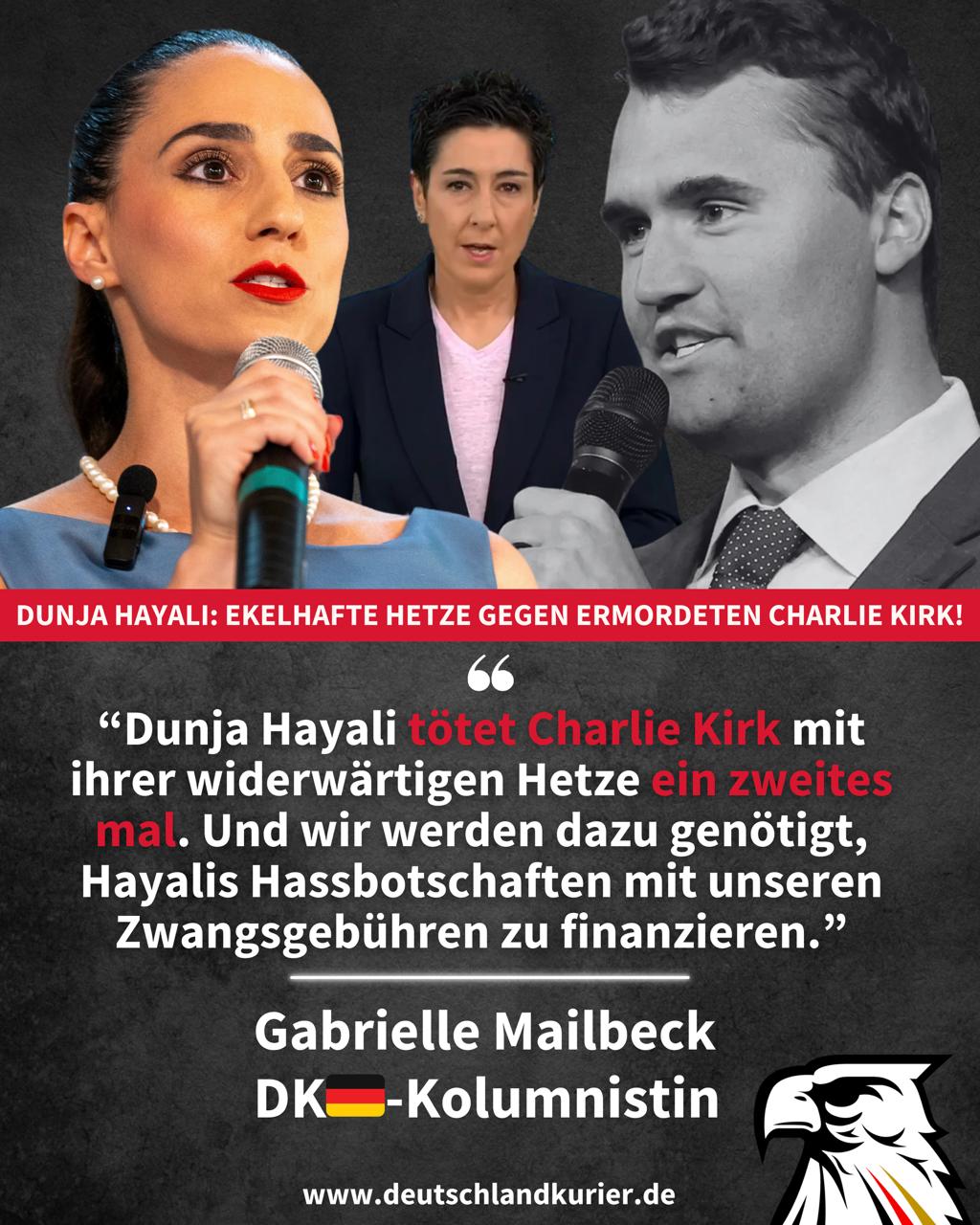




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























