
In der Nacht zum 11. August traf eine israelische Präzisionsrakete ein Zelt im Gazastreifen, das als provisorisches Pressequartier diente. Fünf Menschen starben bei dem Angriff, darunter mehrere, die offiziell als Journalisten geführt wurden.
International folgte der vorhersehbare Medienaufschrei: BBC, New York Times und andere sprachen unisono von einem „Angriff auf die Pressefreiheit“. Der katarische Sender Al Jazeera fabulierte von einer gezielten Ermordung seiner Mitarbeiter und einem Angriff auf die Pressefreiheit. Das Komitee zum Schutz der Journalisten (CPJ) verwies darauf, seit Beginn des Krieges seien weit über hundert Journalisten in Gaza ums Leben gekommen.
Die israelische Armee erklärte dagegen, Hauptziel sei Anas al-Sharif gewesen, ein Al-Jazeera-Korrespondent, der nach israelischen Unterlagen als Offizier innerhalb der Hamas agiert habe. Sie legte dazu Personallisten, interne Telefonbücher und Zahlungsnachweise als Belege vor. Nach Angaben des israelischen Militärs war al-Sharif nicht nur „irgendwie“ mit der Hamas verbunden – er führte eine Terrorzelle, plante Raketenangriffe, koordinierte operative Einsätze. Al Jazeera wiederum wies diese Vorwürfe zurück.
Der 28-jährige Anas Al-Sharif galt als „Stimme Gazas“, berühmt für Tränen vor der Kamera. So zeigte er beispielsweise im Juli dieses Jahres bei einer Live-Reportage eigene Betroffenheit, als die Verzweiflung der Menschen gezeigt wurde – der Moment, als eine Mutter vor Hunger kollabierte, bewegte ihn so stark, dass er kaum Worte finden konnte. Al-Sharif kamen die Tränen, als eine Frau hinter ihm vor Hunger TV-gerecht inszeniert zusammenbrach. „Ich spreche über den langsamen Tod dieser Menschen“, rief er dramatisch in die Kamera.
Die Erzählung vom „langsamen Tod“ und der „letzten Stimme“ setzt auf Bilder, die das Gemüt erobern und den Kopf überspringen. Genau dafür ist die Symbiose aus Hamas-Regie, Presselogistik und Senderdramaturgie gemacht. Die Szene wirkt authentisch, weil sie echt gefühlt ist; sie ist dennoch kuratiert, weil der Kontext fehlt. Wer hat den Zugang gewährt? Wer stand hinter der Kamera? Welche Motive wurden nicht gezeigt?
Doch Anas al-Sharif war nicht bloß Reporter, sondern nach israelischen Unterlagen ein operativer Hamas-Kader. Dass ein solcher Akteur vor laufender Kamera zur moralischen Instanz stilisiert wird, ist kein Betriebsunfall, sondern das Produkt eines Systems, in dem die Hamas die Bilder liefert, Al Jazeera die Bühne stellt und westliche Redaktionen die Resonanzkammer bilden.
Man muss wissen: Es gibt in Gaza keine unabhängigen Fotografen, Kameramänner und Journalisten. Sie sind alle von der Terrororganisation Hamas ausgewählt. Daher schaffen es kaum Berichte über Diebstahl von Lebensmittellieferungen durch die Hamas in die Welt, wohl aber Bilder von verzweifelten Menschen und nicht nachprüfbare Zahlen über Hungernde und Tote.
Gaza besitzt eine mediale Schaltstelle: das Government Media Office. Dort werden Drehgenehmigungen, Zugang und Themen gelenkt. Wer in Gaza arbeitet, weiß: Ohne Einwilligung der Hamas geht nichts, schon gar nicht Bilder aus Haftkellern, über Plünderungen von Hilfsgütern oder über die Rekrutierung Minderjähriger. Der Alltag der Kamerateams ist ein Korsett: Eskorten, Treffpunkte, „sichere“ Perspektiven. So entstehen Erzählungen, deren Auswahl bereits Politik ist.
Internationale Teams gibt es nicht, sie erhalten seit Langem kaum Einreisegenehmigungen, abgesehen von eng geführten Besuchen im Rahmen militärischer Begleitungen. Lokale Berichterstatter arbeiten unter Aufsicht und stehen unter massivem Druck, was unabhängige Recherche erschwert und Selbstzensur fördert. In diesem Umfeld bestimmen Hamas-Stellen, an welche Orte Kameras gelangen, welche Themen sichtbar sind und wann Bilder freigegeben werden.
Al-Sharif und zuvor Hassan Aslih stehen für die Doppelrolle: Pressweste außen, Organisationsbindung innen. Al Jazeera bestreitet das, aber Foto- und Videomaterialien zeigen eine große Nähe zu den Drahtziehern des Massakers vom 7. Oktober wie Yahya Sinwar. Selfies zeigen einen lachenden al-Sharif mit Hamas-Funktionären wie Yahya Sinwar oder Khalil al-Hayya. Wann sie gemacht wurden, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Doch klar ist: Der Zugang zu solchen Figuren ist ohne Zustimmung der Organisation nicht möglich. Wer so nah herandarf, ist Teil der Inszenierung.
Al-Sharif bekommt die Erlaubnis der Hamas, bei der Freilassung der israelischen Geiseln am 19. Januar 2025 ganz dicht dabei zu sein. Diese von der Hamas sorgfältig inszenierten und die ausgemergelten Geiseln entwürdigenden Bilder erschüttern die Welt. Al Jazeera berichtet „exklusiv“, so der Sender voller Stolz, von vorderster Front. Al-Sharif steht direkt neben den Geiseln und beobachtet den Moment, in dem sie dem Roten Kreuz übergeben werden. Kein Wort übrigens zu dem Schrecken, der von den Bildern ausgeht, die an Bilder aus KZs erinnern. Das geht nicht ohne Erlaubnis der Hamas-Leute.
Am Tag des Überfalls am 7. Oktober lobpreist er die Hamas-Terroristen, die mordend und schändend in Israel einfallen und eine fürchterliche Blutspur hinterlassen. Kritisch ist die Rolle des TV-Senders Al Jazeera nicht. „Anas und seine Kollegen gehörten zu den letzten verbliebenen Stimmen aus Gaza, die der Welt ungefilterte Berichte aus erster Hand über die verheerenden Zustände lieferten, unter denen die Menschen dort leiden“, erklärte der katarische Sender in einer Stellungnahme. Wider besseres Wissen.
Abgesehen von seltenen Einladungen zur Beobachtung israelischer Militäroperationen wurde internationalen Medien während der gesamten Dauer des Krieges die Einreise nach Gaza untersagt. Al Jazeera gehört zu den wenigen Medien, die noch mit einem großen Team von Reportern im belagerten Gazastreifen präsent sind und über das tägliche Leben inmitten von Luftangriffen, Hunger und den Trümmern zerstörter Stadtviertel berichten.
Der aus Resten der ehemaligen arabischen BBC entstandene und vom katarischen Herrscherhaus mit scheinbar unbegrenzten Mitteln ausgestattete Sender Al Jazeera hat sich über Jahre als Tor zu geschlossenen Räumen inszeniert – sei es zu Taliban, Al-Qaida oder heute zur Hamas. Exklusive Bänder, exklusive Interviews, exklusive Frontaufnahmen: Das alles ist journalistisch verführerisch und politisch kostbar. Aber Exklusivität ist nie gratis. Sie kostet Distanz. Und sie kostet Glaubwürdigkeit, wenn aus der Rampe für Informationen die Bühne für Botschaften wird.
Die Verteidigungslinie des Senders lautet immer gleich: Man dokumentiere nur. Doch Dokumentation ohne Gegenprobe ist Verlautbarung, und Verlautbarung im Krieg ist Propaganda. Wer Opferzahlen, Bilder und Aussagen aus einer Hand bezieht, sollte sie nicht als „ungefiltert“ anpreisen, sondern als „nicht unabhängig verifiziert“ kennzeichnen – und zwar prominent, nicht im Kleingedruckten.
Daraus ergibt sich die zweite Front des Krieges: der Kampf um Deutungshoheit. Während einige europäische Medien den 11. August als Angriff auf die Pressefreiheit werteten, hoben andere Blätter hervor, dass ein Pressausweis keine Immunität gewährt, wenn dessen Träger zugleich operativ für eine Terrororganisation tätig ist.
Die Auseinandersetzung um redaktionelle Linien wird durch einen britischen Fall illustriert: Nach einem Bericht des Spectator soll eine interne BBC-Mail zur Gaza-Berichterstattung Formulierungen und Bewertungen nahegelegt haben, die einseitig zu Lasten Israels gingen. Die BBC verwies auf bestehende Richtlinien und äußerte sich nicht im Detail. Unabhängig vom Einzelvorwurf bleibt festzuhalten: In Konflikten mit hoher Informationsasymmetrie haben redaktionelle Standards, Quellenprüfung und klare Trennung von Nachricht und Kommentar besonderes Gewicht. TE berichtete.
Solche Anweisungen widersprechen den BBC-eigenen Regeln zur politischen Neutralität – und entlarven, wie gezielt Narrative konstruiert werden. Deutsche Medien, die BBC-Berichte oft ungeprüft übernehmen, werden so Teil einer globalen Meinungslenkung.
Der Propagandakrieg tobt als zweite Front. Militärisch ist die Hamas geschwächt, ihre Verluste sind hoch. Doch im Propagandakrieg erringt sie weiterhin Erfolge – dank eines Netzes aus getarnten Kämpfern, unterstützenden NGO-Berichten und willfährigen internationalen Redaktionen. Der Fall al-Sharif ist dafür ein Lehrbuchbeispiel: Ein Terrorführer mit Kamera, der den Krieg der Bilder für Hamas führte, wird zum gefallenen Journalisten verklärt. Von der IDF vorgelegte Fakten werden ignoriert.
Ende der neunziger Jahre und in den ersten Kriegsjahren nach 2001 war der Sender die zentrale Plattform für Videobotschaften Osama bin Ladens. Das Büro in Kabul erhielt Bänder über Kuriere; 2001 sendete der Sender exklusiv eine Botschaft am Tag der US-Angriffe auf Afghanistan. Der Korrespondent Taysir Alluni führte im Oktober 2001 ein längeres Interview mit bin Laden; der Investigativjournalist Yosri Fouda traf 2002 die 9/11-Planer Khalid Scheich Mohammed und Ramzi Binalschibh.
Die Folge war massiver politischer Druck aus den USA bis hin zur Zerstörung des Al-Jazeera-Büros in Kabul durch einen Luftschlag; zugleich entstand eine anhaltende Debatte, ob das Ausstrahlen solcher Botschaften notwendige Dokumentation oder unfreiwillige Plattform für Terrorpropaganda ist. Das verschaffte Al Jazeera außergewöhnliche Aufmerksamkeit – und brachte dem Sender heftige Kritik und politischen Druck aus den USA ein.
Heute betont Al Jazeera, al-Sharif und seine Kollegen hätten der Welt ungefilterte Eindrücke des Alltags inmitten von Luftangriffen, Hunger und Trümmern geliefert, verschweigt aber, dass diese Bilder unter Kontrolle der Hamas entstanden sind und deren strategischen Zielen gedient haben. Beides kann gleichzeitig zutreffen: Auch in autoritären Systemen entsteht journalistisch wertvolles Material. Doch ohne unabhängige Struktur, offene Zugänge und überprüfbare Quellen bleibt die Deutung im Dunkeln.
Pressefreiheit, die Terroristen schützt und deren Taten verschleiert, verliert ihre Legitimation. Israel betont, legitime Journalisten nicht zu attackieren. Doch wenn sich die Frontlinien zwischen Presse und Propaganda auflösen, wird jeder Angriff automatisch als Angriff auf die Wahrheit inszeniert – selbst wenn er einem Raketenplaner gilt.
Die Unterscheidung, ob jemand legitimer Reporter oder bewaffneter Kombattant ist, fällt im westlichen Blätterwald zunehmend weg. Während BILD titelte „Terrorist als Journalist getarnt“, und der Telegraph“ schrieb: „Pressausweis schützt nicht vor Terror-Beteiligung“, übernahmen BBC und New York Times weitgehend die Al-Jazeera-Formulierung vom „gezielten Angriff auf die Pressefreiheit“.
Damit setzt sich ein Muster fort: Die Hamas nutzt Medienstrukturen als Schutzschild, der Westen macht sie zu Märtyrern der Meinungsfreiheit.



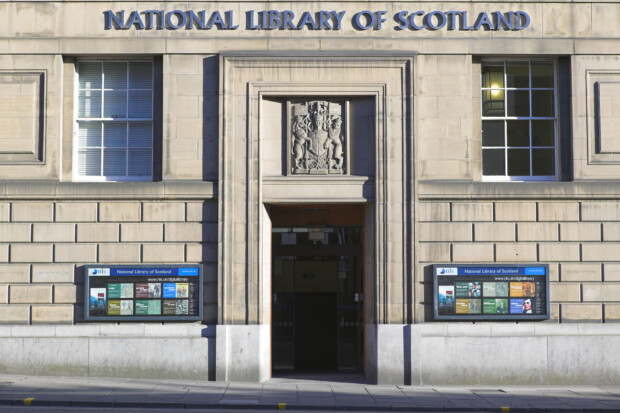



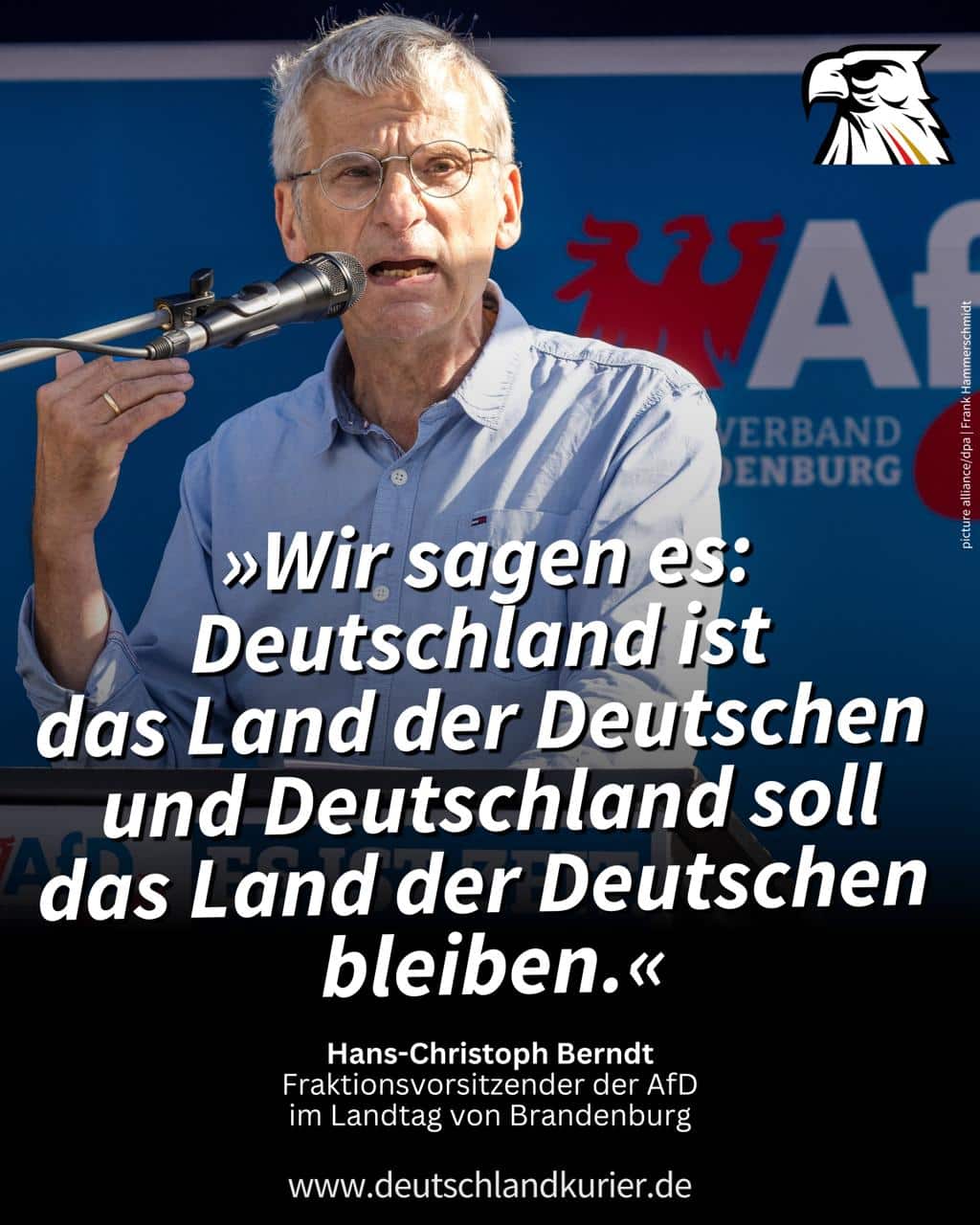
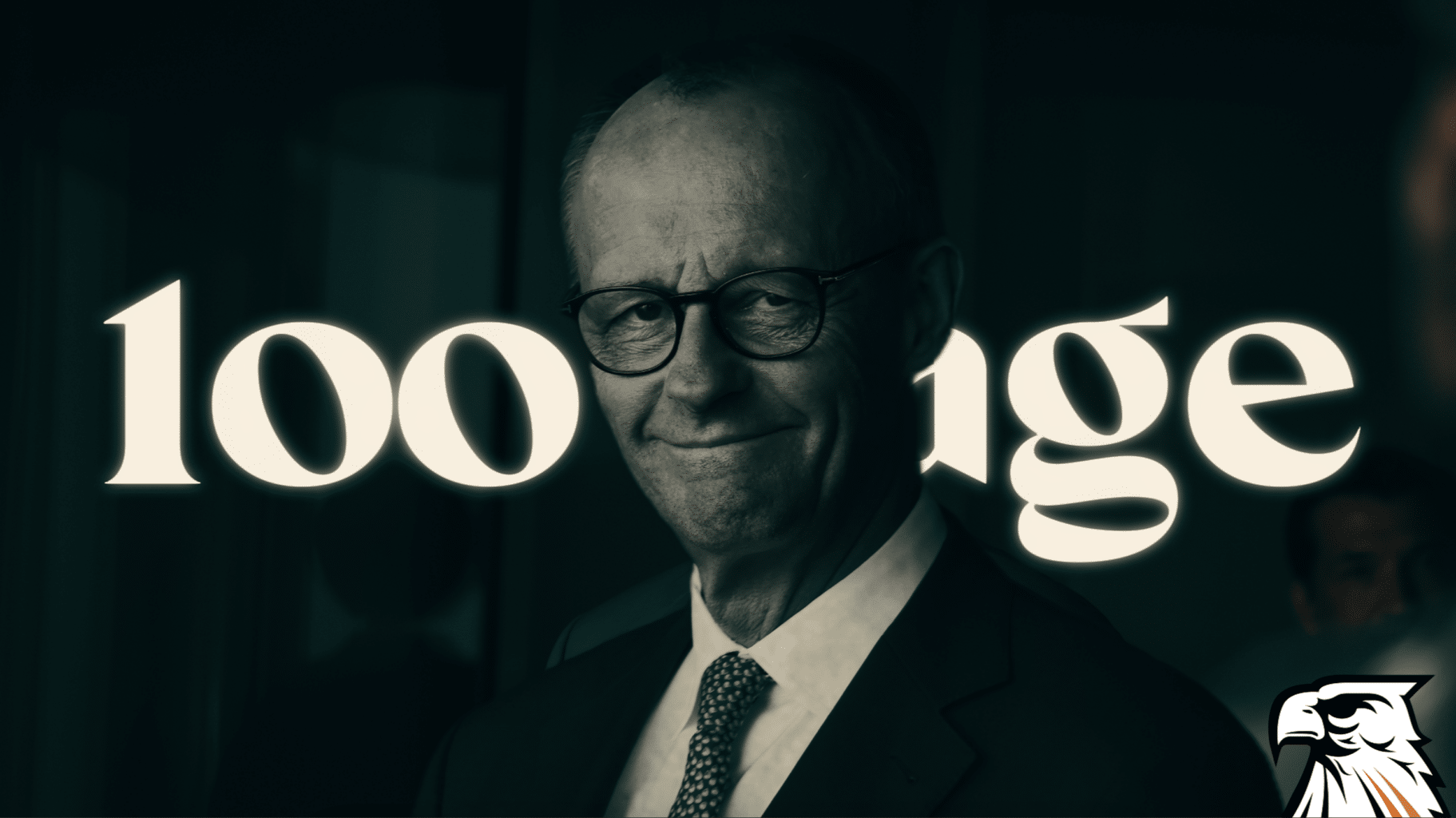
 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























