
Nach Jahrzehnten bewaffneter Auseinandersetzungen mit dem türkischen Staat hat die kurdische Arbeiterpartei und Terror-Organisation PKK die Auflösung ihrer Organisation in Aussicht gestellt. Die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF berichtete am Wochenende, man habe sich darauf verständigt, die militärischen Strukturen aufzulösen und den bewaffneten Kampf zu beenden. Die Umsetzung dieses Schritts solle unter der Leitung von PKK-Gründer Abdullah Öcalan erfolgen, der seit 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftiert ist.
Die Regierungspartei AKP reagierte zurückhaltend positiv auf die Ankündigung. Parteisprecher Ömer Celik betonte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Umsetzung müsse umfassend sein und sämtliche Untergruppen der PKK sowie illegale Strukturen betreffen. In diesem Fall könne es sich um einen historischen Wendepunkt handeln.
Gegründet wurde die PKK 1978 von Öcalan als Reaktion auf die jahrzehntelange Diskriminierung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei. Ab Anfang der 1980er Jahre führte sie einen bewaffneten Kampf für mehr Autonomie, später auch für einen eigenen Staat im kurdisch geprägten Südosten des Landes. Inzwischen ist die Organisation von separatistischen Forderungen weitgehend abgerückt. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.
Kurden feien ein Frühlingsfest in Deutschland: Auf den Flaggen erkennt man das Porträt des PKK-Führers Öcalan.
Die angekündigte Auflösung folgt einem Appell Öcalans aus dem Februar. Damals hatte er die Organisation aufgefordert, die Waffen endgültig niederzulegen. Der nun begonnene Prozess wirft zahlreiche Fragen auf – etwa hinsichtlich der Entwaffnung, möglicher Amnestien und der Zukunft der Kämpfer. Laut ANF fordert die PKK rechtliche Garantien zur Absicherung des Schrittes. Zudem habe man die Auflösung an die Bedingung geknüpft, dass Öcalan künftig unter freieren Bedingungen leben und politisch arbeiten könne. Die türkische Regierung lehnt eine Freilassung Öcalans bisher kategorisch ab.
Die Wirkung eines möglichen Endes der PKK reicht über die Türkei hinaus. Die Organisation unterhält ihr Hauptquartier in den Kandil-Bergen im Nordirak und ist auch in Syrien sowie in Teilen Europas aktiv. Unklar ist bislang, ob sich alle Gliederungen der Organisation dem Kurswechsel anschließen werden. Ankara hatte in der Vergangenheit insbesondere auch die syrische Kurdenmiliz YPG ins Visier genommen, die aus Sicht der Türkei als PKK-Ableger gilt. Eine jüngst angekündigte Integration der YPG in die syrischen Staatskräfte könnte jedoch zu einer Entschärfung dieses Konflikts beitragen.
1991: Abdullah Öcalan (mitte) mit PKK-Terroristen
Beobachter verbinden mit der Entwicklung die Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende der Gewalt und neue Perspektiven für die politische Teilhabe der kurdischen Bevölkerung in der Türkei. Schätzungen der International Crisis Group zufolge kostete der Konflikt bislang rund 40.000 Menschen das Leben. Ein letzter Versuch einer Waffenruhe scheiterte im Sommer 2015; seither fliegt das türkische Militär regelmäßig Angriffe auf PKK-Stellungen im Inland und in Nachbarländern.
Der aktuelle Vorstoß könnte auch innenpolitisch motiviert sein. Hintergrund ist offenbar eine Initiative der ultranationalistischen MHP, Koalitionspartner von Präsident Erdoğan. Parteichef Devlet Bahçeli, bislang entschiedener Gegner jeder Aussöhnung mit der PKK, hatte im Oktober erstmals eine mögliche Freilassung Öcalans in den Raum gestellt – unter der Bedingung, dass sich die Organisation auflöst.
Auch Erdoğan selbst könnte ein Interesse an einem Befriedungsprozess haben. Politische Analysten verweisen auf seinen Versuch, durch eine Verfassungsreform eine dritte Amtszeit als Präsident zu ermöglichen. Dafür wäre eine Zusammenarbeit mit der pro-kurdischen Opposition denkbar – ein Kalkül, das auch in die derzeitigen Entwicklungen hineinspielen dürfte.









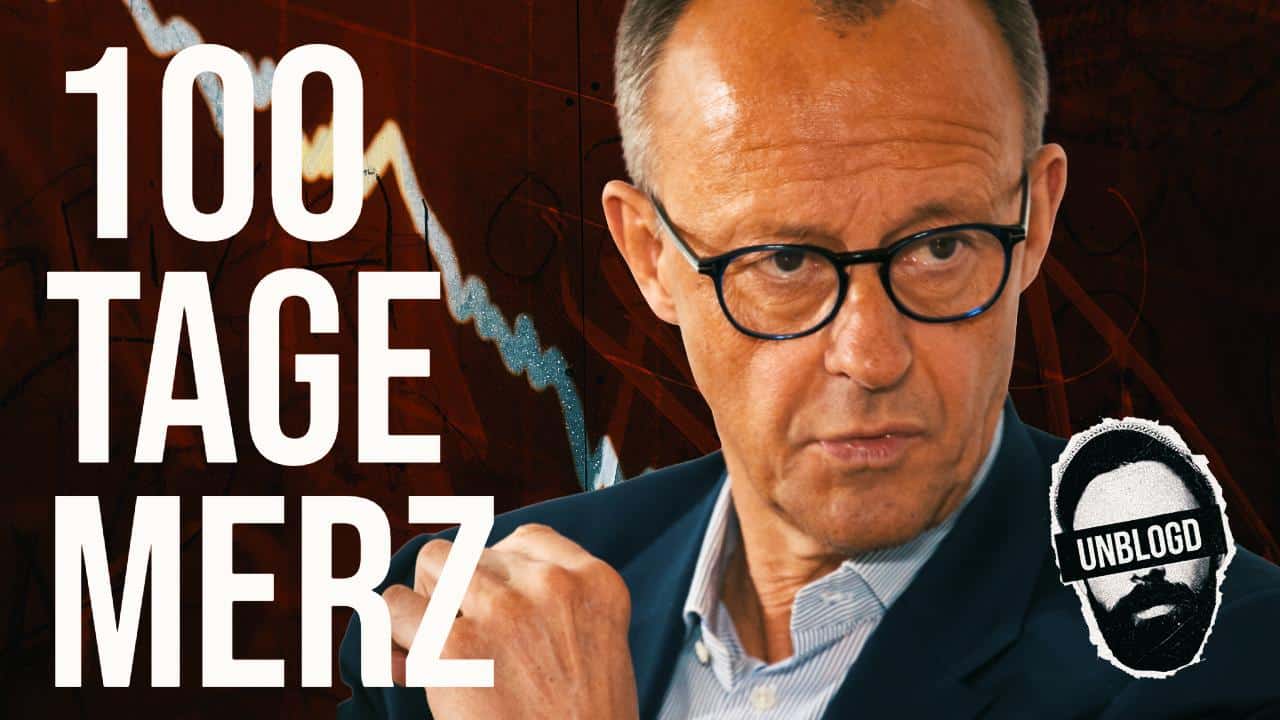
 VOR ALASKA-TREFFEN: Merz sucht Linie mit Trump und Selenskyj – Europa will Druck auf Putin erhöhen
VOR ALASKA-TREFFEN: Merz sucht Linie mit Trump und Selenskyj – Europa will Druck auf Putin erhöhen






























