
„Die Deutschen“, dieses Bonmot wird dem Herrn Bonaparte zugeschrieben, „haben sechs Monate Winter und sechs Monate keinen Sommer, und das nennen sie Vaterland“. Um also dem Kaiser in später Rache zu trotzen, erfand der öffentlich-rechtliche Rundfunk blutrot gefärbte Wetterkarten, die das Gegenteil beweisen sollen.
Vor allem aber, und das konnte Napoleon nicht wissen, gibt es in Deutschland inzwischen auch Sommerferien, Sommerpausen, sogar ein alljährliches Sommerloch (nicht verwandt mit dem Ozonloch) und hin und wieder sogar ein Sommermärchen. Für eine chronisch unterkühlte Nation ist das alles ziemlich schweißtreibend. Da hilft nur eine Reise.
Wer nun für die kommenden Wochen noch keine Pläne hat und in Zeiten der drohenden Rezession die Binnenwirtschaft ankurbeln möchte, dem sei Thüringen ans Herz gelegt, genauer gesagt: Weimar. Hier laufen sämtliche Fäden der jüngeren Landesgeschichte zusammen. Die Klassikstadt ist nicht nur Wirkstätte der Herren Goethe und Schiller, sondern auch Namenspatin der ersten gesamtdeutschen und auf denkbar unglückliche Weise gescheiterten Republik.
Weniger bekannt, aber durchaus sehenswert ist auch das sogenannte Goethe-Hafis-Denkmal am Rande des Weimarer Ilmparks. Jenes besteht aus zwei gegenüberstehenden Stuhlskulpturen aus Granit, die aus einem Block gearbeitet sind und erinnert an eine vermutete Geistesverwandtschaft zwischen dem deutschen und dem persischen Poeten. Da Hafis allerdings im vierzehnten Jahrhundert lebte, müssen wir uns im Detail auf das über jeden Zweifel erhabene Wort des alten Geheimrates verlassen. Die Werke des persischen Dichters inspirierten Goethe zu seinem späten „West-Östlichen Divan“, und am Sockel findet sich die Inschrift: „Wer sich selbst und andre kennt / wird auch hier bekennen / Orient und Okzident / sind nicht mehr zu trennen“.
Das Goethe-Hafis-Denkmal in Weimar.
Die Skulptur ist derart sehenswert, dass der damalige iranische Präsident, Mohammed Chatami, im Jahre 2000 die Zeit fand, anlässlich der gemeinsamen Einweihung mit Bundespräsident Rau höchstpersönlich anzureisen. Da kannte er Deutschland bereits recht gut, war er doch Ende der 1970er Direktor des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), das der hiesigen Bevölkerung durch seine „Blaue Moschee“ an der Außenalster ein Begriff ist. Das Zentrum stand ab 1993 unter Beobachtung des Hamburger Verfassungsschutzes, bevor der Verein am 24. Juli 2024 verboten wurde; die Moschee gehört nun der Staatskasse. Wissen Sie was: Setzen Sie Hamburg doch gleich auf die Liste für den sommerlichen Städtetrip.
Der iranische Staatspraesident Mohammed Chatami (links) zusammen mit Bundespraesident Johannes Rau (Mitte, SPD) und dem Thueringer Ministerpraesidenten Bernhard Vogel (rechts, CDU) bei der offiziellen Einweihung des Denkmals fuer den persischen Nationaldichter Hafiz am 12.07.2000 in Weimar.
Manche allerdings zieht es trotz der zahlreichen Attraktionen im Inland in die Ferne, wie etwa in den vorbenannten, vom Okzident nicht mehr zu trennenden Orient. Die amerikanische Luftwaffe beispielsweise unternahm erst kürzlich einen kostspieligen Direktflug, verlor jedoch am Zielort einige Gepäckstücke. Den Obersten Reiseführer des iranischen Regimes ärgerte das sehr. Andere, wie beispielsweise die Außenministerien der europäischen Mittelmächte, verstehen unter dem Orient etwas naheliegenderes und denken hier selbstverständlich an Wien. Hier könnte im Rahmen einer Arbeitsreise bereits am Freitag das berühmte Atom-Abkommen nachverhandelt und somit verlängert werden, denn es läuft im Oktober nach zehnjähriger Laufzeit aus.
Wie es sich für ein Sommermärchen aus Tausendundeiner Nacht gehört, kann man den geostrategischen Ansatz der europäischen Außenpolitiker getrost als Erholungsurlaub von der Realität beschreiben. Kein Zeitpunkt wirkt irrsinniger als der jetzige, um mit dem Mullah-Regime ernsthaft über irgendeine Art von Atomabkommen zu verhandeln: Nicht nur hat Teheran sich in den letzten Jahren konsequent als globaler Exporteur des islamistischen Terrorismus hervorgetan, der auf westliche Christen, Juden und andersdenkende Muslime zielt. Sondern gerade jetzt, wenn das israelische Militär die iranische Führungsriege entscheidend dezimiert und Washington das Nuklearprogramm um Jahre zurückgeworfen hat, ist die Mitwirkung an der Konsolidierung der Mullah-Chefetage bemerkenswert blauäugig. Das gilt insbesondere, da Persien wie kein anderes Land im Mittleren Osten über eine bemerkenswerte und ausgezeichnet integrierte Exil-Opposition verfügt. Wozu über ein Programm verhandeln, das in Trümmern liegt, mit einem Regime, das ins Wanken geraten ist? Wie etwas rechtfertigen, dass dem gerade in progressiven Kreisen wohlfeil aufgenommenen Schlachtruf „Frauen, Leben, Freiheit!“ so diametral widerspricht?
Ein Baby wird im Juni 2025 nach einem iranischen Anschlag in Ramat Gan, Israel, evakuiert.
Allerhand könnte man schreiben über den deutschen Exotismus und Orientalismus, die ewig währende Aufwertung des Ungleichbehandelten, eines „Edlen Wilden“. In die literarische Befassung eines Johann Gottfried Seume („Seht, wir Wilden sind doch beßre Menschen“) über die Winnetouisierung Amerikas nach Karl May bis hin zu einer aufklärerisch antagonisierenden Verklärung der arabischen Welt des Mittelalters mischten sich immer auch geopolitische Motive deutscher Staatlichkeit. Von der Absicht Friedrich des Großen, eine Moschee zu errichten, über die Anwerbung muslimischer Bosniaken im Kampf gegen den Zaren bis hin zu dem Versuch, im Schulterschluss mit den Arabern den Tommy und den Franzmann aus dem Nahen Osten zu verjagen (um sich dann selbst dort breit zu machen) ist die Liste lang – und historisch im Übrigen unvollständig. Doch auch, wenn dies einen Teil der unbewussten inneren Bewegtheit grade der älteren deutschen Bevölkerung erklären dürfte, liegen die Gründe dafür viel weniger tief und viel weniger in der Zeit zurück.
Nein, die deutsche (und auch europäische) Nahost-Politik, insbesondere mit Blick auf den Iran, dürfen ganz einfach deshalb nicht scheitern, weil das die Wirksamkeit multilateraler Eitelkeiten in Zweifel zöge. Zu den bitter einzugestehenden Erkenntnissen der letzten Jahre gehört nämlich, dass die von den Europäern, allen voran den Deutschen so liebevoll verfolgte regelbasierte Außenpolitik immer dann an ihre Grenzen stößt, wenn Amerika nicht mehr oder bereits von Anfang an nicht im selben Boot ist. Das gilt in gewissem Umfang in der Ukraine, sicherlich in Afghanistan und im Umgang mit Israel, in besonderer Weise aber gegenüber Teheran.
So wurde das zu Zeiten Kanzlerin Merkels etablierte und von ihrem zweimaligen Außenminister Steinmeier engmaschig begleitete urprüngliche Atomabkommen mit dem Iran zwar hierzulande als gewaltiger Durchbruch gefeiert, geradezu als Blaupause für zukünftige Abkommen ähnlicher Bauart. Doch in just dem Moment, als ein Machtwechsel im Weißen Haus auch einen Rückzug der USA aus dem Vertragswerk einläutete, war das Abkommen nicht mehr das Papier wert, auf dem es stand. Das von Deutschen, Briten und Franzosen mühsam aus der Taufe gehobene Zahlungssystem INSTEX – gepriesen als Meilenstein auf dem Weg hin zu „Wandel durch Handel“, oder auch „Wandel durch Annäherung“ – erwies sich als entsetzlicher Rohrkrepierer. Nur eine einzige Transaktion, die Lieferung medizinischer Güter während der Pandemie, wurde über INSTEX abgewickelt, dann wurde es vor zwei Jahren klammheimlich eingestellt. Macron, Wadephul und andere wollen sich auch heute nicht eingestehen, dass nicht einmal das Mullah-Regime im Iran ernsthaftes Interesse an der europäischen Position hat: Es sieht die gutgläubigen Europäer bestenfalls als nützliche Idioten zur Stabilisierung, braucht aber vor allem die Verhandlungen als PR-Kulisse, um sich international als legitimer Akteur zu profilieren.
Nützliche Idioten:Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der französische Außenminister Laurent Fabius und der chinesische Außenminister Wang Yi (von links) sitzen während ihrer Iran-Gespräche in Wien im November 2014 am Verhandlungstisch.
Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zwar Menschenrechtsverletzungen im Iran immer wieder ansprach, aber auch der iranischen Führung per Telegram zum Jubiläum der Revolution gratulierte, ist noch heute ein ehemaliger Außenpolitiker im Amt, der zu den technokratischen Architekten eines obsoleten geopolitischen Ansatzes zählt. Noch heute prägt diese Denkschule nicht nur Teile der SPD und der durch die Merkel’sche Ära gegangene Union, sondern auch Fachleute und Teile der Öffentlichkeit. Mitnichten ist unser Staatsoberhaupt verantwortlich für das orientierungslose Klammern europäischer Eliten an einer gescheiterten Doktrin, doch steht er mit seinem diplomatischen Erbe in einer rasant veränderten Weltlage sinnbildlich für eine sich längst überlebte, moralisch aufgeladene Beharrlichkeit. Die EU hat ihrerseits eine strukturelle Abneigung gegen Eskalation: Sie glaubt an Verträge, weil sie sich selbst durch Verträge definiert. Der Iran wird nicht als Kontrahent, sondern als noch nicht eingelöster Partner gesehen – auch wenn das empirisch kaum zu halten ist.
Nun könnte man im Stile unerträglicher Stiftungs-Konferenzen fragen: „Quo vadis, deutsche Iran-Politik?“, oder in diesem Kontext: Wohin fährst Du diesen Sommer? Reisekönig Merz ist derart viel unterwegs, dass man es in seinem Falle ohnehin nicht wird beantworten können. Für das Außenamt aber scheint zu gelten: Wir gehen über Wien nach Teheran, und das ist in dieser Lage nicht weniger als ein Gang nach Canossa.
Die deutsche Iran-Politik schließlich eignet sich als Lehrstück darüber, dass „Diplomatie“ zum dogmatischen Imperativ desjenigen wird, dem die Hände ohnehin gebunden sind.
Denn ihre eigentliche Natur besteht darin, auf Gewalt erklärtermaßen verzichten zu wollen – nicht, es zu müssen. Ohne das Gewaltpotenzial, dem sie vorgelagert ist, ist Diplomatie weder besonders nobel noch besonders wirkungsvoll. Die Deutschen schätzen die Bemühungen ihrer Botschafter und Handelsvertreter in aller Welt zurecht deshalb, weil sie dieses Engagement als ehrbare, vernünftige und friedliche Alternative zu jeglicher Gewalt betrachten. Doch was bedeutet die Höflichkeit desjenigen, der über keine anderen Instrumente als Schmeichelei verfügt? In diesem Moment wird die Diplomatie völlig wirkungslos, sie verkommt zur bloßen Kulisse. Teheran weiß das – weswegen es strategisch auf den Gewaltverzicht Amerikas schielt, unseren jedoch für selbstverständlich erachtet.
Einen echten Beitrag leisten könnte die Bundesregierung, indem sie dem Mullah-Regime diesen Sommer zu einer diplomatischen Abkühlung verhilft: Es besteht kein Grund, ohne echte Zugeständnisse überhaupt mit Teheran zu diskutieren. Der verschwindend geringe Außenhandel ist für diese Wirtschaftsnation der Mühe nicht wert, dazu ist es viel zu heiß. Wenn der Iran von diesem Land etwas will, dann muss er beispielsweise seine Terror-Finanzierung – wie beim berüchtigten Mykonos-Attentat in Berlin – nachweislich einstellen.
Doch gelingt unserer Politik jener Akt der Selbstbehauptung? Dies hat der von Goethe bewunderte Napoleon avant la lettre gesagt: „Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche“.
***Chris Becker ist ehemaliger Offizier der Luftwaffe, Reservist, Berater und als freier Autor für verschiedene Medien tätig.
Mehr von Chris Becker:So zahlt Deutschland den Preis für Frankreichs Machtpolitik






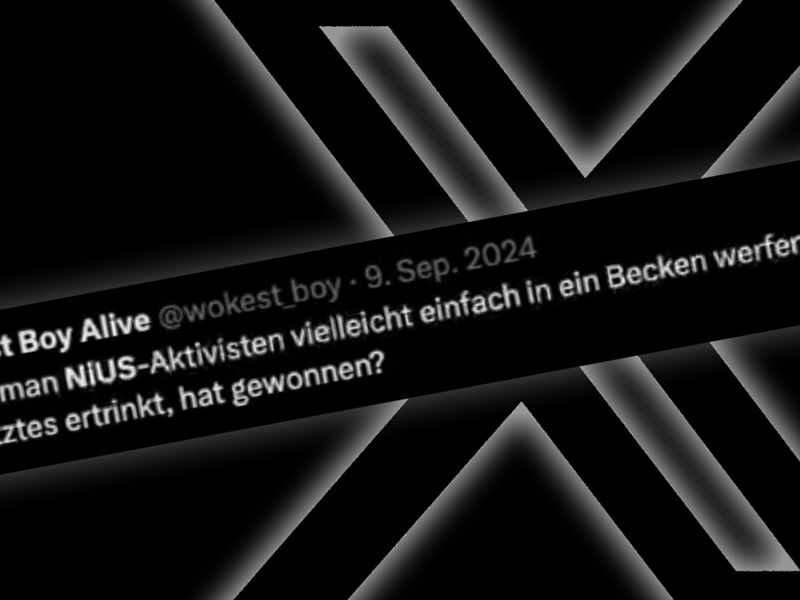

 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























