
In „Studio M“ diskutiert der Chefredakteur des ARD-Politikmagazins Monitor, Georg Restle, gemeinsam mit wechselnden Gesprächspartnern ein jeweils aktuelles politisches Thema. Anlässlich der 50. Ausgabe hat Restle den Gründer von Jung & Naiv, Tilo Jung, sowie die Kommunikationswissenschaftlerin und Medienkritikerin Nadia Zaboura eingeladen.
Zu Beginn der Diskussion wird die Frage aufgeworfen: „Wozu brauchen wir eigentlich noch Journalismus?“ – angesichts der Tatsache, dass sich immer mehr Menschen über soziale Medien informieren und Künstliche Intelligenz journalistische Aufgaben übernehmen könnte. „Ist Journalismus dann am Ende oder brauchen wir ihn umso dringlicher?“
Im Verlauf des Gesprächs kommt die Runde dann mehr und mehr zu dem Ergebnis, dass jüngste Entwicklungen zu einem nicht übersehbaren Rechtsdrift in der Medienlandschaft geführt hätten. „Die Regel ist, wir haben keinen Journalismus mehr. Wir haben keine freie Presse mehr. Wir bilden uns ein, Pressefreiheit in diesem Land zu haben, weil sie im Grundgesetz steht. Aber wir nehmen diese Freiheit nicht wahr“, so Tilo Jung.
Restle geht darauf ein und fragt, ob große Medienhäuser wie die FAZ, der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen würden. „Ja, natürlich“, entgegnet Jung darauf. In früheren Zeiten habe der Journalismus noch eine tragende Rolle gespielt – etwa als Wegbereiter für Demokratie, Arbeitnehmer- oder Frauenwahlrecht. „Mittlerweile ist Journalismus ein Sterbebegleiter der Demokratie, der Menschenrechte, der Arbeitnehmerrechte“, so Jung.
Dabei steigert er sich noch weiter in seine Aussagen hinein. „Alle Errungenschaften, die wir in den letzten 100 Jahren gegenüber der Macht, die wir zu kontrollieren haben, erreicht haben: Da helfen wir jetzt aktuell der Macht und meinetwegen sogar Faschisten, diese Errungenschaften wieder abzubauen.“ Das sei das Gegenteil von Journalismus, resümiert Tilo Jung.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Nadia Zaboura meint, sogar innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine enorme „Einseitigkeit“ feststellen zu können. Von einer „pluralen Redaktionskultur“ könne keine Rede sein. Ihr zufolge stehe der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedoch rechts von der Gesellschaft. „Jede Person, die sich intensiv mit dem Journalismus beschäftigt (…) wird den Eindruck haben, dass in den Verantwortungspositionen doch eher eine konservative Stimmung vorherrscht“.
Eine Studie der Universität Mainz stellte hingegen vor knapp einem Jahr noch das Gegenteil fest. Diese legt nahe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Berichterstattung tendenziell eine eher linke, sozialstaatliche und liberal-progressive Ausrichtung aufweist. Besonders deutlich werde dies an der bevorzugten Sichtbarkeit der damaligen Regierungsparteien SPD und Grünen. Die Oppositionsparteien würden hingegen seltener und meist weniger prominent dargestellt werden.







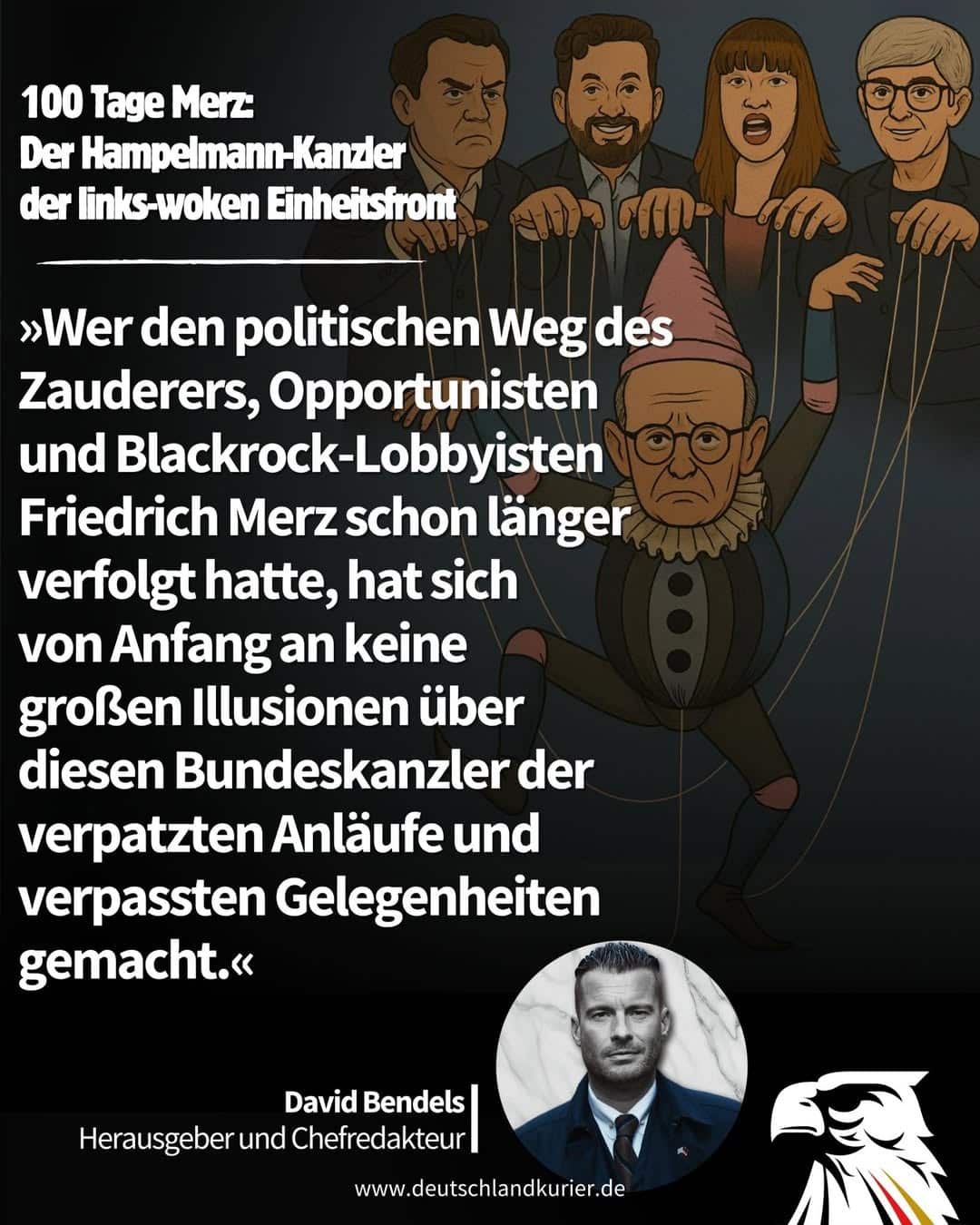


 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























