
In einem Beitrag auf Social Media stellt der WDR die Behauptung auf, dass Influencerinnen, die ihren Alltag zu Hause mit ihren Kindern zeigen – sogenannte „Tradwives“ – eine Nähe zum Rechtsextremismus aufweisen. Was auf den ersten Blick wie ein absurder Einzelfall wirkt, reiht sich in Wahrheit in eine lange Liste von Versuchen ein, Frauen und ihr Familienleben zu diffamieren. Der Vorwurf, ein traditionelles Lebensmodell sei automatisch mit rechtsextremen Ideologien verknüpft, ist nicht nur haltlos, sondern auch ein Angriff auf die individuelle Entscheidungsfreiheit von Frauen.
Kaum ein Social-Media-Phänomen sorgt seit Jahren für so viel Aufregung wie das der „Tradwives“. Dabei handelt es sich um Frauen, die sich bewusst für ein Leben zu Hause entscheiden und diesen Alltag für ihre Social-Media-Follower öffentlich dokumentieren. Sie zeigen sich beim Kochen, bei der Hausarbeit, teilen Rezepte und richten ihr Leben nach den Bedürfnissen ihrer Kinder aus. Für viele sind diese Inhalte inspirierend, doch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stoßen „Tradwives“ regelmäßig auf Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, ein „rückwärtsgerichtetes“ und „konservatives“ Frauen- und Familienbild zu vermitteln.
Die Botschaft des WDR: Hütet euch vor gepunkteten Kleidern.
Die Kritik geht jedoch weit über eine bloße Auseinandersetzung mit Lebensmodellen hinaus. In Dokumentationen und Beiträgen von ARD und SWR wird der Trend der „Tradwives“ sogar mit der Ideologie des Nationalsozialismus verglichen. Frauen, die zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern, würden demnach automatisch eine nationalsozialistische Einstellung zum Leben verkörpern. Dieser Vergleich ist nicht nur absolut unangebracht, sondern auch grotesk. Er trivialisiert die Verbrechen der NS-Zeit und stigmatisiert Frauen, die lediglich eine persönliche Lebensentscheidung treffen.
Besonders großes Entsetzen löst es aus, wenn Frauen sich bewusst für mehrere Kinder entscheiden. In einem Beitrag des „Spiegel“ äußert sich eine Journalistin abfällig über eine „Tradwife“, die bereits acht Kinder hat. Sie hoffe, dass „Gott ihr bald sagen möge, dass es nun gut ist mit dem Kinderkriegen“. Solche Kommentare zeugen von einer herablassenden Haltung gegenüber Frauen, die ihre Lebensplanung anders gestalten. Ebenso wird in einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Beitrag des WDR unter dem Titel „Zurück in die 50er“ suggeriert, das „ultrakonservative“ Lebensmodell der „Tradwives“ sei ein Ergebnis rechter Ideologien und stehe in einer vermeintlichen Nähe zum Rechtsextremismus.
Mutter und Tochter in traditionellen (sorbischen) Kluften – für manche sind solche traditionell gelebten Frauenbilder schon eine Gefahr.
Was auf den ersten Blick wie gezielte Hetze gegen bestimmte Influencerinnen aussieht, offenbart bei genauerer Betrachtung ein tieferliegendes Problem. Der Hass gegen „Tradwives“ zeigt den Unmut einiger Gruppen gegenüber Frauen, die sich bewusst für Kinder und Familie entscheiden. Besonders moderne Feministinnen, die sich sonst leidenschaftlich für die Wahlfreiheit von Frauen einsetzen, sind oft jene, die nur ein bestimmtes Lebensmodell als erstrebenswert ansehen. Ihrer Meinung nach sei wahre weibliche Emanzipation nur durch berufliche Erfüllung möglich. Frauen, die Kinder bekommen, sollten die Betreuung schnell delegieren, um möglichst bald in den Beruf zurückzukehren.
Alles andere gilt in den Augen moderner Feministinnen als rückschrittlich und anti-feministisch. Frauen, die ihr Leben anders gestalten und zu Hause bleiben, werden als Verräterinnen am eigenen Geschlecht betrachtet. Sie seien entweder von ihrem Partner unterdrückt oder schlicht zu naiv, um zu erkennen, wie „falsch“ ihr Lebensmodell sei. Diese Haltung zeugt von einer unfassbaren Arroganz und Bevormundung. Sie ignoriert, dass viele Frauen dieses Leben aus freiem Willen wählen und darin Erfüllung finden.
Kuchenbacken in traditionellen Mustern: KI zeigt eine Tradwife mit Smartphone.
Dabei sollte klar sein: Nicht jede Frau, die zu Hause bleibt und sich um ihre Kinder kümmert, ist automatisch unterdrückt oder unfrei. Dieses Lebensmodell wird in vielen Fällen nicht aufgezwungen, sondern freiwillig gewählt. Der große Zuspruch, den „Tradwives“ mit ihren Inhalten erreichen – oft Millionen von Menschen – zeigt, dass dieses Modell für viele attraktiv ist. Dennoch wird das Bild des „armen Heimchens am Herd“ hartnäckig aufrechterhalten. Eine Ehefrau und Mutter, die die Familie „managt“, kann in den Augen vieler keine glückliche, unabhängige Frau sein, sondern muss zwangsläufig ein Opfer darstellen.
Interessanterweise werden Männer, die sich für ein Leben zu Hause entscheiden, oft als Helden gefeiert. Eine Frau, die dasselbe tut, wird hingegen als unterdrückt oder rückständig abgestempelt. Diese Doppelmoral offenbart einen versteckten Sexismus, der sich in vielen angeblich feministischen Debatten findet. Anstatt Frauen die Freiheit zu lassen, ihren Alltag nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, wird ihnen vorgeschrieben, wie sie zu leben haben.
Dass moderne Feministinnen automatisch von „Unterdrückung“ sprechen, sagt mehr über ihr eigenes Weltbild aus als über die Lebensrealität der „Tradwives“. Wahre Emanzipation bedeutet, dass jede Frau selbst entscheiden darf, wie sie ihr Leben gestaltet – ohne in eine abwertende Schublade gesteckt zu werden. Die pauschale Diffamierung von Frauen, die sich für Familie und Kinder entscheiden, zeigt ein trauriges Sittenbild des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Statt sich mit tatsächlichen Problemen auseinanderzusetzen, wie etwa Gruppen, die Frauen ihre Rechte absprechen, wird lieber über Mütter hergezogen, die ihr Leben der Familie widmen. Dies ist nicht nur frauenfeindlich, sondern auch ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die vorgibt, für Vielfalt und Wahlfreiheit zu stehen.
Auch bei NIUS: Merkels große Propagandashow im WDR zeigt: Die Altkanzlerin bleibt ohne Einsicht




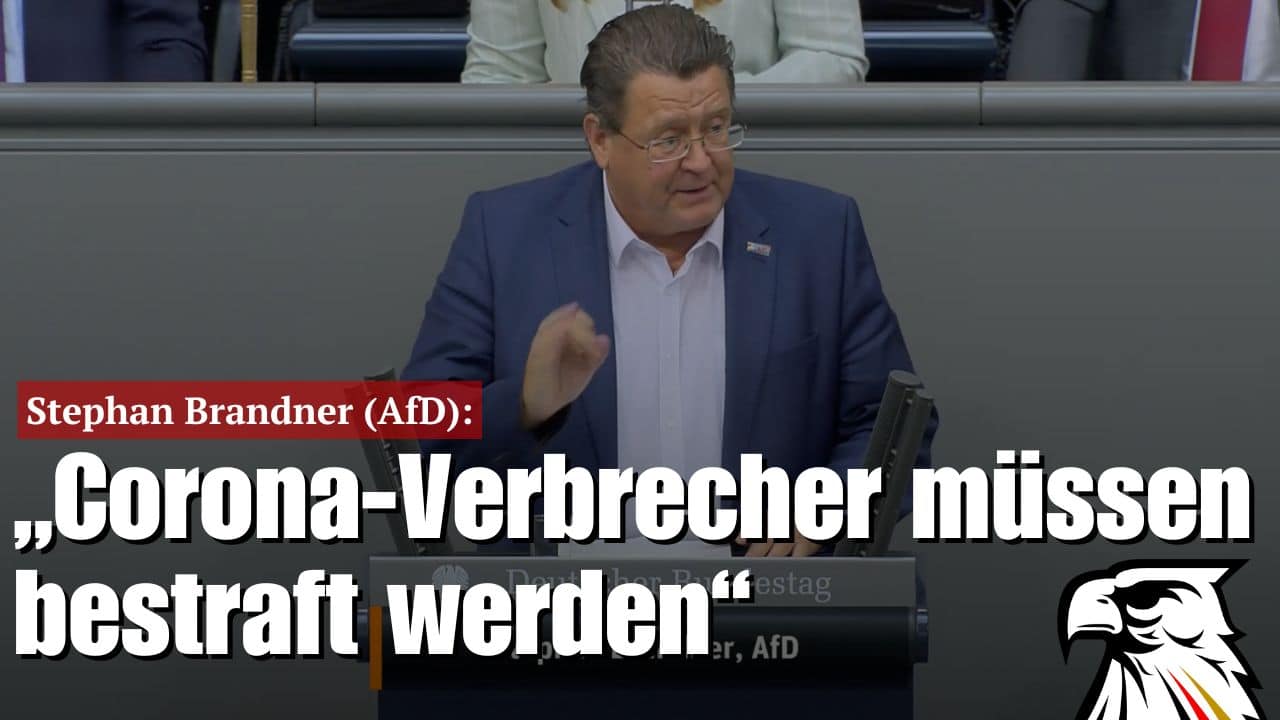

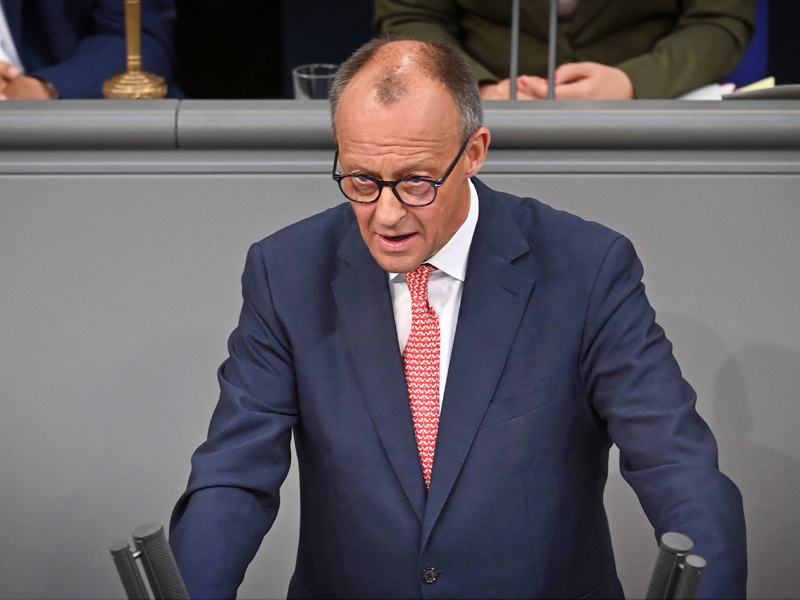


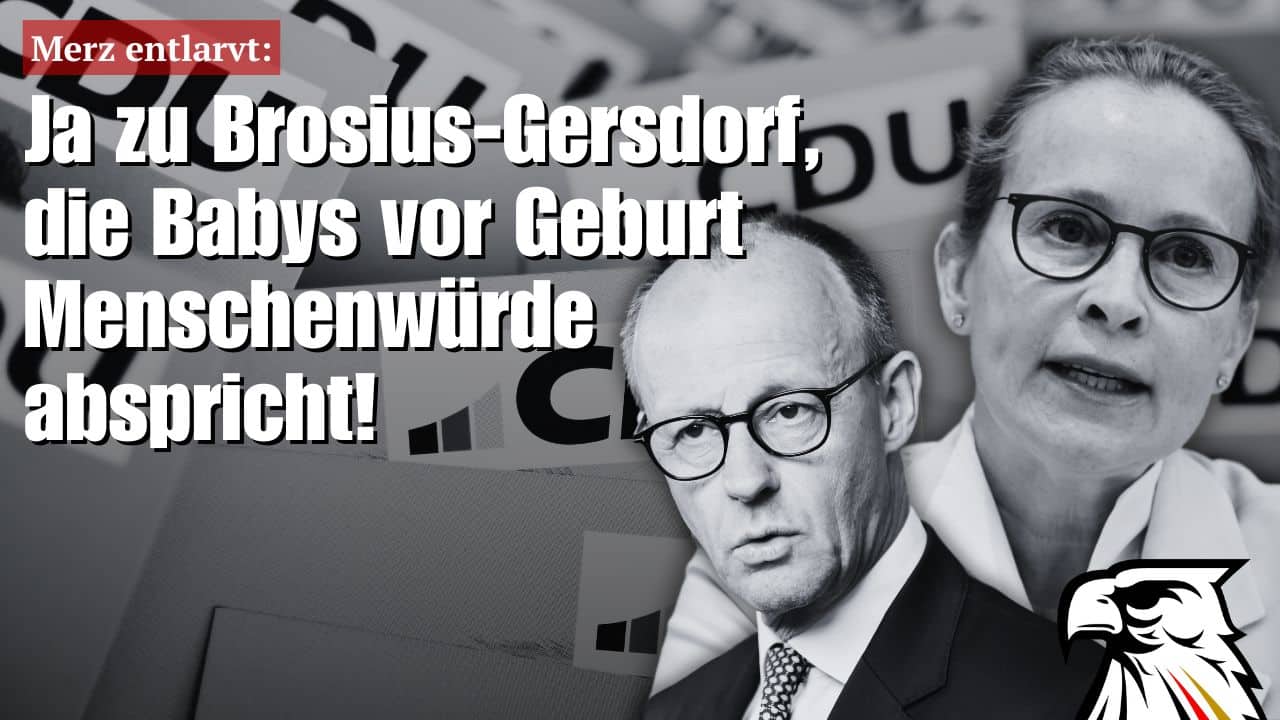
 UKRAINE-KRIEG: "Ich habe das abgesegnet!" Putin bombt gnadenlos! Jetzt reagiert Donald Trump! | LIVE
UKRAINE-KRIEG: "Ich habe das abgesegnet!" Putin bombt gnadenlos! Jetzt reagiert Donald Trump! | LIVE





























