
Die Transgender-Politik beruft sich auf zwei Frauenrechtskonventionen der UN – eine aus dem Jahr 1979, die andere von 2011. Da diese jedoch keine Transgender-Ideologie enthalten, werden sie nun verfälscht umgedeutet. Die entsprechenden Falschinformationen werden von NGOs verbreitet, die ihrerseits durch das Familienministerium gefördert werden. So brachte Lisa Paus (Grüne) ein Gesetz voran, das Transfrauen Zugang zu Frauenhäusern verschaffen sollte. Ob es das tatsächlich tut, ist aber fraglich.
Ende der Siebziger herrschte im Feminismus noch begriffliche Klarheit. Im Jahr 1979 wurde mit der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW ein völkerrechtliches Instrument geschaffen, das sich explizit gegen Diskriminierung von Frauen richtet. CEDAW steht für: „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.“ Frauen wurden darin als Menschen weiblichen Geschlechts verstanden. Das Geschlecht galt als natürliche, materielle Kategorie – nicht als psychisch oder subjektiv definiert. Diese klare Definition gerät seit einigen Jahren zunehmend unter Druck.
Vertreter des Transaktivismus vertreten die Auffassung, dass das Geschlecht nicht biologisch bestimmt, sondern Ergebnis einer individuellen Selbstidentifikation sei. Nach dieser Logik genüge es, sich als Frau zu empfinden, um rechtlich und gesellschaftlich als solche anerkannt zu werden. Auch Lisa Paus, ehemalige Familienministerin (Grüne), folgt dieser Irrlehre. Sie behauptet: „Eine Frau ist eine Person, die sich selbst als Frau identifiziert.“ Als Teil der Ampelregierung sorgte Lisa Paus maßgeblich dafür, das damit verbundene Begriffschaos zur Staatsdoktrin zu erklären.
Trans Trouble im Bundestag mit Tessa Ganserer (Grüne)
Unter ihrer Federführung wurde das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet, das es erlaubt, den Geschlechtseintrag jährlich ohne medizinisches Gutachten zu ändern. Auch das Gewalthilfegesetz wurde in seinem Entwurf mit Bedürfnissen von „trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen“ begründet. Das zentrale Argument zur Rechtfertigung des Gesetzes ist die Berufung auf internationale Konventionen wie die Istanbul-Konvention von 2011, die sich auf die UN-Frauenrechtskonvention CEDAW von 1979 bezieht.
Hier beginnt ein juristisch und politisch brisanter Vorgang: Die Trans-Ideologie steht vor dem Problem, ihre heutigen Ziele mithilfe ehrwürdiger internationaler Abkommen legitimieren zu wollen, die aus einer Zeit stammen, in der es den Transkult nicht gab – denn der damalige Feminismus war noch modern, nicht postmodern bzw. woke.
Gelöst wurde dieses Problem nun auf skandalöse Weise: Ein aus 35 NGOs bestehendes Bündnis namens „CEDAW-Allianz“ gibt den Inhalt dieser Frauenrechtskonvention in verfälschter Weise wieder. In diesem Bündnis ist etwa der Bundesverband Trans* e.V. organisiert. Die Initiative Geschlecht zählt, die eigenen Worten nach der „Rechtskategorie Geschlecht wieder Geltung verschaffen“ möchte, machte mit einer ausführlichen Recherche darauf aufmerksam.
Das NGO-Bündnis schreibt: „Die Konvention wurde 1979 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und verbietet die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Geschlechtsidentität.“ Doch das ist sachlich falsch. Die Konvention verwendet den Begriff „sex“, also das biologische Geschlecht. „Gender identity“ oder „Geschlechtsidentität“ tauchen darin nicht auf. Diskriminierung von Frauen wird in der Konvention explizit als ihre Benachteiligung „on the basis of sex“ definiert; es handelt sich also um ein Instrument zum Schutz von Frauen als biologisch weibliche Menschen. Der Wortlaut der Konvention bietet keinerlei Grundlage dafür, auch Männer, die sich als Frauen identifizieren, einzubeziehen.
1979: Verabschiedung der Frauenrechtskonvention (CEDAW) bei der UN-Vollversammlung
Ähnliches gilt für die Istanbul-Konvention. Zwar taucht dort das Wort „gender“ auf, allerdings wird es als soziale Rolle verstanden, die mit Weiblichkeit und Männlichkeit verbunden ist. „Gender identity“ wird nur an einer nebensächlichen Stelle erwähnt – nicht bei der Zweckbestimmung der Konvention oder bei der Definition von Gewalt gegen Frauen. Weder wird dort von „gender identity“ als geschützter Kategorie gesprochen, noch lassen sich daraus Rechte für männliche Personen ableiten, die sich als Frauen identifizieren. Die Behauptung, CEDAW und die Istanbul-Konvention verpflichteten zur Aufnahme von Transfrauen in Frauenräume, hält einer präzisen Textanalyse nicht stand.
Zur „Rolle der Satelliten-Organisationen des Bundesfamilienministeriums“ heißt es bei Geschlecht zählt, dass sie Begriffe wie „Frau“, „Gender“ und „geschlechtsspezifische Gewalt“ umdeuten würden. Und in der Tat fordert das Bündnis Istanbul Konvention: Dieses Abkommen müsste grundsätzlich „so verstanden werden“, dass sie sich „auf all jene Personen erstreckt, die nicht dem endo-cis männlichen Geschlecht angehören.“ Damit sind „in der Transgender-Ideologie Männer gemeint, die ihr Mannsein akzeptieren“, wie Geschlecht zählt erläutert.
Deshalb, so jene NGO, sei „die Umsetzung der Konvention nicht ausschließlich im Sinne von weiblichen Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt innerhalb eines binären Geschlechterschemas zu begleiten, sondern im Sinne aller Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung (insbesondere TIN*-Personen aller Geschlechtsidentitäten).“ Eben dieser Umdeutung folgten Grüne und SPD in ihrem Entwurf des Gewalthilfegesetzes von Dezember 2024.
NIUS fragte das Familienministerium an, ob es die Aufnahme von Menschen männlichen Geschlechts, die sich als Frauen identifizieren, in Frauenhäuser mithilfe der CEDAW-Konvention bzw. der Istanbul-Konvention rechtfertigt, und bat darum, gegebenenfalls konkrete Textstellen zu benennen. Eine Sprecherin des Ministeriums antwortete: „Das Gewalthilfegesetz bezieht sich auf Frauen, die von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt betroffen sind. Eine Definition des Begriffs ‚Frau‘ enthält das Gesetz nicht.“
In der Tat: Im inzwischen in Kraft getretenen Gewalthilfegesetz von Dezember finden sich keine Transgender-Begriffe, der Begriff „Frau“ bleibt damit juristisch an das biologische Geschlecht gebunden. Die Aufnahme von Transfrauen in Frauenhäuser wird zwar im Entwurf des Gesetzes sowie von den NGOs politisch gewünscht, ist aber im Gesetzestext nicht vorgeschrieben. Diese Diskrepanz zwischen Gesetzeslage und NGO-Statements führt zu Unsicherheit: Müssen Frauenhäuser nun Transfrauen aufnehmen? Laut dem Gesetz: nein. Laut Ministerium und NGO-Bündnis: ja. Es wäre die Aufgabe der Politik, bei sensiblen Fragen wie dem Zugang zu Schutzräumen für Gewaltopfer für klare und ehrliche Begriffsdefinitionen zu sorgen. Die gesellschaftliche Debatte sollte auf Basis von Tatsachen geführt werden – nicht auf manipulativen Umdeutungen internationaler Verträge.
Ein Frauenhaus 1984 in Mödling (Österreich)
Das Geschlecht drückt sich in der Regel unmissverständlich durch physiognomische Geschlechtsmerkmale aus, es ist materiell, nicht psychisch – keine „Seele“. Weil den modernen Verfassern der UN-Konventionen das klar war, schrieben sie ihre völkerrechtlichen Abkommen in klarer Sprache, die keinen Spielraum zulässt: Eine Frau ist darin ein weiblicher Mensch, kein Mann, der sich als Frau definiert, wie Lisa Paus gern hätte.
Dass sich auch das Gewalthilfegesetz so liest, führt dazu, dass auch Kritiker des Transkults es nicht zwingend nicht ablehnen müssen: Das Gesetz schreibt schließlich überhaupt nicht vor, Transfrauen Einlass zu Frauenräumen zu gewähren. Wer das behauptet, findet darin keine Rechtsgrundlage, sondern muss sich auf aus dem Familienministerium finanzierte Desinformation beziehen, die juristisch aber irrelevant ist.
Lesen Sie auch: Grüne Ministerin will Berichterstattung über NGO-Komplex verhindern: Lisa Paus wirft NIUS aus Veranstaltung





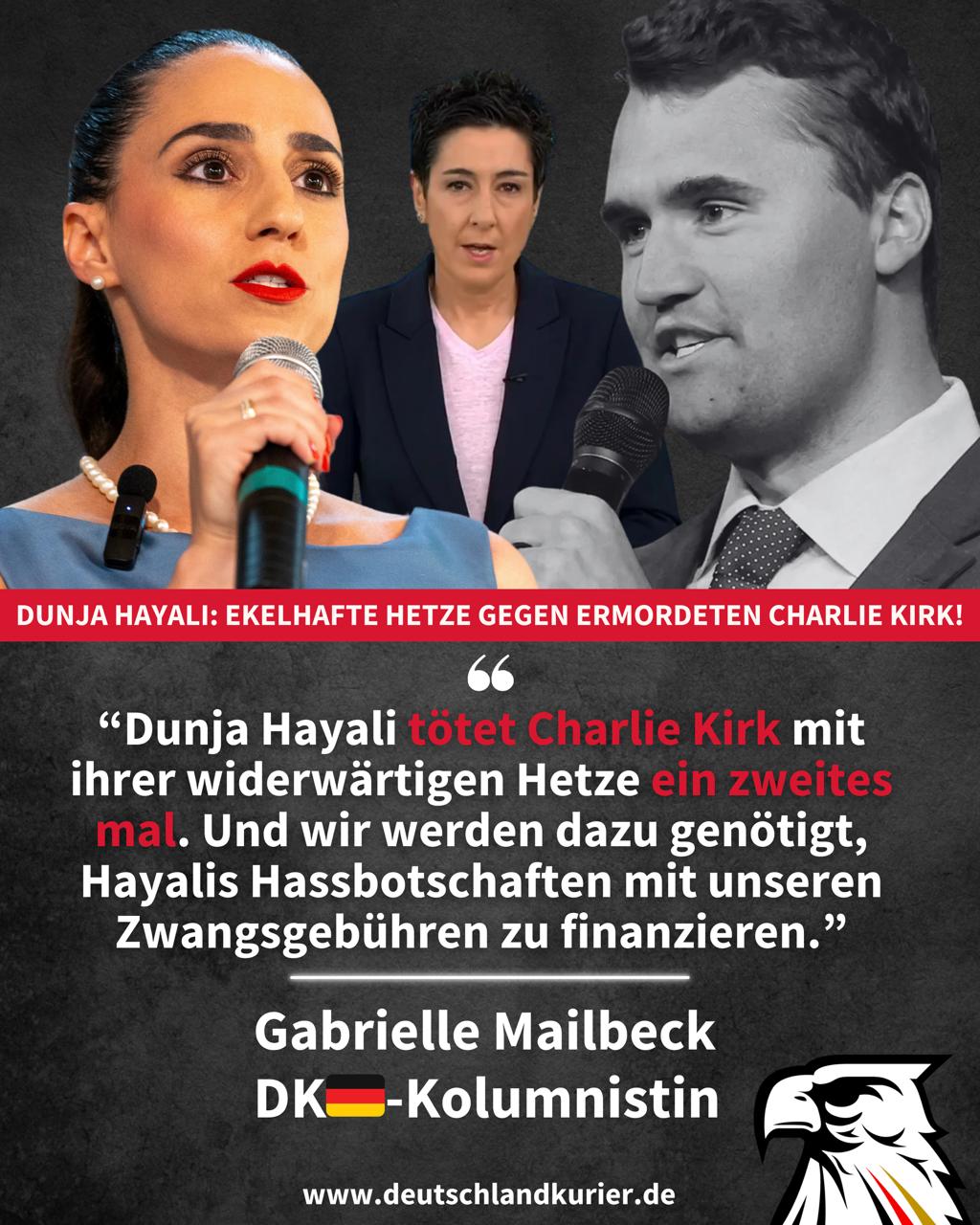




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























