
Bilder sollen die Realität abbilden. Aber sie tun noch mehr: Sie schaffen Realität. Auch durch ihre Kontextualisierung – oder das Fehlen derselben.
In unserer bildfixierten Medienwelt dienen sie daher als machtvolle Instrumente zur Meinungsbildung. Warum sah man während des US-Wahlkampfs kaum je ein vorteilhaftes Foto von Donald Trump, dafür aber so gut wie nie ein unvorteilhaftes von Kamala Harris? Warum sind in der deutschen Berichterstattung so selten Gruppen männlicher Migranten zu sehen? Was doch ins Auge fällt, sobald man deutsche Bahnhofsvorplätze oder gewisse Parks frequentiert: In der journalistischen bildmedialen Wirklichkeit kommen sie kaum vor.
Bilder prägen sich ein, und ihre subtilen – oder weniger subtilen – Botschaften gleich mit. Was nicht visuell vermittelt wird, wird hingegen oft nur unzureichend oder gar nicht wahrgenommen. Auch durch das Fehlen von Bildern wird also das kreiert, was dann als „Realität“ firmiert.
Angesichts der Informationsmassen, die vorliegen, ist die Steuerung der Meinungsbildung durch Auswahl und Auslassung unvermeidlich. Problematisch wird es jedoch, wenn zusätzlich bewusst verfälscht wird, um das gewünschte Narrativ zu platzieren. Im Deutschen bietet sich für journalistische Realitätskreation sogar ein eigenes Wort an: Relotiieren.
Zahlreiche internationale Medien veröffentlichten kürzlich das Bild einer palästinensischen Mutter, die ihren abgemagerten Sohn im Arm hält; unter anderem die New York Times, der britische Guardian, CNN. Die Wirbelsäule des Kindes ragt Wirbel für Wirbel hervor. Nur noch Haut und Knochen. Ältere Betrachter erinnert das an die Hungersnöte in Äthiopien in den Achtzigern oder im Sudan in den Neunzigerjahren.
Das ganze Elend der Hungerkatastrophe in Gaza in einem Bild. So titelt denn auch die Zeit: „So sieht Hunger aus.“
Vermeintlich. Tatsächlich leidet das Kind unter einer schweren neurologischen Erkrankung, was die Abmagerung erklärt. Der Blogger David Collier hat die Herkunft des Bildes recherchiert. Er zeichnet die Veröffentlichungsgeschichte nach, und berichtet, was dahintersteckt.
Unter anderem zeigt er eine Aufnahme, auf der auch der dreijährige Bruder des Kindes zu sehen ist. Ein Kleinkind, gezeichnet von einer Lebenssituation, in die kein Kind hineingestellt sein sollte, aber nicht annähernd ähnlich abgemagert. Der Gesamtkontext des Fotos vermittelt also eine andere Botschaft als die Bildausschnitte, die die verantwortlichen Journalisten ausgewählt haben.
Es ist nicht das erste Mal, dass kranke Kinder instrumentalisiert werden, um die Situation in Gaza möglichst dramatisch darzustellen.
Der Fotograf, Ahmed al-Arini, sagte gegenüber der BBC, dass er „dem Rest der Welt den extremen Hunger zeigen“ wolle, unter dem Kinder in Gaza leiden. Auch er hat also bewusst getäuscht, um den Eindruck zu erwecken, den er erzielen will.
Im Nahostkonflikt sind Bilder unverzichtbarer Teil der Propagandamaschinerie. Auf beiden Seiten, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Das liegt an einer eklatanten Schieflage. So werden etwa in Israel regelmäßig Terroranschläge verübt. Falls über diese berichtet wird, so fehlen Bilder, die beim Zuschauer Empathie wecken: Israelische Opfer, Waisenkinder, die ihre Eltern verloren haben, Eltern, die um ihre Kinder trauern. Große traurige Augen von palästinensischen Kindern hingegen dominieren die Berichterstattung aus dem Gazastreifen, nicht die schwarz vermummten Hamaskämpfer, die die eigene Bevölkerung terrorisieren.
Hinzu kommt, dass Informationen, die von Israel bereitgestellt werden, mit Argwohn betrachtet werden, während Informationen von palästinensischer Seite als Tatsachen gelten.
Zumal Journalisten in Israel recherchieren und kritisch berichten können. In Gaza sind keine westlichen Journalisten vor Ort. Informationen werden von der Hamas generiert oder kontrolliert: Wie viele der in Gaza agierenden „Journalisten“ zugleich Hamas-Sympathisanten oder -Mitglieder sind, weiß wahrscheinlich nicht einmal der Mossad. Und ohne Duldung durch die Hamas könnte hier niemand journalistisch tätig sein.
Die manipulative und lügnerische Berichterstattung ist nicht nur gegenüber Israel ungerecht, sondern auch gegenüber dem Konsumenten von Nachrichten. Wer angesichts der gesund wirkenden Eltern und Geschwister der abgemergelten Kinder Zweifel am Hungerkatastrophe-Narrativ äußert, wird beschuldigt, zynisch und mitleidslos zu sein. Wirklich zynisch ist jedoch, wer nicht davor zurückschreckt, schwerstbehinderte Kinder zu benutzen.
Und schließlich ist sie auch die Palästinenser selbst betreffend schädlich. Denn Falschdarstellungen erleichtern es, sämtliche Berichte aus Gaza als Propagandalügen zu verwerfen – womit echtes Leid auf palästinensischer Seite aus dem Blick gerät.
Diese Gemengelage ist für Beteiligte und Beobachter überfordernd. Sie müsste jeden, der über den Nahen Osten berichtet, in höchste Demut versetzen und zu größter Vorsicht und Zurückhaltung mahnen.
Doch das Gegenteil ist der Fall: Statt die Komplexität des Konflikts zu unterstreichen, und die Ungewissheit einer jeden Information, die uns aus dem Nahen Osten erreicht, wird bewusst mit Desinformation gearbeitet.
Vor diesem Hintergrund legt die Bereitschaft, für die Platzierung der eigenen Botschaft schwerstkranke Kinder zu instrumentalisieren, völlige Gewissenlosigkeit offen.
Mittlerweile haben sich die New York Times und auch die Zeit zumindest teilweise korrigiert und Kontext bereitgestellt. Das ist nicht plötzlich erwachtem journalistischem Ethos zu verdanken, sondern maßgeblich der Arbeit eines Bloggers. Und natürlich den dezentralen Plattformen wie X, die Menschen wie ihm Reichweite verleihen. Wenn Journalisten und Medien darüber klagen, dass Zuschauer und Leser ihnen das Vertrauen entziehen, ist das keineswegs verwunderlich.



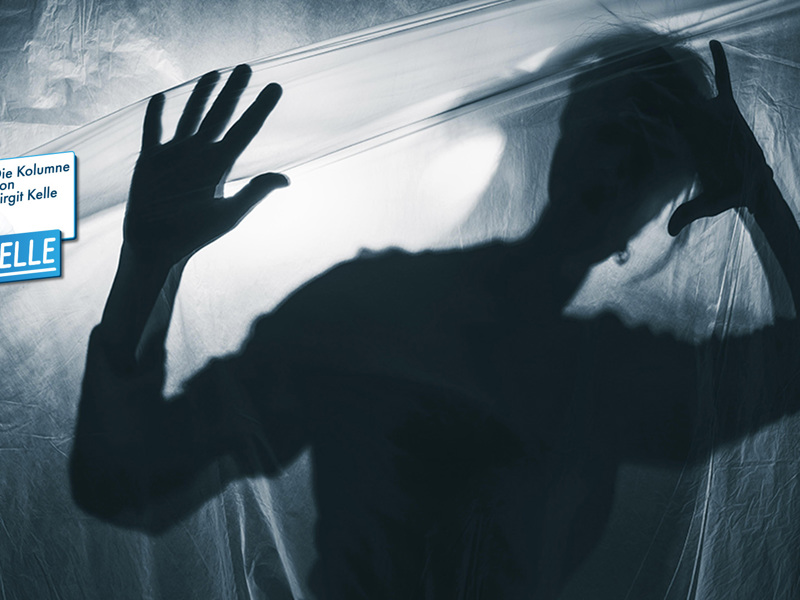



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























