
Der Kriegsfilm ist ein dankbares Genre für Filmemacher. Er bietet die Möglichkeit zu großen Bildern und reichlich Action. Vor allem aber handelt das Genre von dem größten Thema des Menschen nach der Liebe: dem Tod. Außerdem ermöglicht der Kriegsfilm dem, der das will, ein einfaches Freund-Feind-Schema. Entsprechend überschlug sich Hollywood nach dem gewonnenen Zweiten Weltkrieg mit erfolgreichen Epen wie: „Der längste Tag“ oder „Sands of Iwo Jima“.
Letzterer trug den unglücklichen, weil wenig aussagekräftigen, deutschen Titel „Du warst unser Kamerad“. Die Hauptrolle spielte John Wayne. Bereits im Jahr 1945 war der Westernstar in Kriegsfilmen wie „Stahlgewitter“ oder „Schnellboote vor Baatan“ zu sehen. Hollywood konnte und wollte gar nicht lange darauf warten, den Ruhm der erfolgreichen Soldaten zu Geld an der Kinokasse umzumünzen.
Dokumentationen über den Vietnamkrieg zeigen, dass für viele amerikanische Soldaten Wayne und „Sands of Iwo Jima“ wichtige Rollenmodelle boten, als sie selbst ab 1964 zum Einsatz in ein Land zogen, das ihnen fremd war. Sie waren Vertreter einer Siegergeneration, die keine militärischen Niederlagen kannte und der es entsprechend leicht fiel, sich mit der Rolle des tapferen wie pflichtbewussten Soldaten zu identifizieren, die der – fast schon selbstverständlich ungediente – John Wayne verkörperte.
Doch der Vietnamkrieg veränderte die USA. Der Optimismus und die Siegermentalität der 50er und frühen 60er Jahre waren verloren; es herrschte Zweifel an der eigenen Kraft und vor allem an der Integrität der eigenen Eliten. Ausgelöst etwa durch Dokumente, die belegen, wie fahrlässig die politisch Verantwortlichen ihre Soldaten in Vietnam in den unnötigen Tod laufen ließen. Dieses Misstrauen darzustellen, war eines der Elemente, die das „New Hollywood“ ausmachten. Selbst zu Blockbustern wie „Der Weiße Hai“ gehörte die Kritik an der korrupten Führung, hier der Bürgermeister, die durch korruptes Verhalten Menschen in den Tod treiben.
Ende der 70er Jahre griff New Hollywood den Vietnamkrieg auf, damit gleichzeitig die gesellschaftliche Wurzel seines eigenen Entstehens. Fast zeitgleich entstanden zwei Meisterwerke von einer elementaren Wucht, die in ihrem Zynismus und Pessimismus allerdings auch schwer zu ertragen sind. Zuerst kam 1978 „The Deer Hunter“ ins Kino. Auch hier versuchte sich der deutsche Filmverleih mit einem reißerischen Titel, der am Ende nichts besagt: „Die durch die Hölle gehen“. Robert De Niro führt als Stahlarbeiter seine Kumpels durch den Vietnamkrieg, indem er beim Russischen Roulette alles riskiert und ihr Leben gewinnt – aber an diesem scheitern danach alle drei.
Apocalypse Now entstand zeitgleich mit „The Deer Hunter“. Durch eine unglaubliche Serie von Pannen, der Hauptdarsteller erlitt während des Drehs einen Herzinfarkt und Stürme vernichteten mehrfach das Set, kam dieser aber erst 1979 ins Kino. Manche sagen, dass die Dokumentation über die Dreharbeiten das bedeutendere Werk als der Film selbst sei. Mag sein. Apocalpyse Now gehört dennoch zu den größten Filmen aller Zeiten. Wenn das Kriegsboot auf dem Mekong Richtung unbekanntem Feind fährt und dazu im Hintergrund „This is the End / My only friend / The End“ von den Doors läuft, bleibt keiner unberührt, der Kino liebt.
Hauptmann Willard (Martin Sheen) erhält den Auftrag, in die Tiefen des Dschungels, den die Army nie wirklich beherrscht hat, zu reisen, Oberst Kurtz (Marlon Brando) zu finden und zu töten. Der ist desertiert und hat im Dschungel ein eigenes Terrorregime aufgebaut. New Hollywood hat – unter anderem – die Sichtweisen geändert. Etwa durch den Weißen Hai: Die Bedrohung wirkt umso größer, je länger sie nicht zu sehen ist. Je mehr Willard im Off von Kurtz spricht, desto größer scheint er dem Zuschauer.
Wobei Apocalypse Now eine Quest darstellt. Die klassische Idee eines Helden, der sich aufmacht, um ein Abenteuer zu erleben. Nur dass Regisseur Francis Ford Coppola diese Idee gleich zu Beginn ad absurdum führt, indem er Willard als heruntergekommenen Mann zeigt, der in einem letztklassigen Hotelzimmer darüber sinniert, dass er selbst umso schwächer und der Vietkong umso stärker wird, je länger er in diesem Hotelzimmer liegt.
Kilgore ist ein begeisterter Surfer. Als er in Willards Team einen Gleichgesinnten entdeckt, lässt er ein eigentlich verbündetes Dorf angreifen. Weil die Wellen hinter diesem Dorf so günstig sind. Als die Bewohner Widerstand leisten und das Surfen somit erschweren, lässt Kilgore das Dorf mit Napalm vergiften. Eine offensichtliche Gräueltat an den Bewohnern. Wie 1979 bereits bekannt war, setzte er damit seine eigenen Soldaten ebenfalls einer hohen Krebsgefahr aus. Willard stellt sich zum ersten Mal die Frage, warum die Army Kurtz töten will, wenn sie Kilgore gewähren lässt.
Die Figur des Oberst Kilgore ist es auch, die den berühmten Satz ausspricht, dass er den Geruch von Napalm am Morgen liebe. Jenen Satz, an den sich nun Donald Trump anlehnt, wenn er sagt, dass er den Geruch von Abschiebungen am Morgen liebe. Der amerikanische Präsident steht auch für gute Werte wie die Verteidigung der Freiheit, er hat schon bewiesen, dass er ein Gespür für PR hat und er ist nicht trotz seiner politischen Unkorrektheit mindestens zweimal gewählt worden – sondern wegen ihr. Trotzdem zeugt diese Aussage von einer dramatischen Dummheit und offenbart eine mangelhafte Fähigkeit, Dinge richtig einzuordnen.
Aktuell schickt er amerikanische Soldaten in von den Demokraten geführte amerikanische Großstädte, weil die Stadtregierungen vermeintlich die Sicherheitslage nicht mehr im Griff haben. Wer dies tun und die Bevölkerung von der Not seines Handelns überzeugen will, sollte verantwortungsvoll wirken. Trump stellt sich dabei aber selbst in die Tradition eines verlotterten Wahnsinnigen, der aus privatem Vergnügen und Machtrausch Menschen töten lässt, deren Schutz eigentlich seine Aufgabe wäre. Oberst Kilgore wird nicht von John Wayne dargestellt, sondern von einem der größten Charakterdarsteller der USA. Wobei. Eigentlich wollte Robert Duvall klarmachen, dass man seine Figur auf gar keinen Fall nachahmen sollte – zumindest am PotUS ist er damit gescheitert. Für New Hollywood ist der Kriegsfilm dann doch, zumindest nachträglich gesehen, kein dankbares Genre.
Weitere Beiträge zur Serie „Alte Filme neu geschaut“ von Mario Thurnes finden Sie in unserem monatlich im Zeitschriftenhandel erscheinenden Magazin „Tichys Einblick“.





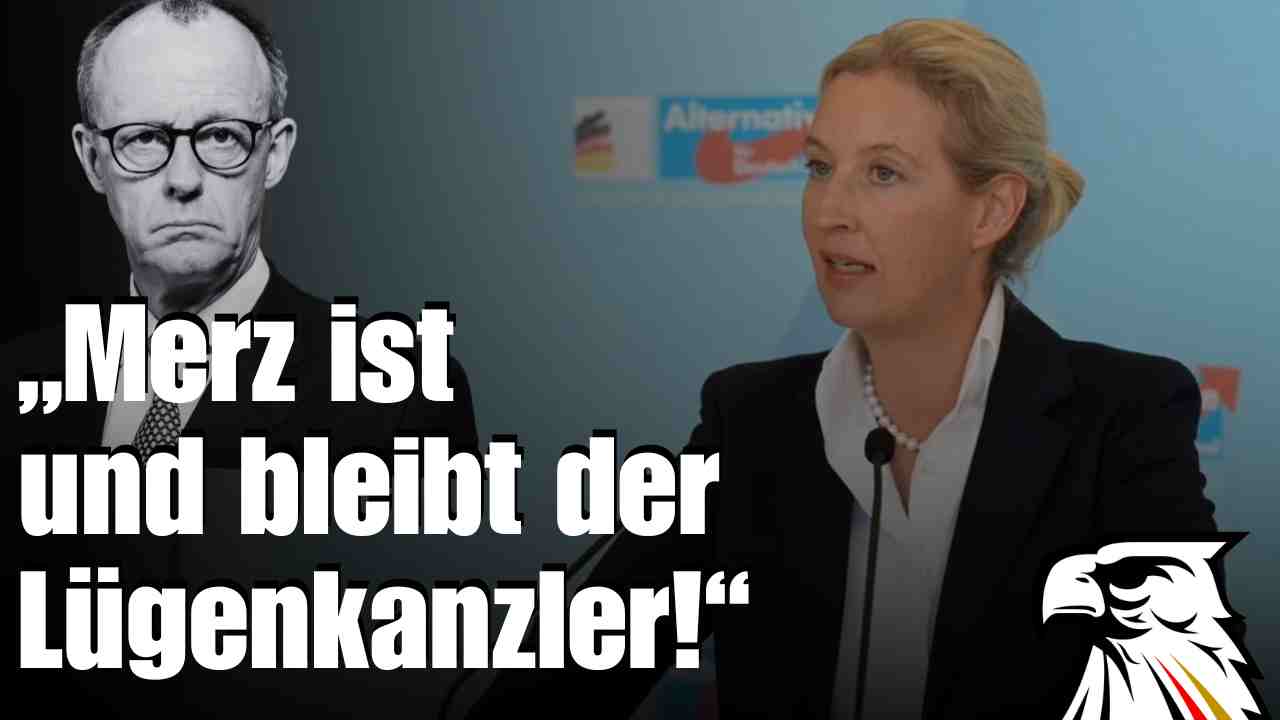


 FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE
FRANKREICH: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage! Droht Macron nun der Rücktritt? | LIVE






























