
Der amerikanische Präsident Donald Trump will ab dem 1. August auf Importe aus allen EU-Ländern in die USA Strafzölle von 30 Prozent erheben. Diese Zölle sollen auf eine breite Palette von Produkten entfallen: auf Autos und Autoteile, Maschinen und Metallwaren, Kunststoffe und Chemikalien. Im Moment liegt auf den Exporten aus EU-Ländern in die USA ein Basiszoll von 10 Prozent. Der ist für die deutschen Exporteure noch einigermaßen verkraftbar – läge er aber bei 30 Prozent, dann sähe die deutsche Exportwelt ganz anders aus. Dann drohten der deutschen Industrie Verwerfungen, die wir so noch nicht gesehen haben.
Passieren könnte nämlich das: Die Exporte in die USA könnten um 30 bis 40 Prozent einbrechen – das entspricht einem Verlust von 50 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde 2025 bis 2028 im Schnitt um 1,1 Prozent niedriger ausfallen, was einer Dauerrezession entspräche. Besonders hart träfe es die Autoindustrie, für welche die USA der wichtigste Markt außerhalb Europas sind, sowie den Maschinenbau. Insgesamt könnte sich der Schaden nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (iW) bis 2028 auf 200 Milliarden Euro summieren. Hinzu kommt eine gefährliche Sekundärwirkung: Gegenzölle der EU und eine Dumpingwelle aus China (das selbst unter hohen amerikanischen Importzöllen leidet) würden den Druck auf den europäischen Markt weiter verschärfen.
Exporte in die USA könnten um 30 bis 40 Prozent einbrechen, besonders hart träfe es die Autoindustrie.
Wenn wir uns jetzt kurz erinnern, dass das deutsche BIP zwischen 2000 und 2024 pro Jahr im Schnitt real um mickrige 0,8 Prozent gewachsen ist, für das laufende Jahr ein Nullwachstum erwartet wird und erst 2026 überhaupt wieder von einem Wachstum von einem Prozent ausgegangen wird – dann könnten Trumps Strafzölle für wahrhaft apokalyptische Aussichten sorgen. Insbesondere für Rentner, Bürgergeldbezieher, Arbeitslose und Migranten, die hauptsächlich von Transferzahlungen leben.
Aber muss das so kommen? Wird über die deutsche Wirtschaft auf Jahre hinaus ein Schatten fallen? Wird der Bundeshaushalt, der bereits heute nur mit einer Schuldenorgie, die sich euphemistisch „Sondervermögen“ nennt, finanzierbar ist, irgendwann gar nicht mehr zu bezahlen sein? Werden wir also den Weg Japans und Frankreichs gehen, zweier Länder, bei denen der Staat sich andauernd in die Wirtschaft einmischt und wo ganze Sparten der Gesellschaft (in Frankreich die Beamten, in Japan die Reisbauern) am Dauertropf des Staates hängen?
Ehrliche Antwort: Wenn die EU nicht bald etwas unternimmt und sich mit Trump ins Benehmen setzt: ja. Wenn die Bundesregierung es weiterhin bei scheinheiligen Beschwichtigungen und Sonntagsreden (Außenminister Wadephul: „Zölle helfen niemandem“) belässt, dann auf jeden Fall. Und wenn wir die Zukunft unseres Außenhandels mit den USA einem mittelmäßig erfolgreichen EU-Funktionär wie dem Slowaken Maroš Šefčovič anvertrauen, der in den letzten Monaten sechsmal in den USA war, aber jedes Mal mit leeren Händen zurückgekommen ist, dann sowieso.
Lesen Sie dazu auch: Die Zukunft der deutschen Volkswirtschaft liegt in den Händen dieses slowakischen Kommunisten
Außenminister Wadephul: „Zölle helfen niemandem.“
Möglicherweise lässt sich da noch was machen. Donald Trump ist, wie wir wissen, ein harter Verhandler, aber auch einer, mit dem man einen Deal machen kann. Vielleicht ist Trump ja, wie ein amerikanisches Sprichwort sagt, „all bark and no bite“ (viel Gebell, aber kein Biss). Wenn wir uns die letzten Zollverhandlungen der Regierung Trump ansehen, die von Howard Lutnick, dem U.S. Secretary of Commerce (Handelsminister), und Scott Bessent, dem U.S. Secretary of the Treasury (Finanzminister), geführt wurden, dann gibt es für Deutschland konkrete Hoffnung, dass nicht alles so schlimm kommen muss, wie es scheint.
Das sehen wir am besten, wenn wir in andere Teile der Welt blicken. Dort hatte Trump in den vergangenen Monaten drastische Zölle angekündigt: für Kanada 25 Prozent auf Autos, Autoteile, Stahl und Energieprodukte, für China bis zu 60 Prozent auf Industrieimporte und sogar 100 Prozent auf bestimmte Hightech-Güter, für Japan 27,5 Prozent auf Autos sowie 20 bis 25 Prozent auf Elektronik und Maschinen, für die Philippinen 20 Prozent auf Industrie- und Agrarwaren und für Indonesien sogar 32 Prozent auf Industrieimporte.
Donald Trump ist, wie wir wissen, ein harter Verhandler, aber auch einer, mit dem man einen Deal machen kann.
So ist es aber trotz vielem Getöse in den Medien nicht gekommen: Trump hat zwar wild gebellt – aber richtig zugebissen hat er nicht. Die heute geltenden Zölle liegen deutlich niedriger als die vorher angedrohten: Kanada zahlt zwar weiterhin 50 Prozent auf Stahl und Aluminium, aber keine Autozölle; China wurde auf einheitliche 10 Prozent für fast alle Waren zurückgestuft (Stahl und Aluminium bleiben bei 50 Prozent); Japan einigte sich auf 15 Prozent für Autos und viele Industriegüter; die Philippinen und Indonesien kamen nach Deals jeweils bei rund 19 Prozent heraus.
Ein gutes Beispiel für Trumps gewiss wechselhafte, aber in der Endkonsequenz erfolgreiche Zollpolitik stellt Japan dar. Die USA und Japan sind einander ja auf dem Handelssektor in wechselseitiger Hassliebe innig zugetan. Den Grund kennt jeder: Japan exportiert seit Jahrzehnten mehr als doppelt so viel in die USA wie umgekehrt. Ein nie abreißender Strom von Autos, Blu-ray-Playern, Nintendo-Konsolen, Fernsehern und Spezialchemikalien fließt jedes Jahr in die USA, während aus den USA vom Wert her gerade einmal die Hälfte davon in Form von Flüssiggas, Rindfleisch, Sojabohnen, Baumaschinen und Komponenten für Computerchips nach Japan geht. Für Japan sind die USA nach China der wichtigste Exportmarkt weltweit, ein Fünftel der japanischen Exporte ging 2024 in die USA. Ohne den amerikanischen Markt wäre die japanische Wirtschaft, die seit Jahrzehnten kaum noch wächst, längst am Ende. Trump ärgert dieses Ungleichgewicht seit Jahrzehnten, bereits 1987 sagte er in einem Interview mit dem legendären TV-Host Larry King: „Das Land [die USA] verliert [durch sein Außenhandelsdefizit] zweihundert Milliarden Dollar pro Jahr, Japan ist eine der reichsten Maschinen, die je geschaffen wurden, sie lachen sich ins Fäustchen, Larry.“
Und jetzt, als Präsident im zweiten Anlauf, hat er es geschafft. Die USA und Japan haben sich auf einen Handelsdeal geeinigt, der reziproke (wechselseitige) Zölle von 15 Prozent festlegt und damit die ursprünglich angedrohten 25 Prozent vermeidet. Japan verpflichtet sich außerdem, 550 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, wovon die USA 90 Prozent der Gewinne erhalten sollen, und öffnet seinen Markt für Autos, Lkw, Reis und weitere Agrarprodukte. Zudem werden die Autozölle auf 15 Prozent gesenkt, während Stahlzölle unverändert bei 50 Prozent bleiben.
Der Deal bei den Zöllen zwischen den USA und Japan könnte ein Vorbild sein für einen ähnlichen Deal zwischen der EU und den USA. Die Frage ist nur: Kann und will die EU das? Und wenn sie es nicht kann: Was passiert dann genau – erstens mit der EU-Wirtschaft und zweitens mit der deutschen Wirtschaft (die bekanntlich 25 Prozent vom EU-Haushalt bezahlt)? Denn bis heute ist keineswegs klar, ob die EU mit einer Frau von der Leyen an der Spitze, die noch nie in ihrem Leben als taffe Verhandlerin aufgefallen ist, und einem Maroš Šefčovič, der in seinen zahllosen EU-Posten (EU-Kommissar Bildung/Kultur 2009–2010, Vizepräsident EU-Kommission 2010–2014, Energieunion 2014–2019, Interinstitutionelle Beziehungen 2019–2023, Green Deal 2023–2024, Handelskommissar seit 2024) noch nie einen Durchbruch erzielt hat, das ebenfalls hinkriegt.
Mir wird, bitte entschuldigen Sie den starken Ausdruck, schon ganz schlecht, wenn ich in einer weltbekannten Frankfurter Zeitung mit offenkundigem Beifall einen Artikel lese, der den Titel trägt: „Brüssel bereitet seine schärfste Handelswaffe vor.“ Mit der Waffe ist das Anti-Coercion-Instrument (ACI) der EU gemeint. Hinter diesem lächerlichen Namen, der Anti-Zwangs-Instrument bedeutet, verbirgt sich die nukleare Option der EU. Diese atomare Zollbombe besteht aus zwei Listen mit unterschiedlichen Zöllen auf Güter, die aus den USA in die EU eingeführt werden. Auf der ersten Liste stehen Jeans, Motorräder und Whiskey aus den USA, die – sollte Trump ab dem 1. August wirklich 30 Prozent Zölle auf alle Einfuhren aus der EU verhängen – im Gegenzug dann mit 25 Prozent Zöllen belegt werden. Hilft auch das nicht, dann kommt die zweite Liste zum Einsatz. Auf dieser stehen Flugzeugteile, Bourbon-Whiskey und Autos, auf die dann ebenfalls 30 Prozent Einfuhrzölle erhoben werden, solange die Einfuhrzölle der USA weiter bei 30 Prozent bleiben.
US-Jeans-Marken würden zu den Gütern gehören, die mit 25 Prozent Zöllen belegt werden, sollte US Präsident Trump am 1. August Ernst machen.
Schützenhilfe erhalten die Handelsstrategen der EU von den Volkswirten des iW, die glauben, dass die EU gegen Trump gute Karten in der Hand hat. Die Experten des iW wissen nämlich: Trotz Trumps Drohungen ist die EU im Zollstreit stärker als oft angenommen. Die USA sind massiv von europäischen Vorleistungsgütern wie Maschinen, Chemie und Pharma abhängig, die kaum ersetzbar sind. Nur rund 10 Prozent der deutschen Exporte gehen in die USA, während 65 Prozent im europäischen Markt bleiben – die Abhängigkeit ist also geringer als gedacht. Mit klaren Gegenzöllen und einer Strategie zur Stärkung des Binnenmarkts kann die EU Trump wirksam Paroli bieten.
Das halte ich für sehr fragwürdig, denn: Rache ist nie eine gute Strategie. Schon gar nicht, wenn es um den Wohlstand der 448 Millionen Einwohner in den 27 Mitgliedstaaten der EU geht. Deren wirtschaftliche Zukunft kann nicht auf der Basis primitiver Vergeltungszölle massiv beeinflusst werden. Hier sind Verhandlungsgeschick, Intelligenz und eine strategische Vision für die nächsten 20 Jahre gefragt.
Diese Aussage ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ausgerechnet das iW noch im April dieses Jahres errechnet hat, dass das deutsche BIP 2025 bis 2028 ohne Vergeltungszölle gegen die USA pro Jahr 1,2 Prozent niedriger wäre als ohne – und mit Vergeltungszöllen sogar 1,6 Prozent niedriger. Um das klar zu sagen: Das wäre ein Weltuntergangsszenario für die deutsche Wirtschaft. Minus 1,6 Prozent jedes Jahr, vier Jahre lang, würde bedeuten: Wir schlittern in eine jahrelange Dauerrezession, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben hat.
Im Hafen von Barcelona, einem der größten in Europa, sieht man viele Container und Frachtschiffe. Das könnte sich ändern, der Welthandel ist wegen möglicher Zölle unsicher, was die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA enorm stören könnte.
Hier sind alle Rezessionsjahre seit Gründung der Bundesrepublik:
1967 (–0,3 %), 1974 (–0,7 %), 1975 (–0,9 %), 1981 (–0,4 %), 1982 (–0,4 %), 1993 (–1,0 %), 2003 (–0,7 %), 2009 (–5,7 %), 2020 (–4,6 %), 2023 (–0,3 %), 2024 (–0,2 %, vorläufig).
Was fällt Ihnen auf? Richtig: Es hat nie vier Jahre in Folge gegeben mit einem BIP-Rückgang von 1,6 Prozent. An solchen Szenarien zeigt sich, wie „gut“ die Idee war, die wirtschaftliche Zukunft von fast einer halben Milliarde Menschen einem EU-Kommissar und Berufsbürokraten zu überlassen, dessen Name keiner kennt und der lebenslang nie speziell erfolgreich war.
Aber so wird es glücklicherweise nicht kommen. Aus heutiger Sicht wird die EU die große Keule mit dem Anti-Coercion-Instrument nicht schwingen müssen. Alles sieht danach aus, dass Amerika und Europa sich auf die Formel „15 Prozent auf alles bis auf Stahl und Aluminium“ (worauf weiterhin 50 Prozent Zölle entfallen) einigen werden. Sollte es so kommen (was ich annehme), dann wäre das Schlimmste von der deutschen Wirtschaft abgewendet, aber ein Grund zur Freude ist das natürlich nicht.
Werden deutsche Autos und Autoteile, Maschinen, Elektrogeräte, Chemikalien, Kunststoffe und Pharmazeutika ab August auf Jahre hinaus mit 15 Prozent Einfuhrzöllen beim Export in die USA belegt, dann wird auch das schwerwiegende Folgen für uns alle haben. Zwar gehen nur neun Prozent der deutschen Exporte mit einem Warenwert von 157 Milliarden Euro in die USA (zum Vergleich: 58 Prozent gehen in die übrige EU und 6,5 Prozent nach China), aber davon könnten 40 bis 50 Milliarden verloren gehen, hauptsächlich an Wettbewerber aus Asien. BMW, Mercedes-Benz und VW müssten eventuell Werke schließen oder in die USA verlagern, Maschinenbauer im Süden und Südwesten müssten Stellen abbauen, die Gewinne der DAX-Unternehmen würden sinken, die Aktienkurse nachgeben und Löhne und Gehälter zukünftig stagnieren.
Mercedes-Benz Werk Rastatt. Werden deutsche Autobauer mit 15 Prozent Einfuhrzöllen beim Export in die USA belegt, werden viele Werke schließen oder die Produktion in die USA verlegen.
All das kommt zur schlechtesten Zeit für die deutsche Wirtschaft, die – ausgelaugt von den Corona-Jahren und konfrontiert mit den höchsten Energiepreisen, den höchsten Unternehmenssteuern und den höchsten Löhnen der Welt – zukünftig eigentlich wie ein Uhrwerk laufen müsste, um die vielen Transferleistungen zu finanzieren und die Zinsen für die stetig steigende Bundesschuld zu bezahlen.
Weder die deutsche Politik noch die Wirtschaft waren auf eine zweite Amtszeit Donald Trumps vorbereitet. Jetzt rächt sich, dass wir keine Industriepolitik und keine Wirtschaftsstrategie für die nächsten Jahre haben. Jetzt fliegt uns die ewige Wirtschaftsfeindlichkeit von Grünen und SPD um die Ohren. Jetzt fällt uns auf, dass wir – mit der Ausnahme von SAP – keinen modernen Technologieriesen haben wie die USA, dass wir auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz nichts zu sagen haben, weder über Unternehmen noch Produkte dazu verfügen. Jetzt müsste uns auffallen, dass mit Wärmepumpen, Windrädern und Solardächern gegen China und die USA, wenn es hart auf hart geht, nichts zu holen ist.
Unternehmen, Staaten und Gesellschaften geraten in existenzielle Krisen, wenn sie – durch jahrelange Vernachlässigung, Auszehrung der Reserven und Schwund der Wettbewerbsfähigkeit geschwächt – plötzlich mit einem massiven externen Schock konfrontiert werden. Die Trump-Zölle sind ein solcher Schock. Auf den wir nicht vorbereitet sind.
Lesen Sie auch von Markus Brandstetter:Sondervermögen für Infrastruktur: Warum die Milliarden-Offensive von Friedrich Merz scheitern wird






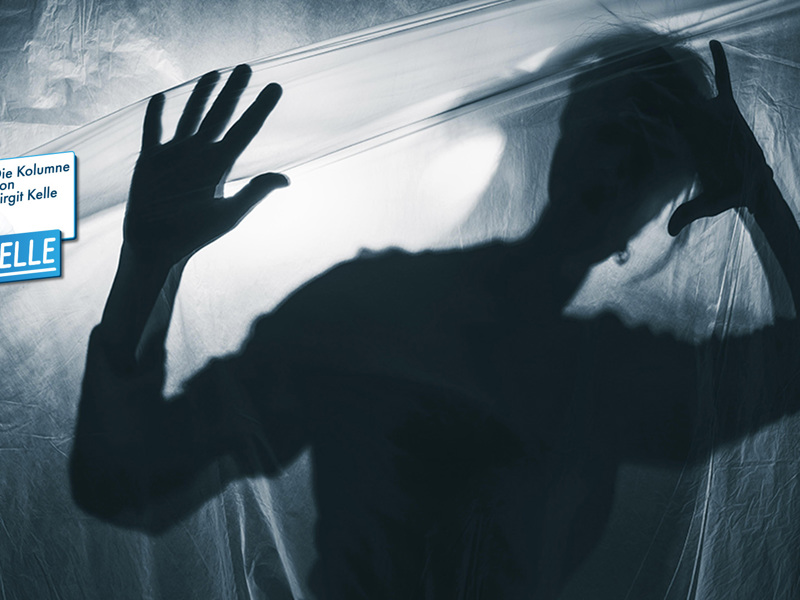


 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























