
Manchmal würde als Artikel eigentlich ein Zweizeiler genügen, um das Wesentliche zu sagen: Ein derzeitig von der ungarischen Opposition unter die Leute gebrachter und als Sensation verkaufter Tonmitschnitt eines internen Vortrags des ungarischen Verteidigungsministers Kristóf Szalay-Bobrovnicky enthält nichts anderes als die offizielle Doktrin der ungarischen Armee, wie sie vor rund zwei Jahren von ihm geändert wurde. Aus seiner damaligen Erklärung der Veränderungen stammt der Tonmitschnitt. Der Inhalt, von Oppositionschef Péter Magyar irreführend als geheim dargestellt, wurde bereits damals auf der offiziellen Webseite der Regierung veröffentlicht.
Der Zweizeiler zum Thema:
Ungarn rüstet seit 2023 massiv auf, und fasst angesichts des Ukrainekrieges den Ernstfall ins Auge – dass Krieg nicht mehr Theorie ist, sondern bittere Realität in Europa.
Die Langfassung:
Eigentlich begann die Geschichte bereits 2014, als Russland die Krim besetzte und im Osten der Ukraine russische Rebellen, unterstützt und angestachelt von Russland selbst, einen Krieg gegen die ukrainische Regierung vom Zaun brachen. Die Lage wurde auf einer Regierungssitzung in Budapest erörtert, in der der damalige Verteidigungsminister durch seinen damaligen Staatssekretär Attila Demko vertreten wurde. Der trug vor, dass im Ernstfall – wenn irgendjemand von Osten her Ungarn angreifen wollte – das Land dem nichts entgegenzusetzen hätte. Der Feind wäre dann binnen kürzester Zeit in Budapest. „Wir müssen aufrüsten”, sagte er. „Nicht um der Nato zu gefallen, sondern in unserem eigenen Interesse”.
Am nächsten Tag wurde das Verteidigungsministerium aufgefordert, eine Liste seiner Wünsche aufzustellen.
Ungarn ist kein Einzelfall: All jene EU-Länder, die einst dem Warschauer Pakt angehört hatten, verfügten damals über miserabel schwache Armeen mit veralteten sowjetischen Waffensystemen. An Modernisierung hatte man nicht viel Aufmerksamkeit verschwendet: Wozu? Krieg würde es sowieso nicht mehr geben, dringender war es, Wirtschaft und Infrastruktur zu modernisieren. Aber nun begann ein großes Umdenken in den EU-Ländern, die früher dem kommunistischen Block angehört hatten.
Dieser Modernisierungsschub – vor allem mit deutschen Waffensystemen – erreichte in Ungarn seit 2023 seinen vorläufigen Höhepunkt. Ein neuer Verteidigungsminister sollte Schwung in den Laden bringen: Kristóf Szalay-Bobrovnicky. Zu seinen Plänen gehörte unter anderem eine personelle Erneuerung, um nicht nur die Bewaffnung, sondern auch die Kultur und Mentalität der Armee zu ändern. Jung, kampfbereit, patriotisch, eine Armee die Krieg nicht als abstrakte Möglichkeit, sondern unter den derzeitigen geopolitischen Umständen fast schon als Wahrscheinlichkeit betrachtete. In diesem Sinne löste Szalay-Bobrovnicky auch den damaligen behäbigen Generalstabschef Romulusz Ruszin-Szendi ab und ersetzte ihn durch Gábor Böröndi – Ruszin-Szendi will freilich Rache: Er lief über zu Oppositionsführer Péter Magyar.
Sich auf einen echten Krieg vorbereiten: Genau so oder ähnlich ging und geht man seit dem Ukraine-Krieg in Deutschland, Frankreich und England vor. Der britische Armee-Chef Roland Walker etwas sagte im Juli 2024, England müsse für einen „Krieg bereit sein in drei Jahren”.
Diese neue ungarische Doktrin, die personelle Verjüngung, die mentale Neujustierung auf nationale Interessen, also Landesverteidigung, ohne sich dabei auf die Nato verlassen zu müssen, das alles wurde damals, 2023, offiziell veröffentlicht.
Die „Enthüllung” ist also gar keine, wird aber dennoch dazu verwendet, den Eindruck zu erwecken, als wolle Ungarn aktiv einen Krieg anzetteln. Insbesondere Ruszin-Szendi forciert diesen Spin, indem er das Zitat heraushebt, die Armee müsse eine Schlagkraft erreichen wie in einer „Phase Null auf dem Weg zum Krieg”, und diese Aussage als „Fachmann“ sprechend so wertet, als könne dies nur die Vorbereitung eines echten Krieges bedeuten. Gegen wen? Gegen die Ukraine – so wird es von der Opposition suggeriert.
Das ist, mit Verlaub, objektiv Unsinn. Ein Angriff Ungarns gegen die Ukraine wäre militärisch und politisch für Ungarn selbst mit untragbaren Risiken verbunden, ein Himmelfahrtskommando. Orbán neigt nicht zu unrealistischer Politik. Der politische Reiz, diese Geschichte jetzt aufzuwärmen, besteht für Péter Magyar darin, dass die Regierung in ihrer politischen Kommunikation immer von ihren Friedensbetrebungen bezüglich des Ukraine-Krieges spricht. Dem scheinen die Worte des Verteidigungsministers zu widersprechen, denn er spricht davon, mit „unseren bisherigen Friedensbestrebungen” und der „Friedensmentalität” zu brechen.
Da entscheidende Zitat lautet: „Die fünfte Orbán-Regierung hat beschlossen, dass wir eine wirklich schlagkräftige, kampffähige Armee aufbauen. Das bedeutet, dass wir mit unseren bisherigen Friedensbestrebungen brechen. Wir kennen diese, aber, vor allem als Ergebnis eines Prozesses, brechen wir mit der Friedensmentalität”. Auf ungarisch: “Az ötödik Orbán-kormány eldöntötte, hogy egy valóban ütőképes, harcképes magyar haderőt építünk fel. Ez azt jelenti, hogy szakítunk az eddigi béke törekvéseinkkel. Ismerjük ezeket, de főleg egy folyamat eredményeképpen szakítunk a béke mentalitással. (…)”
Das klingt widersprüchlich, ist aber in Wirklichkeit nur eine andere Dimension: Orbán spricht als Politiker; seine Politik ist auf Frieden in der Ukraine ausgerichtet. Szalay-Bobrovnicky sprach als Soldat, der seine Truppen kriegsfähig machen will, um das Land im Ernstfall verteidigen zu können.

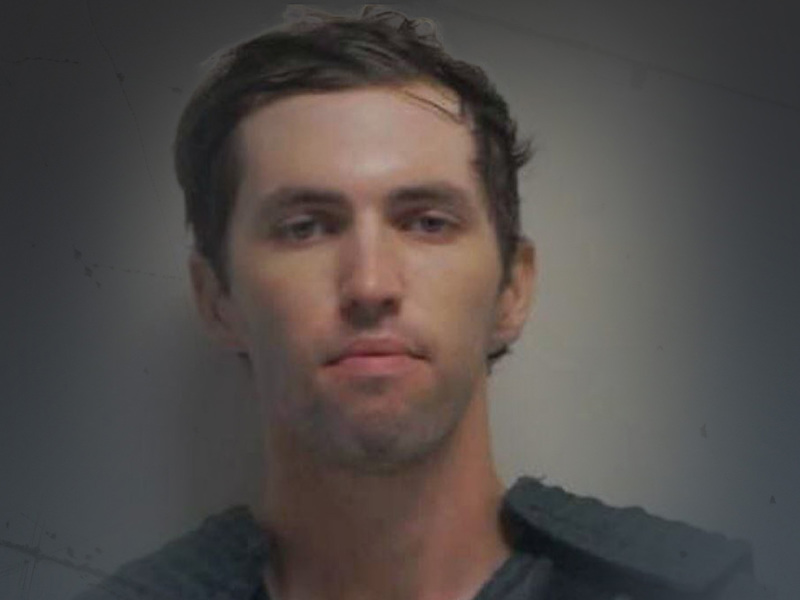







 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























