
Poker dürfte das wohl US-amerikanischste aller Kartenspiele sein, und unter Politikern erfreuen sich Metaphern entsprechender Beliebtheit: „All in“ gehen sie gerne, lassen sich nicht in die Karten schauen, haben noch ein Ass im Ärmel. „You don’t have the cards right now“, so einst Trump zum Selenskyj. Poker ist also die ultimative Politmetapher für Verhandlungssituationen. Doch unsere Volksvertreter kümmern sich noch um zwei weitere Steckenpferde: Sportlich wird’s, wenn der partei- oder fraktionsinterne Teamgeist im Sinne der Bundesliga beschworen wird. In der Geopolitik schließlich, da ist die über Jahrhunderte destillierte Analogie die eines Schachspiels: Kaum ein Essay, die ohne Referenz auf das „Great Game“, das Spiel der Könige auskommt. Was ist sein nächster Zug, wie schnell erfasst er die Aufstellung der Figuren, wie mannigfaltig denkt einer die möglichen Züge seines Gegenspielers?
Präsident Donald Trump ist Golfer. Das passt, denn Golf ist ein Einzelsport und wenn man einen Ball in die Heide pfeffert, ist das jemand anderes Problem. Es gibt dann irgendeinen Subalternen, der den wiederbringen muss. Ursula von der Leyen ist Reiterin. Auch das passt, denn hier gibt es gute Noten für die Haltung. „Röschen war immer sehr ehrgeizig, sie saß immer so schön gerade auf dem Pferd. Wie eine Kerze!“, so erinnert sich ein alter Pferde-Profi vor Jahren in einem Interview. Besser könnte man die unterschiedlichen Charaktere wohl nicht versinnbildlichen. Ein Pokerspieler, Mannschaftssportler oder Großmeister des Schachs dürfte allerdings keiner der beiden sein.
Links: Golfer Donald Trump, rechts: das ehrgeizige „Röschen“, genauer gesagt die Präsidentin der EU Kommission.
Wie es der Zufall will, kann man im schönen Schottland recht gut Golfen und Ausreiten. Mit ihrer strategisch bedeutsamen Lage im Nordatlantik sind die nördlichsten Pfründe Seiner Majestät nicht nur für die NATO von enormer Bedeutung, sondern auch Heimat der seegestützten nuklearen Lebensversicherung Britanniens. Es steht außerdem im doppelten Sinne für die Frage nach strategischer Autonomie: Einmal, weil Edinburgh eisern nach Selbstverwaltung strebt, häufig sogar offen separatistisch gegenüber London auftritt. Andererseits, weil Großbritannien in einem Akt demokratischer Souveränität aus der Europäischen Union ausgetreten war – eine Entscheidung, die Fähnchen-wedelnden Technokratie-Fetischisten in Brüssel bis heute nicht verstanden, vor allem aber den „Rosbifs“ nicht verziehen haben. Trump und von der Leyen dürften bei all diesen Themen so ziemlich die denkbar gegensätzlichsten Perspektiven vertreten.
In diesem Umfeld treffen nun also die beiden Champions aufeinander, das Beste, was Nordamerika und Westeuropa zu bieten haben. Ausfechten sollen sie den Handelsstreit, der zwischen denen, die eigentlich Partner sind, schon lange schwelt. Während der Krieg in der Ukraine tobt, die deutsche Wirtschaft nicht auf die Beine kommen will und die Bundeswehr immer noch ein Schatten ihrer Möglichkeiten ist, ausgerechnet das. Die Verhandlungen, ja die gesamte Lage ist ein Lehrstück geopolitischen Versagens. Und das Ergebnis der Begegnung in Schottland wiederum bedeutet eine schwere Hypothek.
Einer der ältesten Golfplätze befindet sich in St. Andrews. Im schönen Schottland lässt es sich recht gut Golfen und Ausreiten.
Es ist noch nicht lange her, da sprach George Bush der Ältere über Deutschland als einen „Partner in Leadership“, das war um die Zeit der Wiedervereinigung. Die Deutsche Mark stand kurz davor, neben dem Dollar zu einer der interessantesten, vielleicht sogar zu der zweiten Leitwährung zu werden. Mit den wiedervereinigten deutschen Streitkräften umfasste die frisch gebackene Armee der Einheit etwa eine halbe Million Mann. In dieser Lage brauchte die Bundesrepublik keine Nuklearwaffen, um strategisch auf dem internationalen Parkett zu manövrieren – eine starke Außenwirtschaft, eine stabile Währung und eine robuste Lebensversicherung daheim hätte ein gewaltiges Maß an strategischer Autonomie bedeutet. Doch es sollte anders kommen: Die Maastricht-Verträge, die gemeinsame Währung und die Institutionen der EU haben die Beinfreiheit der Republik ordentlich eingeschränkt, und das unter kräftiger Mitwirkung der deutschen Politik. Es war schließlich die europäische Seite, die den Freihandel mit den USA wegen irgendwelcher Hühnchen ablehnte, als sie die Chance dazu hatte. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump war Ursula von der Leyen noch Angela Merkels Verteidigungsministerin, bevor sie 2019 zu Angela Merkels Kommissionspräsidentin wurde.
Ursula von der Leyen mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dezember 2016. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump war Ursula von der Leyen Merkels Verteidigungsministerin.
Heute stehen wir da, wo wir stehen: Die Europäische Union geriert sich als Großmeister im „Großen Spiel“, als strategischer Akteur. Doch sie ist ein entsetzliches strategisches Flickwerk, selbst unter besten Bedingungen weit entfernt davon, strategisch oder auch nur ad-hoc agieren zu können. Die Neigung politischer und medialer Zirkel, immer recht begeistert von „Europa“ zu sprechen – es muss nun dies, es sollte nun das – ist mindestens ein gefährlicher Selbstbetrug. Dem gegenüber sitzt ein vor Selbstvertrauen berstender US-Präsident, der die tödlichste Streitmacht der Welt befehligt, in dessen Landeswährung weltweit gehandelt wird, der die reichsten Unternehmen der Welt repräsentiert – und von einer Mehrheit seines Volkes gewählt wurde. „Europa“ kann gerade so von Glück reden, dass es zu diesem Machtblock auf der anderen Seite des Atlantiks traditionell gute Beziehungen pflegt, eine kulturelle Verwandtschaft aufweist und eine Militärallianz unterhält.
Tatsache ist, dass Ursula von der Leyen in Schottland eine Verhandlung im Grunde nur simulieren konnte. Zwar ist die EU formal mit der gemeinsamen Handelspolitik betraut, doch kann sie keine anderen Instrumente in die Waagschale werfen – zudem fehlt es schlicht und ergreifend an von den Mitgliedsstaaten mehrheitlich geteilten Interessen. Verglichen damit ist der von NATO-Generalsekretär Mark Rutte organisierte Gipfel, bei dem die Nationalstaaten wesentlich freier agieren als in der EU, deutlich produktiver gewesen. Und auch, wenn es bei der Begegnung zwischen von der Leyen und Trump primär um die Frage der Zölle ging, sind nicht zuletzt die Folgen des Deals für die Geopolitik, Verteidigung und Rüstung von durchschlagender Bedeutung.
Ursula von der Leyen mit US-Präsident Donald Trump in Schottland. Tatsächlich konnte die Präsidentin der EU Kommission in Schottland nur eine Verhandlung simulieren.
Was genau haben sie also vereinbart, der Golfer und die Reiterin?
Kommt es wie vereinbart, wird die EU für 750 Milliarden Euro Güter aus den USA importieren, die von strategischer Bedeutung sind: Um Energie geht es, Halbleiter und vor allem Rüstungsgüter. Technisch gesehen ist das weniger problematisch. Ohne Energieimporte aus den USA geht es ohnehin nicht, da insbesondere Deutschland auf russisches Gas und Kernenergie gleichermaßen verzichten möchte. Und viele der Beschaffungsvorhaben, die Beispielsweise für die Bundeswehr oder die Ukraine zügig umgesetzt werden sollen, müssen ohnehin in den USA platziert werden. Fachpolitiker, Experten und die Industrie selbst haben bereits in der Vergangenheit unterstrichen, dass für die kurz- und mittelfristige Nachrüstung europäische Systeme aus diversen Gründen nicht in Frage kommen, unter anderem, weil bestimmte Güter hier gar nicht erst produziert werden. Vermutlich würde man also auch ohne den Schottland-Handel für ein gewichtiges Sümmchen in den USA Rüstungsgüter einkaufen.
Eine US-produzierte Lockheed Martin F-16C. Unter dem neuen Deal muss die EU für 750 Milliarden Euro Güter aus den USA importieren, vor allem Rüstungsgüter.
Die Problematik liegt anderswo: Die geopolitische Abhängigkeit der Europäer von den USA wird hier nicht nur eindrucksvoll betont, sie wird auch auf Jahre fest- und fortgeschrieben. Das passt so gar nicht zu dem immer hysterischer werdenden Gerede von europäischer Autonomie und dem Fiebertraum Brüsseler Selbstbehauptung aus eigener Kraft.
Die US-Käufe dürften dabei nicht nur kurzfristig Haushaltsmittel binden, sondern auch dazu führen, dass ein gewisser Verdrängungseffekt bei europäischen Beschaffungs- und Rüstungskooperationen eintritt. Gerade bei der Neuentwicklung von Systemen, wie beispielsweise beim Eurofighter-Nachfolger FCAS, dürfte der Rotstift angesetzt werden. Und Ideen wie jene, im Rahmen der Initiative „Sky Shields“ im Verbund Luftabwehrsysteme zu beschaffen, könnten durch die Vereinbarung mit den USA völlig absorbiert werden.
Da die Länder Europas viel Geld für Rüstung ausgeben wollen, aber kein Technologietransfer einsetzt, hemmt das die Innovationskraft der Industrie – und das, während die Werke ziviler Zulieferbetriebe ohnehin in die USA gelockt werden. Auf der Ebene des politischen Agierens dürfte das Ergebnis auch eine gewisse Synchronisation der heimischen Logik mit den Zyklen und Realitäten der US-Politik und des dortigen Rüstungsmarktes bedeuten. Angesichts der Tatsache, dass mitunter großspurig das genaue Gegenteil angekündigt wurde, bedeutet dieses Ergebnis – gerade für die weißglühenden Gegner Trump’scher Politik – eine kataklystische Konfrontation mit der Realität.
Ausgeschlossen ist allerdings nicht, dass die von vielen kritisierte Einigung noch von dem ein oder anderen torpediert wird. Frankreichs Präsident Macron beispielsweise inszeniert sich an den Wochenenden gerne als vortrefflich belichteter Boxer. Als solcher beherrscht er rechte und linke Haken im arbiträren Wechsel. Den Donald-Ursula-Deal bezeichnete er am Montag bereits als „Unterwerfung“, die erzwungene Kapitalflucht in die USA sowie die deutlich gewordene Machtlosigkeit der EU treffen ihn politisch hart. Es dürfte als nahezu sicher gelten, dass Macron die Verluste anderswo ausgleichen wollen wird: Rücksicht auf Deutschland wird er dabei kaum nehmen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Donald-Ursula-Deal am Montag als „Unterwerfung“.
Wenn die Bundesrepublik sich aus diesen Zwängen befreien will, muss sie ihre nächsten Züge besser planen. Wie bei jeder guten Partie braucht es Konzentration, wie in jedem Sport müssen Zähne zusammengebissen werden: Die Schwäche der deutschen Wirtschaft, mitunter ausgelöst durch irrsinnige Bürokratie und eine weltfremde Entrückung, sind die Achillesferse schlechthin. Ändert sich die Politik nicht, wird es mit den souveränen Handlungsspielräumen zunehmend enger. Demokratie heißt dann, über immer bedeutungslosere Dinge abstimmen zu können, weil andere die Entscheidungen treffen.
Was immer Ihre Sportart ist: Dafür wünsche ich Ihnen einen ruhigen Puls und einen langen Atem.
Lesen Sie auch:Ein Zollabkommen mit dramatischen Folgen: Die EU hat sich kampflos unterworfen




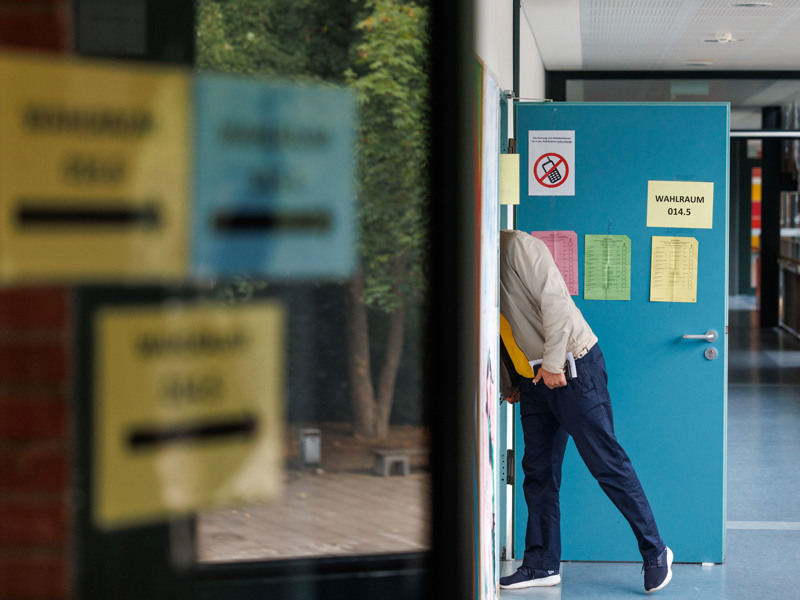
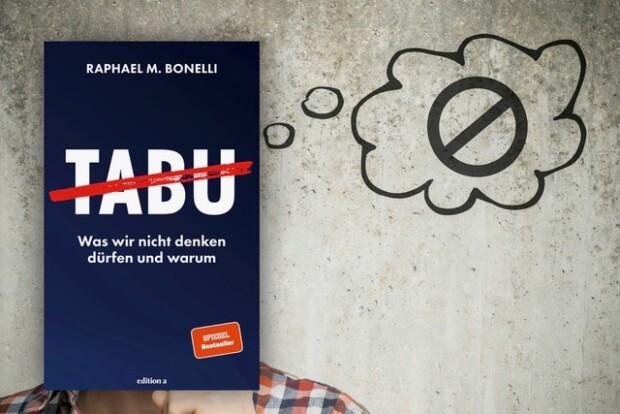




 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























