
Im Bemühen um ein Friedensabkommen mit der Ukraine hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf Moskau erhöht. Er verkürzte die Frist, den Krieg in der Ukraine zu beenden, drastisch. Ursprünglich hatte er eine Zeitspanne von 50 Tagen ab Mitte Juli ausgerufen. In den vergangenen Tagen verkürzte er diese jedoch auf zehn Tage. Sollte in diesem Zeitraum keine Waffenruhe einkehren, drohte Trump den Handelspartnern Russlands mit sekundären Zöllen von 100 Prozent. „Sekundärzölle“ ist eine Wortschöpfung Trumps. Damit sind jedoch „Sekundärsanktionen“ gemeint.
Demnach wollen die USA Länder wie China, Indien, Brasilien, die Türkei und andere, die weiterhin billiges Öl und Gas aus Russland beziehen, mit Zöllen belegen. Sekundärzölle sollen, ähnlich wie Sanktionen, politische Ziele mithilfe ökonomischer Zwänge durchsetzen. In diesem Fall erfolgt dies, indem die Sekundärzölle Importe aus Drittstaaten in die USA verteuern, die Handel mit einem sanktionierten Staat (Russland) betreiben. Sekundärzölle müssen zwar nicht von den Ländern selbst, sondern von den US-Importeuren gezahlt werden. Die Strafwirkung trifft die Exportländer jedoch indirekt, da deren Ausfuhren im Vergleich zu Konkurrenzprodukten in den USA teurer werden.
Am Mittwoch drohte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social Indien mit Strafzöllen von 25 Prozent wegen Geschäften mit Moskau. Indien habe einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland gekauft und sei zusammen mit China der größte Abnehmer russischer Energie, teilte Trump auf Truth Social mit. Das geschehe zu einer Zeit, in der die ganze Welt wolle, dass Russland das Töten in der Ukraine beende. Zudem habe Indien viel zu hohe Zölle. Trump drohte Indien, es könne gemeinsam mit Russland „seine toten Volkswirtschaften zu Fall bringen“.
Im Februar gaben Trump und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi in Washington das Ziel aus, den Handel zwischen beiden Ländern bis zum Jahr 2030 auf 500 Milliarden Dollar (etwa 435,8 Milliarden Euro) zu mehr als verdoppeln. Dazu sollte bis zum Herbst dieses Jahres der erste Teil eines Handelsabkommens ausgehandelt werden. Die Verhandlungen gerieten jedoch zuletzt ins Stocken. Ein Grund dafür sind Differenzen beim Zugang zum indischen Markt für Agrarprodukte und Milcherzeugnisse. Am 1. August verhängte Trump per Dekret neue Zölle, nachdem die Frist für Länder ohne Handelsabkommen mit den USA abgelaufen war. Unter anderem belastete er Indien mit einem Zollsatz von 25 Prozent. Aufgrund seiner engen Beziehungen zu Moskau droht dem Land nun eine zusätzliche Zollstrafe von 25 Prozent. Damit liegen die Strafzölle für Indien insgesamt bei 50 Prozent.
Die Tatsache, dass der US-Präsident Indien, das seit Monaten in Washington ein Zollabkommen zu erreichen versucht, bereits zwei Tage vor Ablauf der Frist für eine Einigung am 1. Oktober zusätzlich mit Sekundärzöllen belegt, wird auf dem Subkontinent als ein Zeichen interpretiert, dass Neu Delhi sich auf die USA im Wettbewerb mit China nicht verlassen könne. Zudem könnte die jüngste Ankündigung Trumps, mit dem indischen Erzfeind Pakistan die Entwicklung „massiver” Ölreserven voranzutreiben, die Haltung Neu Delhis noch weiter verhärten und den Eindruck verstärken, die USA hätten eine politische Offensive gegen Indien gestartet.
Die Zollhürden, die der US-Präsident Trump in den vergangenen Monaten errichtet hat, hatten bislang eine ökonomische Begründung. Im Kern geht es dem US-Präsidenten darum, das amerikanische Handelsbilanzdefizit zu verringern und die heimische Produktion und Förderung von als sicherheitsrelevant definierten Gütern wie Stahl, Aluminium oder Halbleitern zu stärken. Im Fall Indiens greift die Wirtschaftslogik von Trump jedoch nicht. Er will die Zölle nun als Hebel nutzen, um politische Ziele zu erreichen.
Die Drohung gegen Russlands Handelspartner hat allerdings ein Vorbild in der jüngeren Geschichte. Im März kündigte das Weiße Haus einen „Sekundärzoll“ von 25 Prozent für alle Länder an, die Öl und abgeleitete Produkte aus Venezuela einkaufen. Zu den größten Abnehmern venezolanischen Öls gehört China. Bisher haben die USA allerdings keinen „Sekundärzoll“ gegen chinesische Produkte verhängt, der auf andere Importzölle aufgeschlagen würde.
Die beiden wichtigsten Handelspartner Russlands sind inzwischen China und Indien. Danach folgen die Türkei und Nachbarstaaten Russlands wie Kasachstan. Aufgrund der seit dem Ukraine-Krieg verhängten Sanktionen hat sich Russland zunehmend nach Asien ausgerichtet. China und Indien sind dabei nicht nur die wichtigsten Abnehmer russischer Produkte, sondern auch die wichtigsten Lieferanten für die russische Wirtschaft. Zudem nutzen russische Zulieferer immer häufiger Drittstaaten wie die Türkei, Usbekistan und Kasachstan als alternative Lieferländer. Während die postsowjetischen Staaten im Zuge des Ukraine-Kriegs ihre Beziehungen zum Westen nach und nach intensivierten, bauten Indien und China ihre Beziehungen zu Moskau aus. Die Türkei fungierte seither vor allem als Drehscheibe, um die westlichen Sanktionen gegen Russland zu umgehen.
Sekundärsanktionen würden vor allem Indien und China treffen. China ist inzwischen der wichtigste Handelspartner Russlands: 2024 entfielen rund 40 Prozent der russischen Importe und 30 Prozent der russischen Exporte auf China. Auch die Einfuhr wichtiger Importgüter für die Militärindustrie erfolgt über China. China und Indien absorbieren zusammen mehr als die Hälfte der gesamten russischen Ölexporte. Es ist fraglich, ob Trumps Zollstrategie überhaupt umsetzbar ist, um Russland im Ukraine-Krieg zum Einlenken zu zwingen. Erstens bleibt abzuwarten, wie Trump solche neuen Zölle mit seiner umfassenderen Handelspolitik vereinbaren wird. Zweitens dürfte seine Sekundärsanktionspolitik vor allem mit seinen immer wieder unterbrochenen Bemühungen kollidieren, Indien in eine Partnerschaft gegen China zu ziehen.
Seit über einem Jahrzehnt legt die indische Außenpolitik großen Wert auf die Vorstellung, dass sich USA und China in einem geopolitischen und wirtschaftlichen Wettstreit befinden, der noch Jahre andauern wird. Vor diesem Hintergrund sah Indien die Chance, sich den USA gegenüber als unverzichtbare Absicherung gegen China in Asien zu präsentieren. Nun ist sich die indische Führung unsicher, inwieweit China und die Notwendigkeit, dessen Aufstieg einzudämmen, Trump in seiner zweiten Amtszeit beschäftigen werden. Zielt Trumps „America First“-Weltanschauung eher auf Konfrontation oder auf Deals mit China?
Bisher hat sich die russische Wirtschaft trotz der westlichen Sanktionen als relativ widerstandsfähig erwiesen. Was aber, wenn die USA den Sanktionsdruck durch Zölle erhöhen? Das würde die Einnahmen Russlands massiv reduzieren und der Kriegsmaschinerie Moskaus gewissermaßen den Riegel vorschieben. Zugleich würden die Beziehungen der USA zu Indien jedoch ruiniert und der Handelskrieg mit China würde eine neue Dimension annehmen.
Insofern ist es unwahrscheinlich, dass die USA eine volle Eskalation mit Indien riskieren, um damit China, den Hauptrivalen der USA im Pazifik, zu belohnen. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass Trump mit Sekundärzöllen einen neuen Streitpunkt mit Peking eröffnet, während beide Länder noch immer keine Einigung über den Zollstreit vom April erzielt haben. Im Gegensatz zu seiner Strategie gegenüber der EU droht Trump China nicht mehr und versucht, den Handelskrieg mit dem Land vorerst auf unabsehbare Zeit zu verschieben. Er will zunächst die weltweiten Lieferketten diversifizieren, um Chinas Dominanz zu brechen.
Im Hinblick auf Russland geht es Trump nicht darum, die russische Wirtschaft durch Zölle in die Knie zu zwingen, sondern Putin zu einem Kompromiss zu bewegen, ohne an einem Sanktionsregime festzuhalten. Im Vergleich zum Entwurf des US-Kongresses für Strafmaßnahmen gegen Moskau fällt Trumps Sanktionsvorschlag nämlich gemäßigt aus: Dieser Entwurf sieht eine Importsteuer von 500 Prozent auf Waren aus Ländern vor, die weiterhin russisches Öl und Gas kaufen.




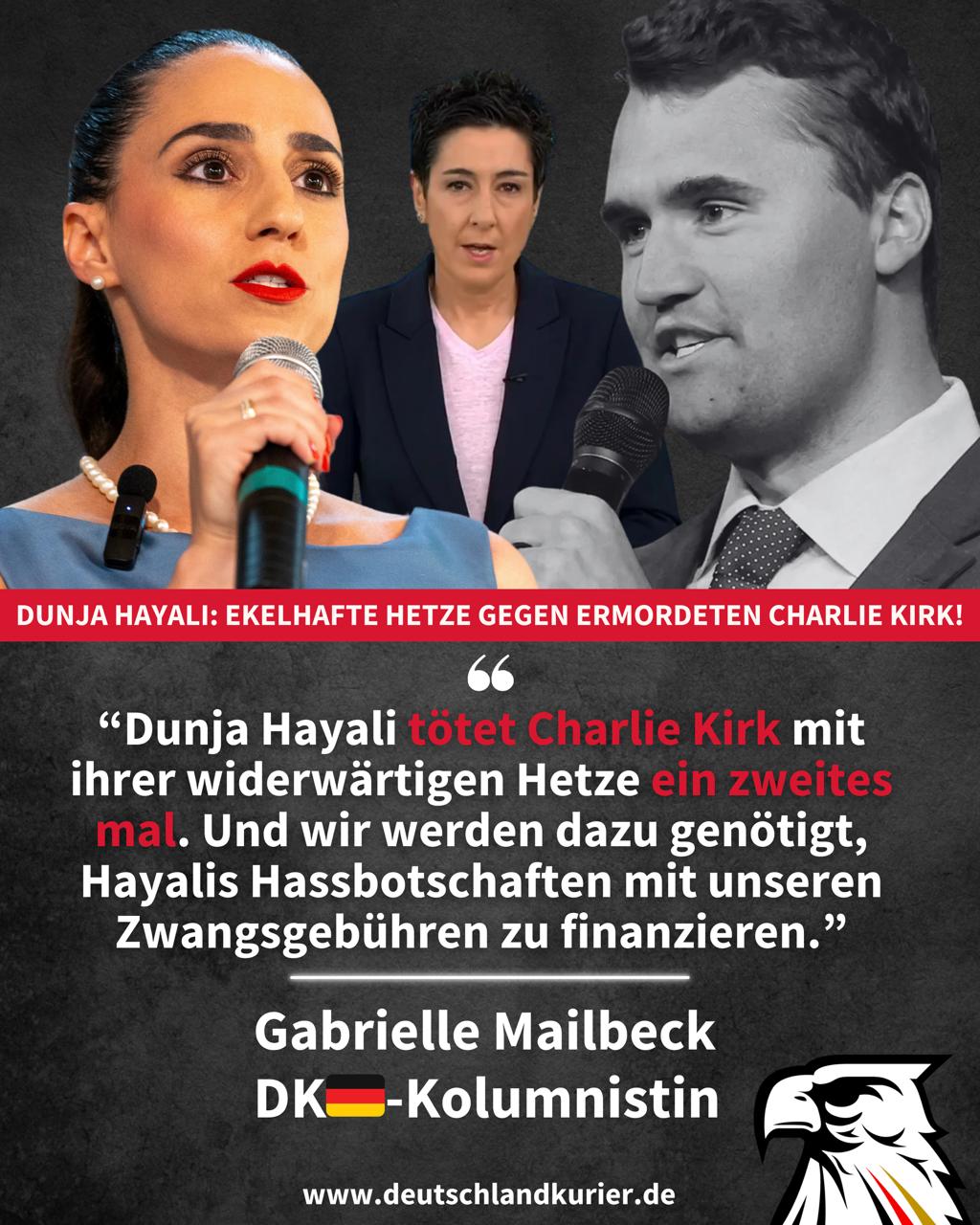




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























