
Publix, das verrückte Steuerhaus für „gemeinnützigen Journalismus“ in Berlin-Neukölln, lud am vergangenen Wochenende zum Tag der offenen Tür. Sozialarbeiterinnen mit türkisen Haaren erzählten von der „Migrationskultur“, linke Damen in sackigen Sommerkleidern philosophierten über die Kriminalität in Neukölln und sogar ein Spiel wurde veranstaltet, in dem Zeitungen auf ihre Glaubwürdigkeit hin bewerten werden sollten. NIUS schaute sich vor Ort um – ein Ort, in dem über 20 Millionen Euro Steuergelder stecken.
Es war ein ziemlich heißer Sonntag. Hätte ich tags zuvor Tagesschau gesehen, wäre ich vermutlich wegen der prognostizierten Hitze zu Hause geblieben oder hätte mich auf die noch größere, noch bevorstehende Hitzewelle vorbereitet. Ich wollte eigentlich baden gehen, aber ein innerer Drang ließ mich in meinen neuen Paar Gants aus der Herrenschuhabteilung von Galeria Kaufhof nach Berlin-Neukölln fahren. Ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet.
Das Medium Correctiv hatte für den Tag der offenen Tür ein „Faktenforum“ angekündigt, in der „Schillerwerkstatt“ sollte man ein „Demokratie-Magazin“ basteln können und es war ein Workshop mit dem Titel „Mit Politik spielen“ geplant.
Schon auf dem Balkon war es angenehm warm.
Die überaus nette Frau Gröger von der Presseabteilung von Publix erkannte mich schon, als ich das Haus noch nicht einmal betreten hatte. „Frau Gröger“, rief ich, aber sie winkte ab. Trotzdem sollten wir uns den restlichen Tag nicht mehr aus den Augen verlieren.
Ich kam etwas zu spät für das Podium „Begegnung und Zusammenhalt in Deutschland und Neukölln“ und nahm zwischen Wänden aus Sichtbeton auf einem der runden Holzschemel an einem der runden Holztische der Kantine Platz – ein Mobiliar, das wegen seiner einfachen Formen und knalligen Farben aussieht, als hätten Kinder es entworfen.
30 Organisationen sind insgesamt etwa im Publix-Haus anässig. Alle sind – im weitesten Sinne – im Bereich des „gemeinnützigen Journalismus“ tätig, den es natürlich überhaupt nicht gibt. Den Begriff haben sich Personen wie der Correctiv-Chef David Schraven lediglich ausgedacht, um leichter an Spenden und Steuergelder für ihre Projekte zu gelangen. Correctiv ist wohl auch das bekannteste Medium im Haus.
Auf dem Podium diskutierte die Intendantin von Publix, Maria Exner, gerade mit der aus São Paulo stammenden Sozialarbeiterin Marina Dias Weis von der „Mobilen Stadtteilarbeit“ und der „Kiezberatung“ interkular aus Neukölln.
Vor dem überwiegend weiblichen deutschen Publikum – im Schnitt vielleicht mitte vierzig, das auffällig oft sackig geschnittene Sommerkleider trug – und der überwiegend männlichen, eher nicht-deutschstämmigen Klasse 8a der Hugo-Gaudig-Schule aus Berlin-Tempelhof, erzählte Dias Weis, dass sich die Menschen im Viertel oft schwer mit „den Veränderungen im Kiez“ täten, die ihnen „zu schnell“ gingen. Sie meinte damit den Zuzug vieler Fremder.
Nach einem netten gemeinsamen Essen, erklärte Dias Weis auf den Stufen des Foyers – sie sprach, glaube ich, von etwas Salat mit Feta und Wassermelone, ganz genau habe ich es nicht verstanden – seien die alteingesessenen Einwohner aber schon viel offener für den Zuzug. Trotzdem müsse man ihnen auch Grenzen setzen. Äußere sich einer derer, „die schon länger da sind“, „rassistisch“, dann sage sie konsequent: „Das geht so nicht, bitte geh.“ „Wir sind offen, wir sind einladend, aber wir zeigen auch, welche Werte bringen wir mit“, so Dias Weis, die türkis-blonde, etwas zottelige Haare hat und ein wie gehäkelt aussehendes Top, ungefähr in den selben Farben trug. Inwiefern man auch von denjenigen explizit etwas erwarte, die neu hierherkommen, erzählte sie nicht.
Die 8a der Hugo-Gaudig-Schule war deshalb anwesend, weil sie den Fotowettbewerb „Jugend fotografiert Deutschland“ der Laif Foundation – eine ebenfalls im Haus anässige Organisation – gewonnen hatte, die sie zur Ehrung einlud. Das Fotoprojekt „Gemeinsam statt einsam“ der „multikulturellen Klasse“ (Berliner Morgenpost) überzeugte die Jury wegen seines „positiven Vibe“ und seiner „hoffnungsvollen und motivierenden Atmosphäre“. Man erfahre, was in „Gemeinschaft besser läuft“, heißt es in der Jury-Begründung. Auf einem Foto umarmen sich zwei Schüler: „Ahmet wartet vor der Schule auf Rosti, jetzt ist er da. Brüder im Herzen“, steht in der Bildunterschrift. „Multikulturell“ heißt bei der 8a eher nicht-deutsch-stämmig, „Gemeinschaft“ eher migrantischer, sonst verpönter Männerbund.
Anschließend ging es auf dem Podium um das sogenannte „unsichtbare Drittel“. Ich wusste nicht, was damit gemeint war, aber die nette Intendantin Maria Exner, die früher mal als Chefredakteurin des Zeit Magazin tätig war, ahnte wohl, dass viele Menschen im Raum dieses Konzept auch nicht kannten. Inga Gertmann von more in common – eine NGO, die zu „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ „forscht“ – erklärte dem Publikum, dass mit dem „unsichtbaren Drittel“ das Drittel der Menschen gemeint sei, die sich in den Medien „nicht repräsentiert“ fühlten. Frau Exner fragte: „Woran liegt das?“ Und wer ist eigentlich dieses Drittel? Frau Gertmann konnte es nicht sicher sagen. Sie selbst sage sich bloß immer: „So, wie ich den Menschen begegne, das färbt auch auf die Gesellschaft ab.“ Und damit sei wohl schon eine Menge getan.
Als das Podium vorbei war, fragte eine ältere Dame, ob sich Frauen denn trauen würden, „in eines der vielen Cafés in Neukölln zu gehen“, denn „da fühlt man sich ja wie in der Türkei“. Schweigen breitete sich unter den Damen aus. Die Rädelsführer der Klasse 8a – sie trugen weiße Jeans, Schlüsselbund und sauber frisierte Seitenscheitel – murrten sichtlich. Im Anschluss wiederholte Frau Exner fürs Podium noch einmal alle Fragen, nur zur Frage der älteren Dame sagte sie: „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, auf was Sie hinauswollten.“
Natürlich hatte jeder im Foyer verstanden, auf was die ältere Dame hinauswollte. Es meldete sich dann auch eine der Mittvierzigjährigen und sagte, dass sie schon zehn Jahre hier wohne und sie sich in den Cafés hier sehr wohlfühle. Ob sie damit auch libanesische Shisha-Bars, türkische Wettbüros oder albanische Spielstuben meinte, sagte sie nicht – aber man hatte so ein Gefühl.
Frau Dias Weis antwortete, dass in Brasilien, wo sie herkomme, auch viele Deutsche lebten: „Wir sind eine Migrationskultur“, erklärt sie. Und meinte damit die Welt. Alle im Foyer klatschten, einige Damen wuhuuten und die Jungs aus der 8a nickten anerkennend. Trotzdem sei es „schön“, sagte die Frau, die schon zehn Jahre lang in Neukölln lebt und sich hier sehr wohlfühle, dass die ältere Dame die Frage gestellt habe und es hier „auch eine kritische Stimme“ gebe.
Man muss fairerweise sagen, dass so viel „Kritik“ beziehungsweise ja eher Ausdruck eigener Eindrücke wohl eher nicht so häufig sind im Haus. Viele eingemietete Organisationen – neben klassischen Medien, Fonds und Vereinen wie Reporter ohne Grenzen eine Menge Projekte, bei denen es schon schwierig ist, überhaupt zu sagen, was sie tun – sind eher links eingestellt, obwohl man das im Haus und bei seinen Mietern nicht so gerne hört. Auch dürften sich viele als NGOs betrachten oder fallen zumindest darunter, obwohl auch das nicht stimmt. Insgesamt flossen in Publix und die anässigen Marken bereits über 20 Millionen Euro Steuergelder, wie NIUS berichtete.
Die Damen kommen derweil auf die Kriminalitätsbelastung im „Kiez“ zu sprechen. Eine Frau stellt die Frage, ob die Kriminalität in Neukölln wirklich so hoch sei? Das Viertel, darum ging es auch auf dem Podium, ist ja gerade deshalb oft in den Medien. Eine andere Frau antwortet, sie wohne in der Schillerpromenade in Berlin-Neukölln, dort seien die Fallzahlen gar nicht so hoch. „Vielen Dank für die Information“, sagt Maria Exner.
Was die Frau nicht erwähnte: zwar finden sich die Neuköllner Bezirksregionen, was Fallzahlen von Straftaten angeht, nicht ganz vorne in Berliner Kriminalitätsstatistik. Allerdings sind drei der zwölf Bezirksregionen Neuköllns unter den Top 13 der insgesamt 143 sogenannten Bezirksregionen der Stadt. Gerade die ziemlich gentrifizierte Schillerpromenade direkt am Tempelhofer Feld, in der viele grüne und linke Akademiker, Deutsche und Expats leben, zählt hier nicht dazu.
Nach dem Podium, während dem Frau Gröger mich nur aus den Augen ließ, um durchs Haus zu laufen – ich vermute, um andere Personen vor mir zu warnen – ging ich zum „Aktionslabor Redaktionelle Gesellschaft“ der Zeit-Stiftung Bucerius, die das Haus und ansässige Projekte regelmäßig fördert und deren „Aktionslabor“ sich ebenfalls im Foyer befand. Dort waren eine große Leinwand und mehrere Joy-Sticks aufgebaut. Mit dem Joy-Stick bewegte ich auf der Leinwand zwischen Häuserschluchten eine Figur – das Spiel hieß „Was soll aus dem leerstehenden Kaufhaus werden?“. Auch ein Junge neben mir steuerte eine Figur.
Wir verstanden nicht so recht, was wir eigentlich machen sollten. Allerdings las ich irgendwo, dass man sich mit den anderen Spielern treffen solle, also trafen sich der Junge und ich mit unseren Figuren. Ab dem Moment hatten wir eine Minute Zeit, miteinander reden. Es war ein Spiel, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir fanden beide doof, zum Reden gezwungen zu werden und der Junge ging zu seinen Eltern und ich nach draußen, wo die „Marktstände“ aufgebaut waren.
Neben Correctiv waren dort Stände der Laif Foundation, die besagte „Schillerwerkstatt“, ein Stand von Tactical Tech – eine NGO, die unter anderem „pädagogische Interventionen“ zur „digitalen Alphabetisierung“ anbietet, ein Stand von Superrr Lab – ein Blog und Projekt, das „existierende Machtdynamiken im Tech-Sektor angreift, indem man wiederimaginiert, wie eine gerechte und inklusive Zukunft aussehen könnte“, und ein Stand von Codetekt – ein Verein, der „zum Erkennen und Eindämmen von Desinformation“ „Workshop-Angebote, Aufklärungsarbeit“ und „digitale Tools“ anbietet.
Ich ging zu Codetekt – auch, weil die Personen sehr sympathisch aussahen und dort eine Tafel mit Namen verschiedener deutscher Zeitungen aufgebaut war – unter anderem Bild, Nordkurier und Sezession – die man mittels eines Punktesystems bewerten konnte.
Die Personen am Stand erzählten mir gerade, dass sie ein „Wikipedia der Desinformation“ aufbauen möchten und wie das Spiel funktioniert, das sie mitgebracht hatten, da platze Frau Gröger in unsere Unterhaltung. „Sie wissen, dass Herr Winter für NIUS arbeitet?“, fragte sie die netten Mitarbeiter vom Codetekt-Stand. „Wir wollen ja transparent sein.“ Außerdem würde sie mich bitten, mich das nächste Mal zu akkreditieren. Ich antwortete, dass ich dagegen überhaupt nichts sagen könne und dass ich nicht wusste, dass man sich für einen Tag der offenen Tür akkreditieren müsse, und dass ich jetzt aber gerne das Spiel spielen würde.
Am Stand von „Codetekt“ konnte man Zeitungsartikel bewerten und seine Bewertung in einer Tabelle eintragen.
Leider war die Stimmung danach nicht mehr ganz so entspannt, was ein bisschen verständlich war, aber ein wenig Anspannung ist manchmal ja auch nicht schlecht. Der junge Mann von Codetek gab sich auf jeden Fall große Mühe, mich weiter durch das Spiel zu führen, das muss man sagen. In dem Spiel musste man erst den Artikel einer Zeitung lesen. Ich wählte Bild, weil es die am schlechtesten bewertete Zeitung war und ich Mitleid hatte. Anschließend musste man zu diesem Artikel mehrere Fragen beantworten, zum Beispiel, ob der Autor eine journalistische Ausbildung hat, für wie glaubwürdig man den Text halte, für wie unabhängig die Zeitung und ob der Artikel unterschiedliche Positionen wiedergebe.
Es war ein simpler Text von Bild, ein Bericht über einen Terroranschlag mit Stimmen von Betroffenen und Politikern, weshalb man journalistisch gesehen nicht viel falsch machen konnte. Ich bewertete den Text deshalb mit einer acht von zehn, bemerkte aber, dass so eine acht weniger schwer wiege als beispielsweise eine acht bei einer aufwändigen Reportage. Der junge Mann von Codetek zeigte, so meinte ich es zu interpretieren, Verständnis für mein Argument. Auch darüber, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher nicht so unabhängig ist und Bild eher schon, waren wir uns einigermaßen einig. So verstand ich es jedenfalls.
Per Siebdruck konnte man in der „Schillerwerkstatt“ das Layout eines „Demokratie-Magazin“ entwickeln.
Als Letztes ging ich noch zum Stand von Correctiv, deren Personal – das hatte ich schon aus den Augenwinkeln gesehen – Frau Gröger als erstes vor mir gewarnt hatte. Die Mitarbeiter standen da wie zwei Politkommissare fürs Parteitagsfoto. Ich stöberte ein wenig im Buch „Der AfD-Komplex“, das Correctiv letztes Jahr herausgebracht hat. Ich erzählte, dass auch ich mich dafür interessiere, wie die AfD zu Israel stehe. Aber aus den beiden Correctivlern war nichts herauszukriegen.
Frau Gröger hatte auch diese Begegnung aus sicherer Entfernung beobachtet. Im Gehen rief ich ihr noch einmal zu, dass ich mich beim nächsten Mal ganz sicher akkreditieren werde. Und dann lief ich durch die sengende Hitze zurück nach Hause und telefonierte mit meiner Mutter, die mich fragte, ob es in Berlin auch so heiß sei wie bei ihr.
Mehr NIUS:




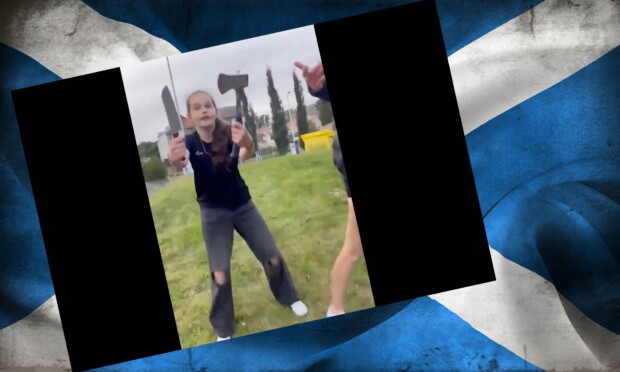

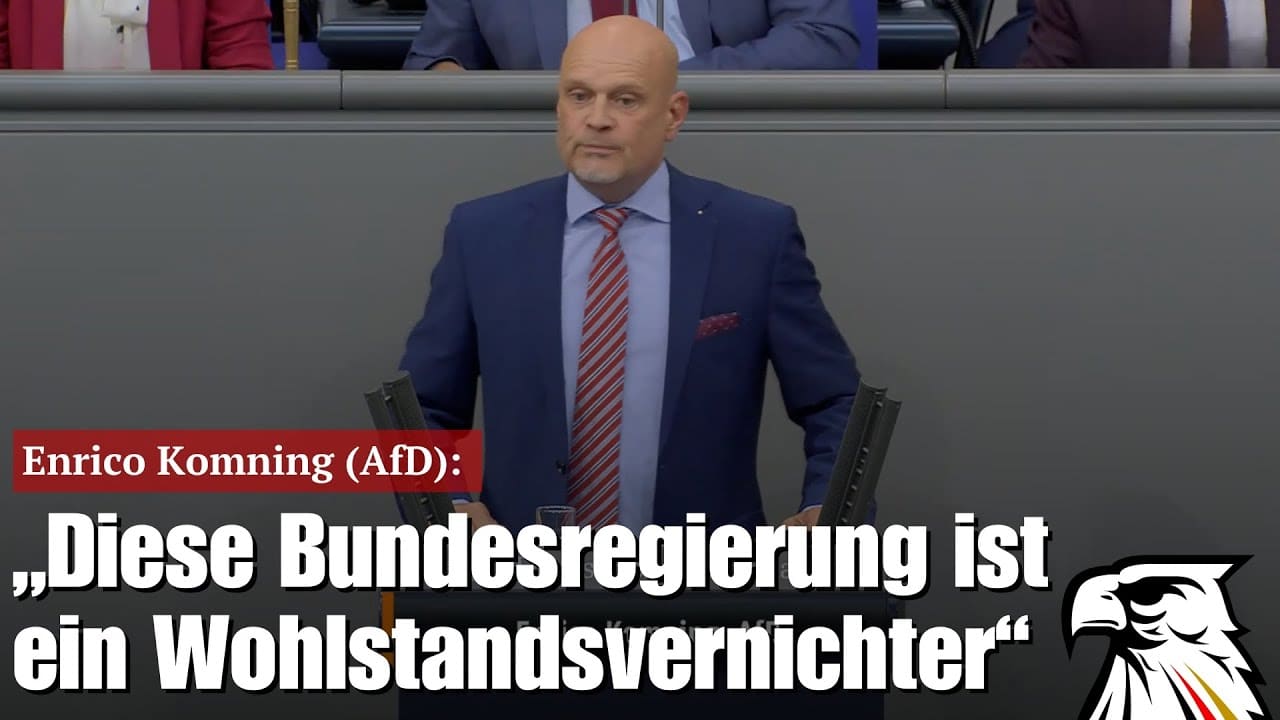


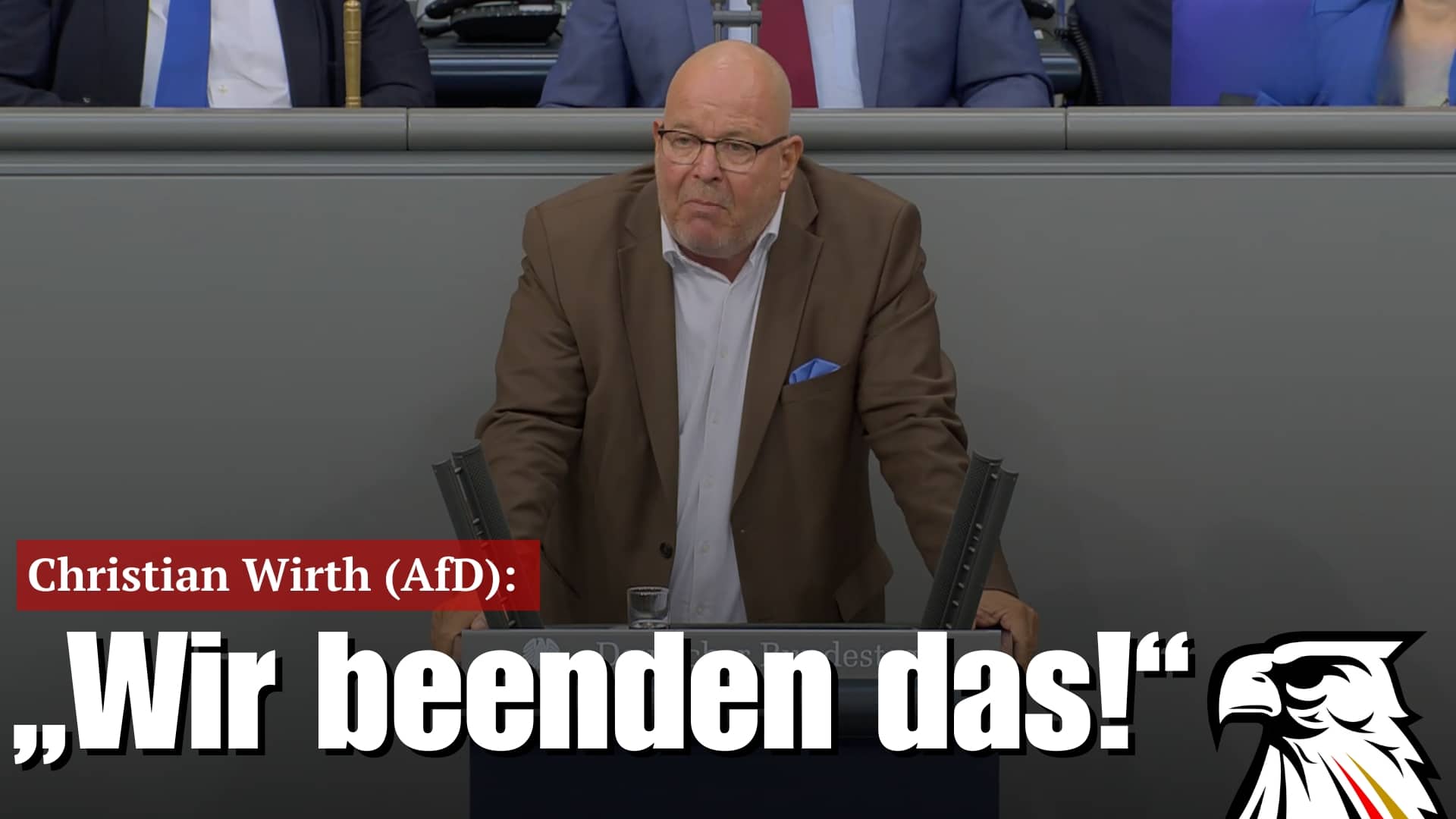
 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























