
Was macht eigentlich Boris Pistorius?
Von dem auch Spitzenpolitikern redlich zustehenden Urlaubszeitraum einmal abgesehen, ist es in den letzten Wochen still geworden um den Oberbefehlshaber der Bundeswehr. Wo genau er seine Ferien verbringt, wollte das Ministerium naseweisen Journalisten zurecht nicht verraten, seinen Sonnenschutz scheint er allerdings im Windschatten der Kabinettskollegen zu suchen. Denn dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, dass es jüngst bemerkenswert wenig von und über den Verteidigungsminister zu lesen gab. Und das, obwohl militärisch geprägte Themen – angefangen bei Gaza über den Iran bis hin zu den neusten Entwicklungen rund um die Ukraine – sich einer zweifelhaften Konjunktur erfreuen.
Nun aber droht selbst Deutschlands beliebtestem Politiker Ärger im Popularitätsparadies. Denn in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisieren der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Henning Otte sowie der renommierte Militärhistoriker Sönke Neitzel Pistorius Bemühungen insgesamt als zu halbherzig, zu unentschlossen, zu oberflächlich. Ihre Wortwahl ist höflich, aber deutlich: Ein ständiges Ankündigen und Vertagen entspräche nicht ansatzweise dem Mut, den die Politik umgekehrt von ihren Soldaten verlange, so der Tenor.
Verteidigungsminister Pistorius (SPD) bei Soldaten der Sanitätsakademie. In einem kürzlich erschienenen FAZ-Beitrag bemängeln Militärexperten fehlenden Mut bei Pistorius’ Kurs.
Das sitzt. Sicher, zu Pistorius Verteidigung gäbe es einiges zu sagen. Otte beispielsweise gehört nicht nur der konkurrierenden CDU an, sondern muss als Wehrbeauftragter sowohl im Sinne der Soldaten als auch des Parlamentes dem Ministerium konstruktiv-kritisch auf die Finger schauen, das ist sein Job. Lobhudeleien sind von dieser Stelle traditionell ohnehin nicht zu erwarten.
Anders verhält es sich da schon mit Professor Neitzel, der als Autor zahlreicher Werke und Talkshow-Gast einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sein dürfte. Neitzel, der selbst Grundwehrdienst leistete und in lebenslanger Arbeit der Bundeswehr verbunden ist, erfreut sich frequenter Einladungen in öffentlich-rechtliche Formate, ohne dabei eine gewisse Unabhängigkeit und eine kritische Haltung je aufgegeben zu haben. Sein Wirken und Mahnen reichen allerdings lange genug zurück, um nicht bloß als persönliche Kritik am derzeitigen Minister interpretiert zu werden: Vielmehr identifiziert der Historiker einen allgemeinen und anhaltenden Handlungsunwillen in der Berliner Republik, den er, richtig verstanden, Pistorius und seine Generale zu durchbrechen auffordert.
Es ist also nicht so, als habe man den Minister allenthalben auf dem Kieker, immerhin weiß man um dessen Popularität. Angesichts der Weltlage, dem Zustand der Truppe und der nüchternen Tatsache, dass sich für diesen Job wohl auch realistischerweise kein Besserer fände, wünscht man ihm eine glückliche Hand. Selbst die CDU fasst ihn bislang eher mit Samt- als mit Fehde-Handschuhen an.
Auch die CDU begegnet Pistorius bislang mit Samthandschuhen – denn ein populärerer Kandidat lässt sich schwerlich finden.
Der Schlüssel zum Verständnis der Causa Pistorius aber liegt in einem lange gehegten Missverständnis zwischen der Bevölkerung und den Regierenden. Jener Schlüssel erklärt nicht nur die Beliebtheit des SPD-Ministers, sondern entlarvt letztlich auch dessen lauwarme Bilanz im Amt. Denn anders, als viele Deutsche es verstanden haben dürften, ist der Bundesverteidigungsminister eigentlich der Bundeswehr-Minister. Die ganz großen Fragen von Krieg und Frieden werden auf dem internationalen Parkett eher vom Außenministerium, viel mehr allerdings noch vom Bundeskanzler entschieden. Wie jeder Offizier schon einmal zähneknirschend festgestellt haben dürfte, ist auch der Bundeswehr-Minister letztlich an den engen Spielraum gebunden, den sein Chef und die Lage ihm vorgeben; er bleibt ein ausführendes Organ, wenn auch mit erheblichem Spielraum. Hier hat das Volk nicht selten Helmut Schmidt vor Augen, scheint dabei aber zu vergessen, dass dieser später Bundeskanzler gewesen ist (und in dieser Zeit seine großen, damals bitterlich kontroversen strategischen Entscheidungen traf).
Das Mahnen, das sich demonstrativ an die Seite der Soldaten stellen, Truppenbesuche und kernige Aussagen wiederum, das sind die Aufgaben, die institutionell zur Rolle eines Wehrbeauftragten gehören. Hier ist Raum für das beinahe gewerkschaftlich anmutende Eintreten für bessere Ausrüstung oder angenehmere Dienstbedingungen. Zu der Tätigkeit eines Ministers zählt es vielmehr, jene sodann umzusetzen (oder es begründet nicht zu tun), schließlich tritt er vornehmlich als oberster Dienstherr in Erscheinung. Dass der Chef des Verteidigungsministeriums auch einmal Ausflüge in die vorbezeichneten Felder unternimmt, sei ihm in einer parlamentarischen Demokratie unbenommen – auch Freiherr von und zu Guttenberg pflegte solche und war damit Umfragen zufolge noch einmal beliebter als Pistorius heute. Doch darum geht es in dieser Position nicht. Alles in allem offenbaren die an die Soldaten gerichteten Einlassungen des Ministers einen soliden Charakter, doch es verlangt in diesem Amt nach Durchsetzungsvermögen und Entscheidungen – auch und gerade dann, wenn sie unpopulär sind.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht nach seinem Besuch des Innovationslabors am Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk- und Betriebsstoffe mit Journalisten. Der Verteidigungsminister ist vor allem Bundeswehr-Minister. Über Krieg und Frieden entscheiden Kanzler und Außenministerium.
Bislang hat sich der Verteidigungsminister, der sich durch seine Vordienstzeit in der Ampel-Regierung jede Einarbeitung sparen konnte, eben nicht mit irgendeiner Richtungsentscheidung oder deren Umsetzung hervorgetan. Die weltweite Sicherheitslage, die ungewöhnlich hohe Zustimmung zur Truppe sowie zu seiner Person sowie annähernd unbegrenzte Geldmittel sollten diese Aufgabe eigentlich erheblich erleichtern. Anders als unter seinem Genossen Olaf Scholz dient Boris Pistorius nun einem Bundeskanzler, der – wie er selbst – seinen Wehrdienst geleistet hat, der Bundeswehr sowie erhöhten Rüstungsausgaben äußerst aufgeschlossen gegenübersteht.
Doch nach über drei Jahren im Amt müssen die Karten so langsam auf den Tisch, und das passiert in den kommenden Tagen.
Schon seit Monaten bastelt das Verteidigungsministerium an einem neuen Wehrpflichtgesetz, dessen erste Fassung dank einer Intervention des ehemaligen Kanzlers Scholz gar nicht erst in das Ampel-Kabinett gelangt war. Just in dem Moment, als es der alte und neue Verteidigungsminister erneut vorlegen will – am morgigen Mittwoch soll das schwarz-rote Kabinett darüber beschließen – droht es am Widerstand der Union erneut zu scheitern. Die hält den von Pistorius vorgesehenen Grad an Freiwilligkeit angesichts des eklatanten Mangels an Reservisten für zu unambitioniert und mag damit richtig liegen. Das unionsgeführte Auswärtige Amt legte am Montag sogar einen sogenannten „Ministervorbehalt“ gegen das einzige Vorzeige-Projekt des Bendlerblocks ein.
Morgen soll die schwarz-rote Regierung über das neue Wehrpflichtgesetz aus Pistorius’ Ministerium entscheiden. Dieses droht jedoch am Widerstand der CDU zu scheitern.
Vielen Kennern bereitet die Erhöhung der Sollstärke in der Bundeswehr auf 260.000 Mann außerdem schon deshalb Kopfschmerzen, weil die Zahl der Soldaten bereits die bisherige Zielmarke erheblich unterschreitet – und in der Amtszeit von Boris Pistorius noch einmal rückläufig war. Angesichts der Tatsache, dass die Zeitenwende-Rede nun schon drei Spargelernten zurückliegt, ist die schrittweise Wiedereinführung der Wehrpflicht jedoch längst überfällig.
Wer sich einmal in die Position des Ministers hineinversetzen möchte, der könnte indes folgendes bedenken: Nicht nur hat Pistorius, ja die gesamte Koalition die Einwände eines renitenten SPD-Flügels in der Regierung stets zu erwägen, wenn sie erfolgreich Wehrgesetze verabschieden will. Wo man entweder die Partei oder den Minister in Schutz nehmen kann, nicht aber beide, hilft nur ein Machtwort des Bundeskanzlers. Gleichermaßen ließe sich argumentieren, dass der Staat aus verfassungsrechtlichen Mitteln erst einmal einige mildere Möglichkeiten abklappern müsse, bevor er sich am Zwangsdienst versucht. Dieser Ansatz ist nicht unintelligent, doch verträgt er sich wenig mit den ständigen Warnungen vor einem allzu bald bevorstehenden russischen Angriff, wie ihn das politische Berlin kommen sieht. Doch wer „Putin“ sagt, der MUSS auch „Wehrpflicht“ sagen (während für denjenigen, der „Wehrpflicht“ sagt, das andere ein abstraktes Szenario bleiben kann). Drückt der Minister diese Logik bei seinen Genossen nicht durch, dann darf zu Recht bezweifelt werden, wie sehr er seine Popularität im Amt tatsächlich verdient hat.
Zu guter Letzt ist es nicht nur das brandaktuell anstehende Wehrpflichtgesetz, das hinter den Erwartungen und der Lage weit zurückbleibt. Von äußeren Bedrohungen einmal völlig unbenommen, fehlt es im Ministerium auch ansonsten an einem gerüttelt’ Maß von Ernsthaftigkeit.
Nicht nur das Wehrpflichtgesetz selbst bleibt hinter den Erwartungen zurück, auch im Ministerium fehlt es an Ernsthaftigkeit.
Noch immer hält der Ausbau ziviler Leitungsstrukturen an, wächst der Überbau an Beauftragten ohne fachliche Vorerfahrung oder militärischer Kompetenz. Die Liste an Rüstungsvorhaben, die nicht zum Abschluss kommen, reicht vom Büro des Ministers bis auf den Parkplatz – und die immer höher beförderten Offiziere in Stäben und Gremien sitzen immer seltener bei der schrumpfenden Anzahl an Mannschaftssoldaten.
Die sogar im Koalitionsvertrag festgehaltenen Aufgaben sind so zahlreich, dass der Minister blind aus ihnen auswählen könnte, wenn er wirkliches Durchsetzungsvermögen zeigen wollte. Was also macht Boris Pistorius? Es ist an der Zeit, dass er Ihnen diese Frage nun einmal selbst beantwortet.
Lesen Sie auch von Chris Becker:Das Dilemma der Sicherheitsgarantien: Warum die Ukraine keinem Waffenstillstand trauen kann






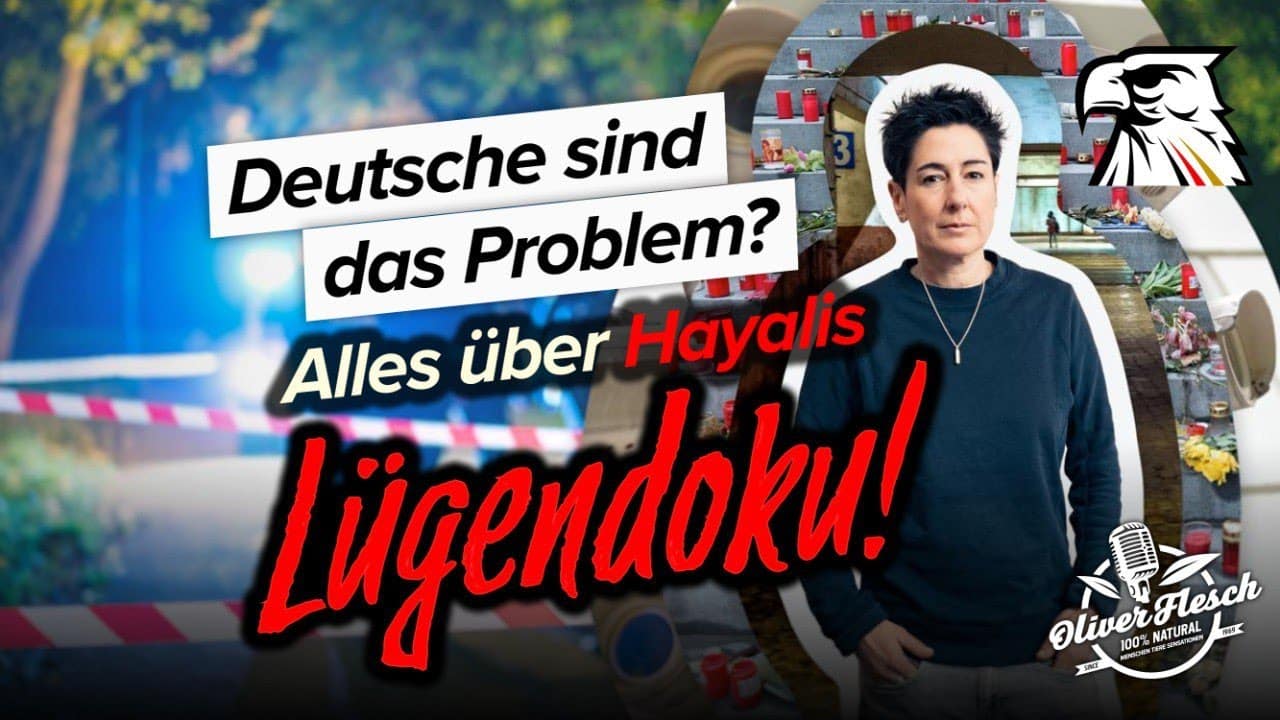



 UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM
UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM






























