
Zwei Porträts im ZDF über die Spitzenkandidatin der AfD und der Grünen fallen völlig unterschiedlich auch: Alice Weidel wird als undurchsichtige, polarisierende und „umstrittene“ Figur dargestellt, während Robert Habeck „nahbar“ und auf Kompromiss fokussiert herüberkommt.
„Alice Weidel ist eine der umstrittensten politischen Figuren in Deutschland. Hoffnungsträgerin und Idol für die einen, Feindbild und Hassfigur für die anderen.“, heißt es in der Beschreibung des Films von David Gebhard. Die „Volkszornige“ fühlt sich „als Anwältin der Menschen, die brutal über den Tisch gezogen werden von einer politischen Klasse“, zu der sie sich „definitiv nicht zählen würde“. Geht gar nicht. „Für die anderen ist sie eine Gefahr für die Demokratie“, heißt es zu Bildern von Demonstranten. Warum sie das sein sollte, wird im Film nicht gesagt.
So wird hingegen der Film von Lars Seefeldt anmoderiert: „Robert Habeck ist Kanzlerkandidat der Grünen. Für die einen Hoffnungsträger, für andere eine Reizfigur. Was treibt ihn an? Was hat ihn geprägt?“ Schon der Ansatz ist hier ein anderer: Man will den Menschen und sein Anliegen vorstellen. Im Laufe des Films vermisst der Zuschauer die eigentlich fällige Einblendung „Dauerwerbesendung“.
Robert Habeck wird auch privat gezeigt – hier in jüngeren Jahren mit Gattin Andrea Paluch.
Bis auf die leicht dramatische Hintergrundmusik sind die beiden Filme im Ton grundverschieden. Beide vollziehen in groben Zügen die Lebensläufe der beiden Spitzenkandidaten nach. Und da fängt es auch schon an: Zwar hat man kein kompromittierendes Flugblatt der Schülerin Alice auftreiben könne, aber immerhin die Abizeitung der Christophorusschule in Versmold, das ins Jahr 1998 datiert und in der ihre Talente gelobt werden, aber auch „ein enger Freund“ ihre Fähigkeit erwähnt, überzeugend lügen zu können. In eher scherzhaftem Ton, aber den Kontext lässt man weg.Die Abi-Zeitung von 1998 bringt es an den Tag: Alice lügt!
Später wird erwähnt, sie habe in ihrer Dissertation (Thema: das Rentensystem in China) an der Universität Bayreuth einen Dank an Prof. Leschke vom Prüfungsausschuss ausgesprochen, der trotz Fiebers erschienen sei. Der will von so einer Erkrankung heute nichts wissen. Ob eine Verwechslung vorlag oder die Erinnerung den Dozenten trügt, bliebt offen – hängen bleibt aber der Verdacht, dass Alice Weidel gewohnheitsmäßig lügt. Zu den besten fünf Prozent gehörte sie jedenfalls, die blonde (Intelligenz-)Bestie.
An ihrer Dissertation scheint nichts auszusetzen sein, während die von Robert Habeck inklusive ihrer Plagiate (NIUS berichtete hier und hier) unerwähnt bleibt. Aber Habeck hat ja auch in seiner Schulzeit nicht gelogen, sondern war unglaublich engagiert, wie Susanne Gaschke erzählt: Schülersprecher, Theater-AG, Politik-AG! In der Theater-AG war er „einer der jüngsten und ehrgeizigsten“, recht breit wird die Geschichte ausgewalzt, wie er sich „ausprobierte“ und immer besser wurde.
Irgendwann sind in beiden Filmen die Jugendzeiten abgehakt, nun geht es an die Politik. Bei Weidel nicht bevor eine alte E-Mail erwähnt wird, die von ihr stammen und in der sie von Politikern als „Schweinen“ und „Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs“ gesprochen haben soll. Jedenfalls tritt sie in die AfD ein, wo „für die schrillen und radikalen Töne“ Björn Höcke zuständig ist. Weidels Verhältnis zu ihm wird als undurchschaubar bzw. doppelzüngig dargestellt. 2017 habe sie ihn aus der Partei werfen wollen, später akzeptiert.
Dann wird zum ersten Mal ihr Schweizer Wohnsitz erwähnt, das angesichts der Lage eher nachrangige Thema kommt im Film mindestens dreimal vor. Dass Weidels Partnerin, die aus Sri Lanka stammende Sarah Bossard, Bilder bei Instagram, die Weidel nahbar und locker zeigen, wird sogleich von einem ehemaligen Nachbarn in Biel kontrakariert. Nach Bildern aus dem Bundestag, wo Weidel feststellt, dass „Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse“ den Sozialstaat nicht sichern würden, kommt mehrmals der Gastronom Dino Pedolin zu Wort, der ihr Hetze unterstellt.
Weidel locker mit ihrer Frau Sarah Bossard – das kann man so nicht stehen lassen!
Hetze – so etwas wäre bei Robert Habeck nicht denkbar. Ist er doch in der Doku über ihn einer, der seine Partei „entideologisieren“ will, gesellschaftliche Mehrheiten sucht, „breite Allianzen“. Robert Brückenbauer. Zwar verunglimpft er politische Gegner als „rechtsextrem“ und als „Feinde der Demokratie“, aber er ist nett und charismatisch. In ihm steckt auch ein „Machtmensch, der andere geschickt entwaffnet“. Nach der Theater-AG sucht er eine größere Bühne, ein größeres Publikum, sagt Susanne Gaschke. Der Film zeigt Habeck auf Wahlkampf-Tour, „mit zu langen Schlangen und zu kleinen Hallen“, denn die Massen wollen ihren Erlöser sehen, und er segnet die, die seiner Predigt nicht in der Halle lauschen können, draußen beim Bad in der Menge.
Robert Habeck erscheint seinen Anhängern.
Im Weidel-Porträt kommt Politiker eher am Rande vor, wir erfahren so gut wie nichts über ihre politischen Ansichten. Die wenigen Ausschnitte aus ihren Reden zeigen sie ausschließlich polternd, nie ruhig und überzeugend redend, was sie ja auch kann. Nach dem Terroranschlag in Magdeburg tritt sie vor einer „aufgebrachten Menge“. Dass der Täter Islamist ist, wird von einem AfDler bestritten. Der sei „Islamhasser“ gewesen, sagt der „promovierte Islamwissenschaftler“.
Die ihr in die Hand gedrückte Rose legt sie dann doch nicht am Tatort ab, vermerken die Doku-Filmer, und zeigen das abfahrende Auto der Politikerin – „die Heimreise ist weit“, Sie wissen schon, die Schweiz… Aus Weidels harmlosem Gespräch mit Elon Musk nehmen die Staatsfunker nur mit, dass sie gesagt hat, Hitler sei kein Konservativer oder Libertärer gewesen (ersteres stimmt, letzteres hat nie jemand behauptet) und ihn als Kommunisten bezeichnet hat. Kronzeuge Gauland stellt fest, dass das falsch sei. Weidel, so der Kommentar aus dem Off, „hat die Grenze des Sagbaren verschoben“, sie hat „Hitler umgedeutet“.
Im Habeck-Film bekommt der Heiligenschein des Grünen ein paar Kratzer, Bauern, Jäger, Fischer protestieren gegen Naturschutzregeln, aber Habeck führt versöhnlich zusammen. Auch Gegner bescheinigten ihm damals (in seiner Zeit als Landesminister in Schleswig-Holstein), kenntnisreich und auf Kompromiss fokussiert gewesen zu sein. Landesvater Peter Harry Carstensen (CDU) hat ihn „sehr geschätzt“, er war ein „pfiffiger, ordentlicher Kerl, auf den man sich seinerzeit verlassen konnte“.
Robert Habeck beim monatlichen „Bürgeranruf“.
Dennoch gibt es Leute, die meckern. Ein Herr Fickinger vom Arbeitgeber-Verband Metall meint, Habeck habe der deutschen Wirtschaft nicht geholfen und nichts von dem umgesetzt, was unbedingt getan werden müsste. „Tatsächlich stagniert die deutsche Wirtschaft“, heißt es aus dem Off, „fast 3 Jahre ohne Wachstum, eine Welle von Insolvenzen, Angst um Arbeitsplätze“. Und mit einer solchen Bilanz will man Kanzler werden?Klar, sagt Habeck, seien Vorgänger sind schuld an der Lage, er habe nach Beginn des Ukraine-Krieges verhindert, dass die Wirtschaft noch tiefer eingebrochen sei. Sein einziger Fehler: Er habe „angesichts der Krise nicht groß genug gedacht“. Carstensen regt das heute auf. „Dieses ‚Ich muss noch’n bisschen lernen‘… Heizungsgesetz als Test für die Bevölkerung usw. Wir brauchen Lösungen, nicht Herumgeschnacke und das Geschwurbel bei irgendwelchen Diskussionsrunden.“
Das war’s dann aber auch mit der Kritik. Bis auf den „Heizhammer“, der Habeck um die Ohren flog, werden seine zahlreichen Missgriffe vom Graichen-Skandal bis zum Atom-Gutachten nicht erwähnt. Und schon gar nicht die serienweise erstatteten Anzeigen gegen Bürger wegen harmloser Beleidigungen wie „Schwachkopf“-Memes.
Habecks Jünger würde das ohnehin nicht stören. Wir sehen ihn beim Selfies-Schießen mit ihnen. „Habeck hat nichts gegen Nähe, die Personenschützer schon, so wie bei vielen Spitzenpolitikern.“ Dann folgt die Lesung aus dem Buch Robert: Habeck liest aus seinem jüngsten Werk „Den Bach rauf“. „Viele Bildungsbürger sind begeistert.“
Nicht so von Weidel, natürlich. In Überlingen hat man ein paar Leute aufgetrieben, die sie noch nie gesehen haben. Obwohl sie da angeblich ihren Hauptwohnsitz hat. Ha! Wie oft sie denn im letzten Jahr dort übernachtet habe? Weidel verweigert die Aussage, sie hat keinen Bock auf Suggestivfragen, auch wenn der Fernsehmensch immer wieder insistiert. Der rächt sich jetzt: „Wenn es für sie unangenehm wird, ist die Contenance schnell weg.“ Weidel sagt: „Das ist ‘ne Grünen-Hochburg hier. Die Leute haben, wenn sie politisiert sind, ein recht hohes Aggressionspotenzial.“
Offenbar fremdelt Weidel mit Überlingen. Sie weiß noch nicht einmal, wie viele Einwohner der Wahlkreis hat! Da müsste sie mal nachschauen. Parteikollegen vor Ort wissen das. Schnitt. Statt in der beschaulichen Bodensee-Region sehen wir sie beim AfD-Parteitag. Weidel will „zurück in ein anderes Deutschland, das Land radikal verändern“. Zum Beispiel fordert sie „Rückführungen im großen Stil“, so radikal wie Bundeskanzler Scholz. Ein Event „mit Fassbier (im Bild: grölende Teilnehmer) und Feindbildern“.
Dazu wird ein Bild von Friedrich Merz eingeblendet, der dämonisiert werde. Fast so wie bei ARD und ZDF, möchte man sagen. Weidel – „ein Wolf im Wolfspelz“, wie noch einmal der Schweizer Dino Pedolin sagt. Das freundliche Gesicht Weidels auf dem Wahlplakat, so endet der Film, ist nur eines ihrer vielen. Fehlte nur noch der eingeblendete Warnhinweis: Achtung, dieser Frau dürfen Sie auf keinen Fall vertrauen.
Dino Pedolin nennt Weidel „Wolf im Wolfspelz“.
In der Endphase des Films über Robert Habeck verhagelt der „Überfall eines psychisch kranken Asylbewerbers auf eine Kita-Gruppe“ dem Grünen die Wahlkampfstrategie. „Ab jetzt dominieren Migration und Sicherheit den Wahlkampf“, nicht gerade die Kernkompetenz der Grünen. Aber zum Glück bringt Merz im Bundestag einen Antrag ein, der „mit den Stimmen einer in Teilen rechtsextremen Partei“ angenommen wird. „Habeck wirkt persönlich betroffen.“ Er ist über den Doppelmord von Aschaffenburg ebenso entsetzt wie über den Move von Friedrich Merz. Nun ja.
Aber dann tritt er mit einem 10-Punkte-Plan zur Migration hervor, er „will gesprächsbereit bleiben“ und mit der CDU koalieren. Trotz seines legendären Charismas und der medialen Unterstützung sind die Umfragewerte „wie festgefroren“, aber der selbsternannte „Underdog“ kann als solcher „befreit aufspielen“. Der Abspann ist episch: Triumphale Musik, stürmischer Beifall, Habeck entschwindet in Slow Motion mit hochgerecktem Daumen aus dem Bild. Bündniskanzler.
Lesen Sie dazu auch: ARD und ZDF machen sich lächerlich




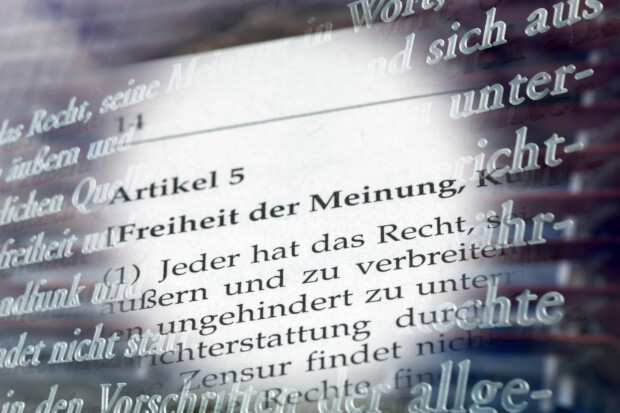





 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























