
In Europa wird weiter hitzig über das Verbrenner-Aus ab 2035 gestritten. Während Politiker und Konzernchefs vor wenigen Jahren noch von „Electric Only“ träumten, wächst nun die Panik: Deutschland drohte durch das Verbrenner-Aus zum „Armenhaus in Europa“ zu werden, warnte kürzlich der Porsche-Vorstand Lutz Meschke.
Das Verbrennerverbot ist ein Teil des europäischen „Green Deals“, den Ursula von der Leyen in Windeseile einführte. Der Autoindustrie verordnete sie damit eine rabiate Transformation: von einem auf den anderen Tag.
Die Geschichte des Verbrenner-Aus ist eine Tragödie, die von grünem Größenwahn erzählt, der von seiner Zerstörungswut nicht wissen will, weil er sich in einer historischen Mission wähnt: die Erde zu retten. Beseelt von der fixen Idee, gesamtgesellschaftliche Transformationsprojekte über Gesetze und Verordnungen realisieren zu können, beschloss die EU am 28. März 2023 endgültig das Verbrenner-Aus: Nach 2035 dürfen in die EU-Staaten keine Pkw mehr zugelassen werden, die mit Diesel oder Benzin fahren.
Innerhalb von zwölf Jahren soll die deutsche Automobilindustrie flächendeckend auf die neuartige Technologie E-Mobilität umstellen, damit Europa „bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent“ wird, so will es der European Green Deal, in dessen Rahmen das Verbrenner-Aus umgesetzt wurde. Mit dem „Fit for 55-Paket“ radikalisierte die EU-Kommission eine Verordnung zu CO2-Emissionsnormen dahingehend, dass neu zugelassene Autos ab 2035 keine Emissionen mehr freisetzen. Doch wer hat den grünen Masterplan eigentlich beschlossen?
Fakt ist: Die europäische Öffentlichkeit hatte nicht einmal die Gelegenheit, über den European Green Deal zu diskutieren. Eine politische Debatte, wie sie Demokratien vorsehen, bevor Regierungen großangelegte Gesetzesprojekte umsetzen, gab es nicht. Die EU-Bürger wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, als Ursula von der Leyen Mitte 2019 in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament ankündigte: „Deshalb werde ich in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit einen ‚Green Deal für Europa‘, eine ökologische Wende unserer Gesellschaft, vorschlagen. Gleichzeitig werde ich das erste europäische Klimaschutzgesetz überhaupt einbringen, das die Ziele für 2050 in Recht gießt.“ Noch am selben Tag, dem 16. Juli 2019, wurde sie vom EU-Parlament mit knapper Mehrheit gewählt.
Ursula von der Leyen bei ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament.
Buchstäblich von heute auf morgen war die grüne Transformation Europas eine beschlossene Sache – ohne dass die EU-Bürger darüber demokratisch abgestimmt hätten. Sie konnten nicht einmal wissen, was man mit ihnen vorhat. Denn bei der EU-Wahl im Mai 2019 war der Green Deal kein Thema gewesen. Wie die Google Trends zeigen, die dokumentieren, wie oft ein Begriff gegoogelt wurde, erlangte der „European Green Deal“ erst Aufmerksamkeit, nachdem er von Ursula von der Leyen unerwartet zum verbindlichen EU-Projekt gemacht wurde. Es hatte etwas von einem Staatsstreich.
Screenshot Google Trends
Genau genommen ist der Green Deal inhaltlich nicht einmal ein CDU-Projekt, wenngleich er von ihr verantwortet wird: Er ist Ursula von der Leyens Privatprojekt. Dazu muss man sich die skandalösen Vorgänge bei der EU-Wahl 2019 vergegenwärtigen: Von der Leyen stand auf keiner Wahlliste, sondern war seinerzeit noch Verteidigungsministerin. Als Spitzenkandidaten hatte die CDU/CSU Manfred Weber aufgestellt, gegen den sich der Europäische Rat, bestehend aus den Staats- und Regierungschefs der EU, jedoch entschieden wehrte. Diese brachten von der Leyen ins Spiel und nominierten sie schließlich als EU-Kommissionspräsidentin.
Ursula von der Leyen schmuggelte den Green Deal in die EU: Im Europawahlprogramm von CDU und CSU stand von einem Green Deal nichts, nicht einmal das Wort „grün“ kam darin vor. Selbst im Europaparteiprogramm der Grünen, die bei der EU-Wahl in Deutschland zweitstärkste Kraft wurden, tauchte der Begriff nur einmal auf. Die EU-Bürger bekamen über Nacht ein grün-autoritäres Wirtschaftsprogramm verordnet, das niemand gewählt hatte, ja nicht einmal dem Europaprogramm der Partei entsprach, der die neue EU-Präsidentin angehörte. Das führte zu der bizarren Situation, dass Friedrich Merz (CDU) seine Parteikollegin in „Welt am Sonntag“ frontal angriff: „Nie war die Energieversorgung in Deutschland teurer und unsicherer als genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die EU-Kommission ihren ,Green Deal‘ ins Werk setzen will.“
Zwar wurde der European Green Deal von oben herab durchgesetzt, doch hätte er nicht so viel Schaden anrichten können, wenn er nicht auf die Unterwürfigkeit der Autoindustrie getroffen wäre. Am 22. Juli 2021 verkündete Mercedes-Benz, die „Weichen für eine vollelektrische Zukunft“ zu stellen. „Mit diesem strategischen Schritt von ‚Electric first‘ zu ‚Electric only‘ beschleunigt Mercedes-Benz die Transformation in eine emissionsfreie und softwaregetriebene Zukunft“, so der Automobilkonzern im Sprech der EU.
Inzwischen hat die Realität das Unternehmen eingeholt. „Mercedes will auch nach dem Verbrenner-Verbot weiter Benziner und Diesel bauen“, meldete die Presse im vergangenen Juni. Auch VW glaubte, sich von Ursula von der Leyen einen „Fahrplan“ vorgeben lassen zu müssen, der ins klimaneutrale Utopia führt. „Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Volkswagenabsatzes in Europa reine E-Autos sein, das entspricht deutlich über eine Million Fahrzeuge. Damit würde Volkswagen die Vorgaben des EU Green Deal deutlich übererfüllen“, kündigte VW an. Auch hier kehrte Realitätssinn zurück: Im Juni investierte VW dann 60 Milliarden in neue Verbrennermotoren.
Volkswagen unterwarf sich den utopischen Zielen des Green Deals.
Auch die „konservative“ Politik ging nicht auf klaren Konfrontationskurs zu grünem Größenwahn. Besonders Markus Söder (CSU) fiel mit einem Hin und Her auf. Sprach er sich 2020 noch für das Verbrennerverbot aus, ist er inzwischen wieder dagegen.
In jüngerer Vergangenheit begnügt sich die politische Klasse nicht mehr damit, den Staat so zu verwalten, dass günstige Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Zusammenleben bestehen. Stattdessen neigt sie zu einer Hybris, die sich gesellschaftliche Rundumerneuerungen aufträgt und dabei vollkommen aus dem Blick verliert, was im Bereich des Machbaren liegt. Ursula von der Leyen sieht ihre Politik in der Tradition der größten Menschheitsfortschritte. Ihr „Green Deal“ sei mit der Vision der Mondlandung in den 1960ern vergleichbar: „Jemand hat mal gesagt: Das ist Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment“, so die Kommissionspräsidentin in einer Rede in Brüssel Ende 2019.
Die Welt gehorcht aber nicht dem Wunschdenken von Politikern und Bürokraten: „Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Uscale sind nur 41 Prozent der Befragten bereit, ihr Elektroauto Freunden oder Kollegen zu empfehlen. Knapp jeder Vierte würde sogar davon abraten, ein Elektrofahrzeug zu kaufen“, schreibt die Nachrichtenseite des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) und bilanziert: Die „wachsende Unzufriedenheit unter den Fahrern von Elektroautos verdeutlicht, dass die Hersteller in vielen Bereichen noch Verbesserungspotenzial haben. Insbesondere Reichweite, Ladeleistung und Softwarequalität bleiben Schwachstellen.“ Die technischen Schwächen bestehen demnach in den Grundfähigkeiten, für die Menschen sich ein Auto kaufen: zügig, unabhängig und spontan auch weite Strecken zu meistern.
Mitte 2019 wurde eine Verteidigungsministerin unerwartet Kommissionspräsidentin der EU, um als erste Amtshandlung einen zuvor unbekannten grünen „Masterplan“ in Angriff zu nehmen, der sogar der Politik widersprach, mit der ihre eigene Partei zuvor Wahlkampf gemacht hatte. Doch die deutsche Automobilindustrie beugte sich von der Leyens Alleingang, womit sie an ihrem eigenen Niedergang mitarbeitete, der aufgrund des planwirtschaftlichen Elektrozwangs absehbar war. Die massenhaften Entlassungen in der VW-Krise sind das traurige Ergebnis davon.
Lesen Sie auch Louis Hagens Kommentar:Das Volkswagen-Drama: Wie konnte das nur passieren?





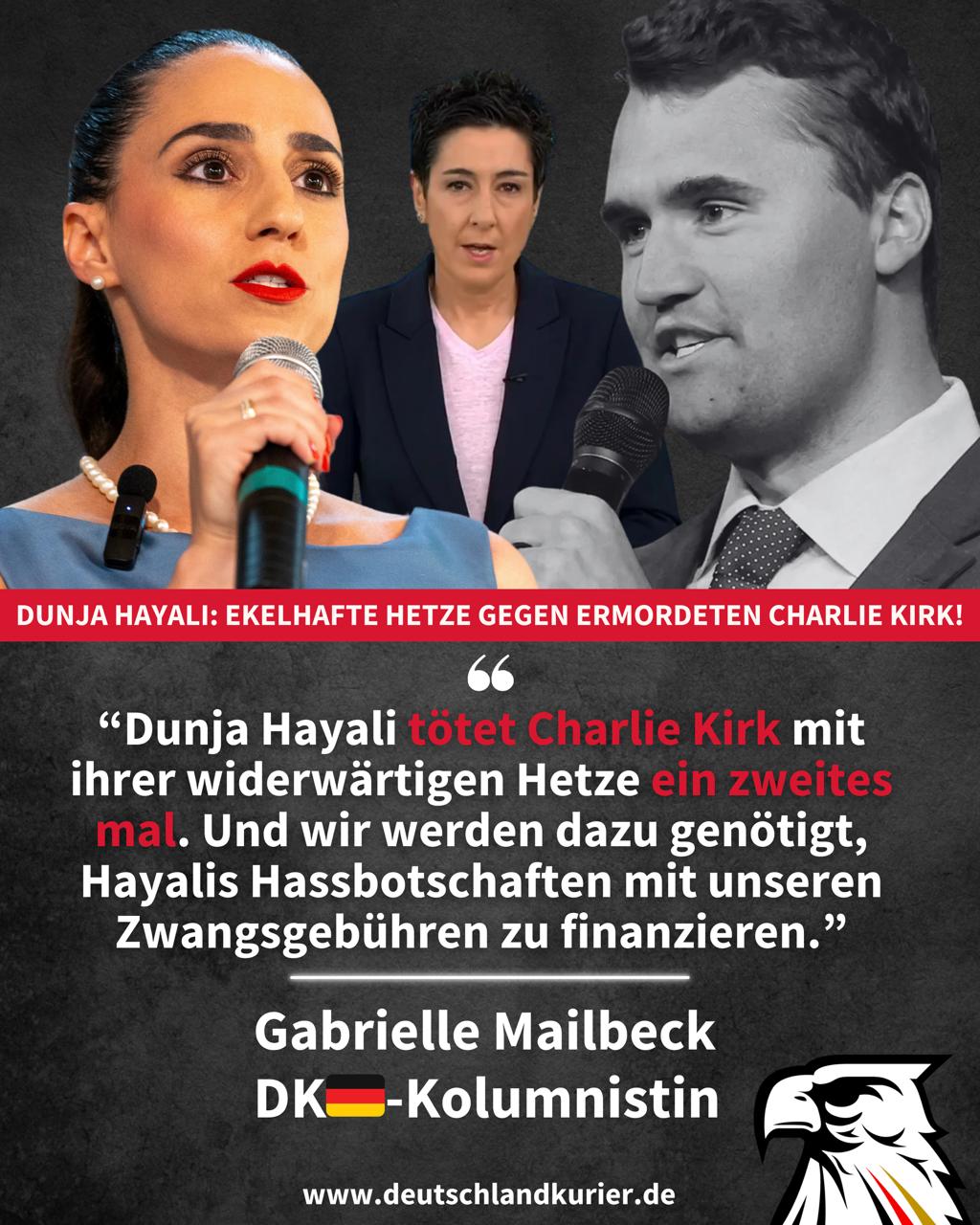




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























