
In einem Format des Mitteldeutschen Rundfunks plädiert ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für eine Regulierung von Memes – also humoristischen Bildern – im Netz. Statt eines „Marktplatzes der Ideen“ solle es künftig Einschränkungen der Reichweite geben. „Es gibt kein Recht auf Gehört-Werden in sozialen Medien“, erklärt der Forscher. NIUS fragte bei erfolgreichen Meme-Seiten nach, was sie davon halten.
Maik Fielitz, Experte für Digitalkultur und Rechtsextremismus am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, steht im Zentrum der Diskussion. Das Institut wird vom Bildungsministerium gefördert, während sein Träger, die umstrittene Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS), zusätzlich finanzielle Unterstützung vom Familienministerium, unter Lisa Paus (SPD) erhält. 2023 erhielt die AAS mehr als 6 Millionen Euro Zuwendung aus öffentlicher Hand.
Mehr dazu: Kurz vor Regierungsende: Mit diesem Trick versorgt Lisa Paus linke Organisationen mit Millionen
Im MDR-Format „MEDIEN360G“ wird Fielitz gefragt, ob Memes politisch sind. Der Forscher: „Ja. Visuelle Kultur ist eigentlich immer auch politisch. Auch, wenn wir popkulturell gucken, welche Bilder genommen werden, welche Personen abgebildet werden. Das ist immer eine politische Entscheidung in gewisser Art und Weise. Selbst, wenn das besonders harmlos wirkt.“ Weiter sagt er: „Als Beispiel: Wenn wir in irgendeiner Diskussion über Hautfarbe oder Herkunft ein Meme nehmen, was jemanden mit einer dunklen Hautfarbe abbildet, hat das sofort eine Konnotation. Egal welche Form, welche Handlung er da im Endeffekt vollzieht.“
Fielitz erklärt, dass Memes „edgy“, also provokant seien, und dass das gerade Rechte dazu einlade, sie zu nutzen und zu erstellen. „Da dann gewisse Grenzen der politischen Korrektheit zu durchbrechen, das ist in Memes sehr stark angelegt. Weshalb es sehr dazu einlädt, dass es von rechten Leuten genutzt wird, um eine gewisse Gegenreaktion zu erlangen“, so Fielitz.
Der Grat zwischen Humor und Straftat ist in Deutschland sehr schmal. Dieses Meme eines unbekannten Autors stellt diese Tatsache auf humorvolle Weise dar.
Während Fielitz sich ausführlich über „rechte Memes“ auslässt, vergisst er dabei die Massen an linken Memes, eins kontroverser als das andere. Auf die Frage, ob es ohne Memes weniger Hass im Netz gebe, antwortet der Forscher mit einem Bezug zum Faschismus und der visuellen Kultur rund um die Ästhetisierung dieser totalitären Ideologie: „Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie digitale Kommunikation ohne Memes heute passiert, und auch rechtsextreme und rassistische Kommunikation ist sehr schwer vorstellbar ohne bildliche Propaganda. Das zieht sich durch. Von den frühen faschistischen Bewegungen und vom Nationalsozialismus über die Nachkriegszeit bis heute. Es gab schon immer eine Ästhetisierung des Politischen, die Worte im Endeffekt überflüssig macht und sehr viel stärkere Direktheit in der Kommunikation in sich trägt.“
Die historische Verwendung von futuristischer Kunst und Agitprop durch die Kommunisten – die in linksextreme Memes mündet – lässt der Forscher außen vor. Möglicherweise, weil diese Benennung von Tatsachen sein Narrativ, Memes würden von Rechten eingesetzt und müssten daher reguliert werden, ins Wanken bringen würde.
Ein linksextremes Meme aus dem Netz verhöhnt die Opfer des kommunistischen Gulag-Systems.
„Das Meme-Zeitalter begann in gewisser Art und Weise in einem vollkommen unregulierten digitalen Kontext. Vor fünf, sechs Jahren konnte man noch Memes mit Hakenkreuzen auf sozialen Medien posten, und es wurde nicht gelöscht“, beklagt Fielitz und lässt dabei aus, dass Memes mit Hammer und Sichel oder anderen genozidalen Symbolen bis heute nicht moderiert werden.
Fielitz gesteht sich ein, dass ein Meme nicht verboten werden kann, daher gehe es ihm „viel mehr um das Einschränken von Reichweite.“ Es müsse nicht jede Nachricht einer globalen Öffentlichkeit zugespielt werden, erklärt der Meme-Kritiker. „Es gibt kein Recht auf Gehört-Werden in sozialen Medien. Man hat immer die Möglichkeit, sich einen eigenen Verlag zu bauen, sich eigene Produkte zu gestalten. Aber die Art und Weise, welche Inhalte weit fliegen und somit einflussreich werden, liegt heute in der Hand von wenigen Plattformen, die kaum demokratisch kontrolliert werden.“
Demokratisch kontrolliert, bedeutet in diesem Fall offenbar: Dass der Staat, die EU oder die „Trusted Flagger“ selektieren, welche Memes vom Algorithmus zugelassen und welche in ihrer Reichweite beschränkt werden.
Schauen Sie hier:
NIUS fragte bei Memeseiten im Netz an, was sie zu dem Thema zu sagen haben, um auch den bald vielleicht in der Reichweite eingeschränkten eine Bühne zu bieten.
Der libertäre Meme-Account „Rosarote Panzer“ verrät NIUS:
„‚Demokratisch kontrolliert‘ ist einfach totaler Blödsinn und heißt nur ‚Wir‘ wollen gern diejenigen sein, die über die Reichweite bestimmen. Das sagt ein Robert Habeck eigentlich auch recht offen. Der Trend im Internet geht allgemein aber eher in die Gegenrichtung: Leute wollen weder die Algorithmen von Zuckerberg noch von Musk bestimmen lassen, was sie zu sehen kriegen und künftig über Plattformen wie Nostr stattdessen lieber ihre Algorithmen selbst bestimmen. DAS ist in Wahrheit das Problem der nächsten Jahre. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Tech-Milliardäre haben das Know-How zu bestimmen, was wir zu sehen kriegen und eine Regierung mit Hang zur Stasi bekommt feuchte Augen, als hätte ihnen jemand die Betriebsanleitung in die Hand gedrückt, um 1984 zu basteln. Aber der Zug ist für unsere zur Digitalisierung völlig unfähige Regierung abgefahren. Die Zukunft ist open source.“
„Low Effort Zionist Memes“ ist die größte zionistische Meme-Seite auf Instagram. Zu NIUS sagt der Administrator:
„Der Impuls, Sprache und Gedanken einzuschränken, ist von Natur aus autoritär und sollte von jedem abgelehnt werden, dem die demokratische Gesellschaft am Herzen liegt, deren Fundament die freie Meinungsäußerung ist. Schlechten Ideen und Reden sollte mit besseren Ideen und Reden begegnet werden, nicht mit Zensur. Soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram und X sind unsere globalen Plätze für die freie Meinungsäußerung, es ist unmöglich, mit ihnen zu konkurrieren. Menschen, die nicht zu Gewalt aufrufen, von diesen Plattformen zu verbannen, ist eine absolute Form der Zensur, die nur noch mehr Kontroversen und Berühmtheit um die von ihnen verbreiteten Ideen erzeugen wird. Alles, was mit dem Verbot und der Begrenzung von Memen zu tun hat, ist autoritär und kontraintuitiv.“
Luc Schwarz, der den Philosophie-Memes-Account „Nihilismemes“ auf Instagram betreibt, sagt zu NIUS:
„Memes werden nicht als das erkannt, was sie sind: Ein wertvolles Kulturgut mit vielen Funktionen. Ich selbst verarbeite philosophische Themen in meinen Memes, ‚Edutainment‘ könnte man das nennen; und ich bekomme sowieso schon kein Geld dafür, warum dann auch noch meine Reichweite einschränken?“
Ein linker Meme-Account, der aufgrund einer Angst vor Repressionen anonym bleiben möchte, sagt zu NIUS: „Memes und der aus ihnen entstehende Diskurs sind ein, wenn auch sehr kleiner, Spiegel der Gesellschaft. Das Meme oder den Diskurs zu zensieren, löst auf der einen Seite das Problem nicht, durch das die Zensur hervorgerufen würde, und ignoriert bewusst das Echo, was Aufschluss über die Problematik geben kann.“
Damit spricht der linke Memepage-Admin einen wichtigen Punkt an, der bei der Einschränkung der Reichweite falscher Meinungen bzw. Memes auftritt. Wenn Zensoren nach dem Prinzip „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ verfahren und „verbotene“ Memes unterdrücken, verschwinden die dahinter stehenden Meinungen nicht. Das öffentliche Auge verliert nur die Wahrnehmung der allgemeinen Stimmung und schmiegt sich gemütlich in seine Echokammer.
Mehr NIUS: So finanziert Familienministerin Lisa Paus ein Antifa-Festival in Bamberg





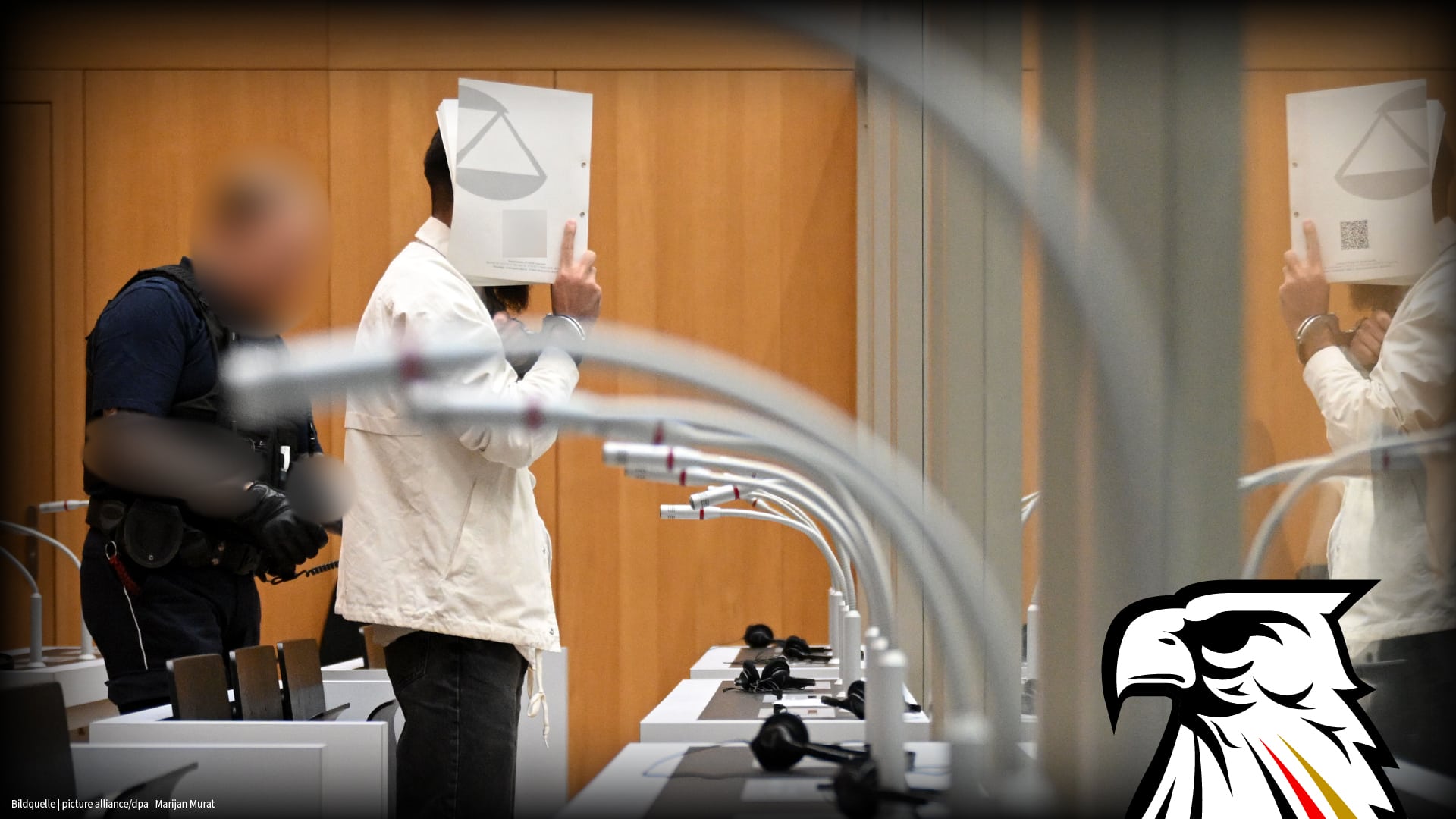




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























