
Die Europäische Union arbeitet gegenwärtig mit Hochdruck an der Einrichtung einer neuen Institution. Die Behörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben. Sinn und Zweck der Einrichtung soll es sein, Geldwäsche und Terrorismus zu bekämpfen. Schon in wenigen Monaten soll AMLA die Arbeit planmäßig aufnehmen und bis 2028 voll funktionsfähig sein. Präsentiert wird den Bürgern der EU dies als Instrument zur Schaffung von mehr Sicherheit. Tatsächlich könnte sich die Behörde jedoch als Kontroll-Einrichtung entpuppen.
Die Europäische Union ist bereit, AMLA beispiellose Durchgriffsrechte einzuräumen und höchst empfindliche Daten in ihre Hände zu legen. Wie durchgreifend das Vorhaben der EU ist, führte Mairead McGuinness, Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion, aus. Sie erklärte: „Zum ersten Mal werden alle Mitgliedstaaten an dieselben Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gebunden sein, und die AMLA wird eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung dieser Vorschriften spielen.“
Weiter erklärte sie: „Die neue Behörde wird Risiken und Bedrohungen innerhalb und außerhalb der EU überwachen, die nationalen Aufsichtsbehörden und zentralen Meldestellen koordinieren und bestimmte Finanzinstitute je nach ihrem Risikoniveau direkt beaufsichtigen.“ Was sich in den abstrakten Worten von McGuinness noch harmlos anhören mag, bedeutet in der Praxis die Einführung weitreichender Überwachungsmöglichkeiten und drastischer Eingriffsrechte. Bei Verstößen gegen Meldepflichten kann die Behörde Bußgelder von mindestens einer Million Euro verhängen, bei Banken sogar ab zehn Millionen Euro. Zudem soll sie die Macht erhalten, Konten zu sperren, Überweisungen zu blockieren und Hausdurchsuchungen anzuordnen.
Doch nicht nur das: Unter dem Vorwand der Geldwäschebekämpfung soll noch einmal mehr der einzelne Bürger ins Visier genommen werden. Die EU-Kommission hat 2021 eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um zu untersuchen, ob und wie ein zentrales Vermögensregister in der EU realisiert werden könnte. Im Fokus steht dabei, wie die Mitgliedstaaten aktuell Vermögensdaten erfassen und wie diese Informationen künftig zentral gesammelt, verknüpft und verwaltet werden könnten. Angedacht ist, ein solches Vermögensregister bei AMLA einzurichten. Erfasst werden sollen dabei sämtliche größere Vermögensgegenstände. Der Focus nennt eine Zahl von 200.000 Euro, ab deren Wert Vermögensgegenstände registriert werden sollen.
Wer Immobilien besitzt, ist im jeweiligen Grundbuch der Kommune registriert, und in der Steuererklärung müssen Einkünfte aus Kapitalanlagen und Immobilien angegeben werden – dies liefert bereits heute Anhaltspunkte für die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Banken und andere Finanzinstitute haben zudem einen Überblick über Ihre Konten und Depots, und diese Informationen können von den Finanzbehörden bei Bedarf abgefragt werden. Allerdings liegen diese Vermögensdaten bislang verstreut bei verschiedenen Stellen und werden nicht zentral zusammengeführt. Bei Umsetzung des EU-weiten Vermögensregisters hätte man deutlich tiefgreifendere Kenntnis über die Vermögen der Bürger. Zudem ließen sich entsprechende Informationen wesentlich einfacher abrufen.
Union und SPD bekennen sich im Koalitionsvertrag zur neuen EU-Behörde AMLA und planen darüber hinaus, ein „administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren“ einzuführen. Künftig sollen Behörden bei Verdacht auf unrechtmäßig erworbenes Vermögen leichter zugreifen können. „Verdächtige Vermögensgegenstände“ sollen demnach künftig einfacher konfisziert werden können. Im Bereich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung plant die neue Koalition bei Vermögen „unklarer Herkunft“ gar die „vollständige Beweislastumkehr“. Nicht mehr der Staat müsste dann beweisen, dass die Vermögenswerte aus illegalen Quellen stammen, sondern die Betroffenen selbst.
Brisant ist die Einführung eines Vermögensregisters auch vor dem Hintergrund eines Dokuments, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor rund einem Jahr herausgegeben hat. In dem Papier „Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen“ heißt es in Punkt drei des Maßnahmenbündels, dass man „Finanzquellen rechtsextremistischer Netzwerke austrocknen“ wolle. „Rechtsextremistische Netzwerke leben auch von Geld“, heißt es in dem Dokument. Deshalb sei es notwendig, einen umfassenden Überblick über ihre „Finanzierungsstrukturen“ zu gewinnen, denn nur so könnten die Netzwerke „zerschlagen“ werden.
Das geplante EU-Vermögensregister bei der AMLA birgt also nicht nur erhebliche Gefahren für die finanzielle Privatsphäre und Selbstbestimmung der Bürger, sondern könnte der Bundesregierung im „Kampf gegen Rechts“ auch gerade recht kommen. Mit dem Vermögensregister würde die Grundlage für eine lückenlose staatliche Kontrolle über sämtliche größeren Vermögenswerte geschaffen und zugleich weitreichenden Eingriffen in die Rechte der Bürger Tür und Tor geöffnet.





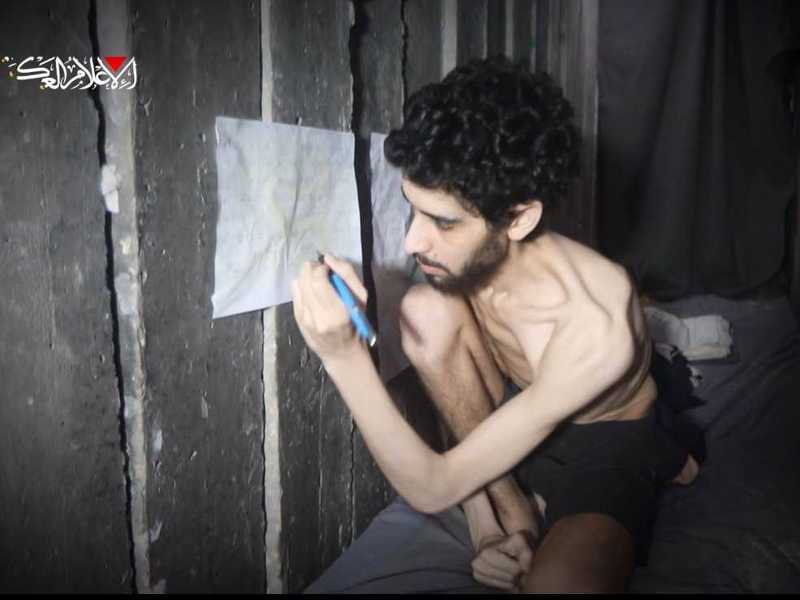

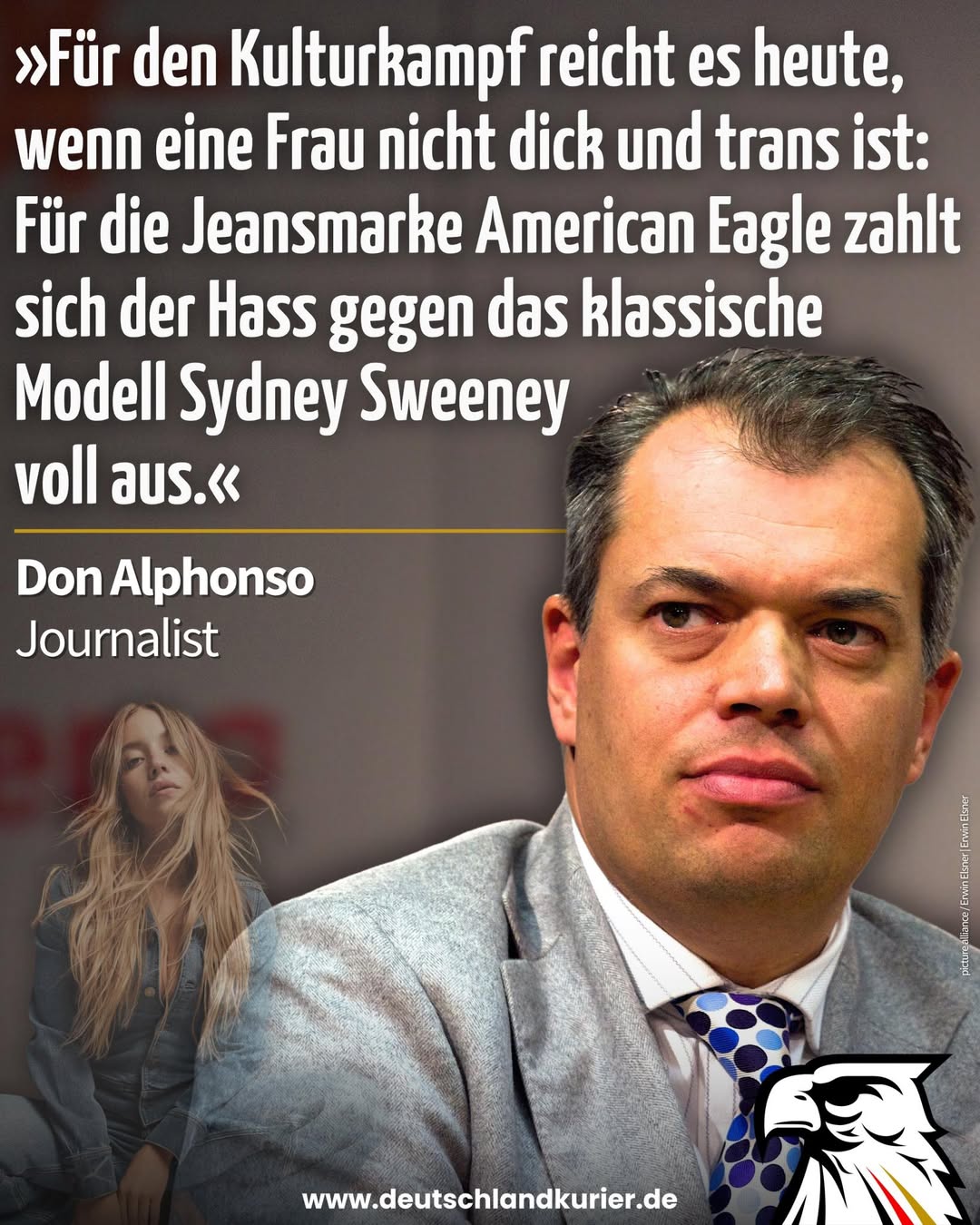


 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























