
Am Donnerstag traten die Strafzölle für chinesische Elektroautos in Kraft. Die Europäische Kommission hatte die “Ausgleichszölle”, wie die Kommission sie nennt, beschlossen, da sie der Ansicht ist, dass Elektroautos aus China der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Elektroautos schaden. Denn durch massive Subventionen würde China die Preise für seine E-Autos künstlich niedrig halten. Nach Angaben der Europäischen Kommission ist der Anteil der chinesischen E-Autos am EU-Markt von 2 auf 14 Prozent gewachsen. Die Strafzölle sollen für fünf Jahre gelten. Sie werden zusätzlich auf den regulären Zoll in Höhe von zehn Prozent aufgeschlagen. Für chinesische und deutsche Autofirmen fallen unterschiedlich hohe Strafzölle an.
Um die Situation in China zu ermitteln, wählte die EU-Kommission einerseits Autohersteller aus der Europäischen Union aus, die in China produzieren. Die Verkäufe machten im Untersuchungszeitraum 32 Prozent in der EU aus. Die Produktion der Autohersteller machte 30 Prozent während des Untersuchungszeitraums in der EU aus. Die europäischen Autohersteller wurden für die Stichprobe anonymisiert, da die EU chinesische Gegenmaßnahmen befürchtete. Außerdem wurden für die Stichprobe chinesische Autohersteller ausgewählt: BYD, Geely und SAIC.
Für die drei Firmen wurde je nach dem Ausmaß der chinesischen Subventionen und ihrer Kooperationsbereitschaft gegenüber der EU ein individueller SAzu vereinbart, wie es in der Durchführungsverordnung der EU-Kommission heißt. So muss BYD einen Ausgleichszoll von 17,0 Prozent zahlen; Geely zahlt einen Steuersatz von 18,8 Prozent. Da die Firma SAIC sich weigerte, Informationen offenzulegen, muss sie den Höchstsatz von 35,3 Prozent als Strafzoll zahlen. Für Firmen, die sich kooperativ zeigten, aber nicht Teil der Stichprobe waren, fällt pauschal ein Steuersatz von 20,7 Prozent an. Tesla stellte einen Antrag auf individuelle Ermittlung des Steuersatzes, dem stattgegeben wurde. Da Tesla kein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen betreibt, sondern selbstständig in China produziert, beträgt der Strafzoll 7,8 Prozent. Für Unternehmen, die nicht kooperieren, gilt ein Zollsatz von 35,3 Prozent. Laut ZDF gilt bis zur genaueren Prüfung für die deutschen Firmen wie VW, Mercedes oder BMW ein pauschaler Zollsatz von 21,3 Prozent. Die genannten deutschen Autohersteller haben ein Joint Venture mit chinesischen Autoherstellern.
Für VW stellt der Strafzoll erhebliche Probleme dar. Denn durch den Strafzoll wird der Verkauf des spanischen VW Cupra-Modells Tavascan wahrscheinlich stark zurückgehen. Um den Strafzoll auszugleichen, müsste der Preis für das E-Auto von 52.000 Euro auf 57.000 Euro erhöht werden. Das war für den CEO von Cupra, Wayne Griffiths, keine Option, wie er Reuters am 3. September sagte. Der Rückgang der Verkaufszahlen wäre ein Problem, weil VW ohne Tavascan nicht die CO2-Ziele in Europa erreichen kann. Wahrscheinlich muss VW dann hohe Strafzahlungen leisten. Die Strafzahlungen würden zur Folge haben, dass VW in Spanien Mitarbeiter entlassen müsste, wie Griffiths sagte. Eine Verlagerung der Produktion nach Europa sei nicht möglich, da VW viel Geld in das Werk Anhui in China investiert habe. „Damit wird die gesamte finanzielle Zukunft des Unternehmens aufs Spiel gesetzt“, sagte Griffiths. „Die Absicht war, die europäische Autoindustrie zu schützen, aber für uns hat es den gegenteiligen Effekt… Wir müssen eine Lösung finden.“
Als Reaktion auf die Strafzölle erhob China Strafzölle auf Importe von Brandy aus der Europäischen Union. Außerdem prüft die chinesische Regierung die Erhebung von Zöllen auf Milchprodukte und Schweinefleisch aus der EU. Zehn EU-Mitgliedsstaaten stimmten für die Strafzölle auf chinesische E-Autos, zwölf Staaten enthielten sich. Fünf Länder stimmten dagegen, darunter auch Deutschland. Um die Zölle zu verhindern, wäre eine qualifizierte Mehrheit von 15 Staaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, nötig gewesen.




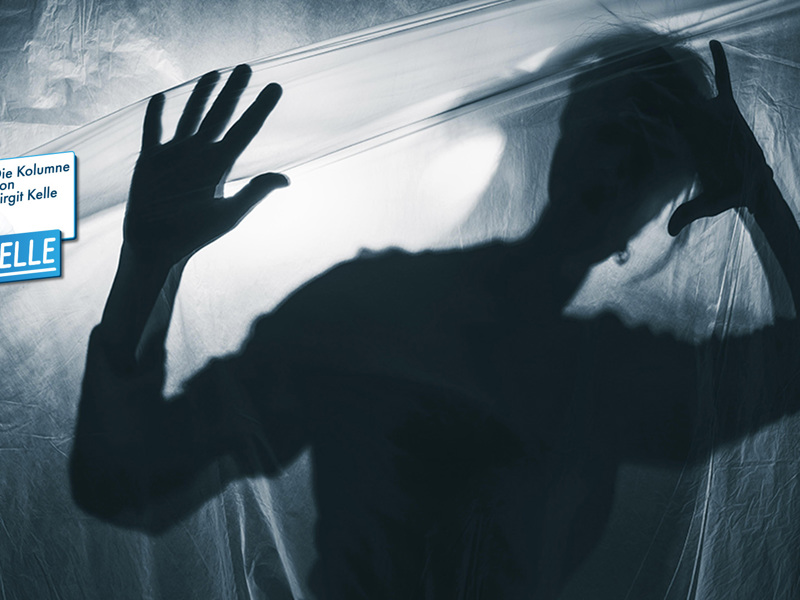



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























