
Sieben Wochen lang hat das US-Militär im Jemen ununterbrochen Stellungen der Huthi bombardiert. Das sind doppelt so viele Angriffe wie unter dem Vorgänger in über einem Jahr. Dann hörten die Bombardierungen plötzlich auf. Am 6. Mai erwähnte Trump bei einer Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister beiläufig, dass er eine Vereinbarung mit den Huthi-Rebellen im Jemen getroffen habe. „Wir werden die Bombardierungen einstellen“, fügte Trump hinzu.
Die Einigung soll nach der Erklärung des omanischen Außenministeriums die „Freiheit der Schifffahrt und den reibungslosen Ablauf des internationalen Handelsverkehrs“ gewährleisten. Von den Angriffen der Huthi auf Israel war darin nicht die Rede. „Freie Fahrt für die internationale Handelsschifffahrt im Roten Meer“, twitterte der omanische Außenminister Badr Albusaidi, der die Einigung vermittelt hatte. Kaum hatte der amerikanische Präsident verkündet, dass die jemenitische Rebellenbewegung nicht mehr kämpfen wolle, da meldete sich deren Führung zu Wort und erklärte: Die „Unterstützung“ für die Palästinenser im Gazastreifen werde weitergehen.
Seitdem sie sich im Zuge des Krieges im Gazastreifen auf die Seite der Hamas gestellt haben, inszenieren sich die vom Iran gelenkten Huthi als „Kämpfer für die palästinensische Sache“. Auf den arabischen Straßen werden sie dafür gefeiert, und in der vom Iran geführten „Achse des Widerstands“ haben sie ihre Position gestärkt.
Der heikle Punkt dabei ist, dass die Israelis im Vorfeld nicht über die Verhandlungen zwischen den Huthi und den Amerikanern informiert worden waren. Nach dem omanisch vermittelten Abkommen stellt sich nun die Frage, ob der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Konfrontation mit den Huthi nun alleine steht. Viele Beobachter spekulieren auch über einen möglichen Zusammenhang mit den amerikanisch-iranischen Verhandlungen über das Teheraner Atomprogramm. Diese sollen nach Economist-Informationen gut verlaufen sein – sehr zum Ärger Netanjahus, der das Problem gerne militärisch lösen würde.
Es lassen sich zahlreiche Gründe für den Kurswechsel des US-amerikanischen Präsidenten Trump anführen. Die Kosten der Kampagne gegen die Huthi-Rebellen, die auf eine Milliarde Dollar geschätzt werden, waren erheblich. Gerade zu einem Zeitpunkt, an dem der Besuch des Präsidenten in den Nahen Osten bevorstand, um für den Frieden zu werben, drohten Angriffe, den Konflikt zu eskalieren. Das Arsenal der Huthi an Langstreckenraketen wurde durch die amerikanischen Operationen zwar reduziert, aber nicht zerstört. Die Huthi sind nach wie vor die stärkste Kraft im Jemen. Die Anführer der Hamas und der Hisbollah, der anderen führenden Akteure der iranischen „Achse des Widerstands“, sind ausgeschaltet, nicht jedoch der Huthi-Führer Abdel-Malik al-Huthi.
Der Huthi-Krieg gegen die westliche Schifffahrt hatte dramatische Folgen: Experten schätzen, dass das Frachtvolumen durch das Rote Meer seit Beginn ihrer Angriffe im November 2013 um 70 Prozent eingebrochen ist. Die meisten großen Reedereien haben auf die neue Bedrohungslage reagiert und ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung und die Südspitze Afrikas umgeleitet. Dabei verlängerte sich die Route von Singapur nach Rotterdam um ein Drittel auf 21.850 Kilometer und um zehn auf 36 Tage.
Im Grunde war man sich in Washington bewusst, dass es mit Luftangriffen allein nicht gelingen dürfte, die Huthi zum Einlenken zu bewegen, und hatte mutmaßlich vor einigen Wochen geheime Verhandlungen aufgenommen. Trumps Schritt könnte auch ein Zeichen für die Frustration des US-Präsidenten mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sein, der auf Eskalation setzt, um vor allem seine Koalition in Israel vor dem Zusammenbruch zu bewahren, oder für Trumps Entschlossenheit, ein Abkommen mit dem Iran zu schließen.
Der unmittelbare Nutznießer der offensichtlichen Entspannung ist der Iran, aber auch Saudi-Arabien, das Trump diese Woche besuchen will. Nachdem das Huthi-Problem vom Tisch ist, scheint Trump einer Einigung mit den Ayatollahs näher denn je zu sein. Vor seiner Reise in die Golfregion ließ Trump verlauten, dass eine „sehr, sehr große Ankündigung“ bevorstünde.
Die Reise von Donald Trump nach Saudi-Arabien ist sein erster offizieller Staatsbesuch und seine zweite Auslandsreise seit seiner Wiederwahl und nach der Teilnahme an der Beerdigung des Papstes in Rom. Weitere Stationen sind Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Politisch stehen der Gaza-Krieg, die Frage der Einbeziehung Saudi-Arabiens in das Abraham-Abkommen, also die Normalisierung der Beziehungen zum Staat Israel, die Atomgespräche mit dem Iran sowie der Verteidigungspakt zwischen Riad und Washington im Vordergrund.
Viele Beobachter glauben, dass sich hinter Trumps Besuchen der kalkulierte Versuch der USA verbirgt, ihren Einfluss in Nahost wieder geltend zu machen und die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in einer Region neu zu ordnen, in der Peking ‒ Washingtons wichtigster wirtschaftlicher Rivale ‒ seine Position im Herzen des Petrodollarsystems stetig ausgebaut hat. Auffallend ist jedoch, dass Trump im Rahmen seiner Reise durch die Region keinen Besuch in Israel angekündigt hat. Hinzu kommt, dass die USA laut eines Berichts von Reuter nicht mehr fordern, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert, um die Gespräche über eine zivile Nuklearkooperation voranzubringen.
Ein Verzicht auf die Forderung, dass Saudi-Arabien diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt, wäre ein großes Zugeständnis Washingtons an die Saudis. Letztere streben einen strategischen Verteidigungsdeal mit den USA an. Unter dem früheren Präsidenten Joe Biden waren die Nukleargespräche Teil eines umfassenderen Abkommens zwischen den USA und Saudi-Arabien, das mit der Normalisierung der Beziehungen und dem von Riad angestrebten Verteidigungsabkommen mit Washington verknüpft war. Das Königshaus in Riad hatte wiederholt bekräftigt, dass es den Staat Israel nicht anerkennen werde, solange es keinen realisierbaren Pfad hin zu einem Palästinenserstaat gebe.
Interessanterweise haben sich die Atom-Gespräche zwischen Saudi-Arabien und den USA zu einem Zeitpunkt intensiviert, an dem der Iran und die USA ein Nuklearabkommen anstreben. Mit der Anerkennung des iranischen Nuklearprogramms unter der Bedingung einer massiven Einschränkung der Urananreicherung und der Zustimmung zum Bau einer Nuklearanlage in Saudi-Arabien scheint Trump ein regionales Gleichgewicht zwischen den beiden Rivalen im Nahen Osten herstellen zu wollen.



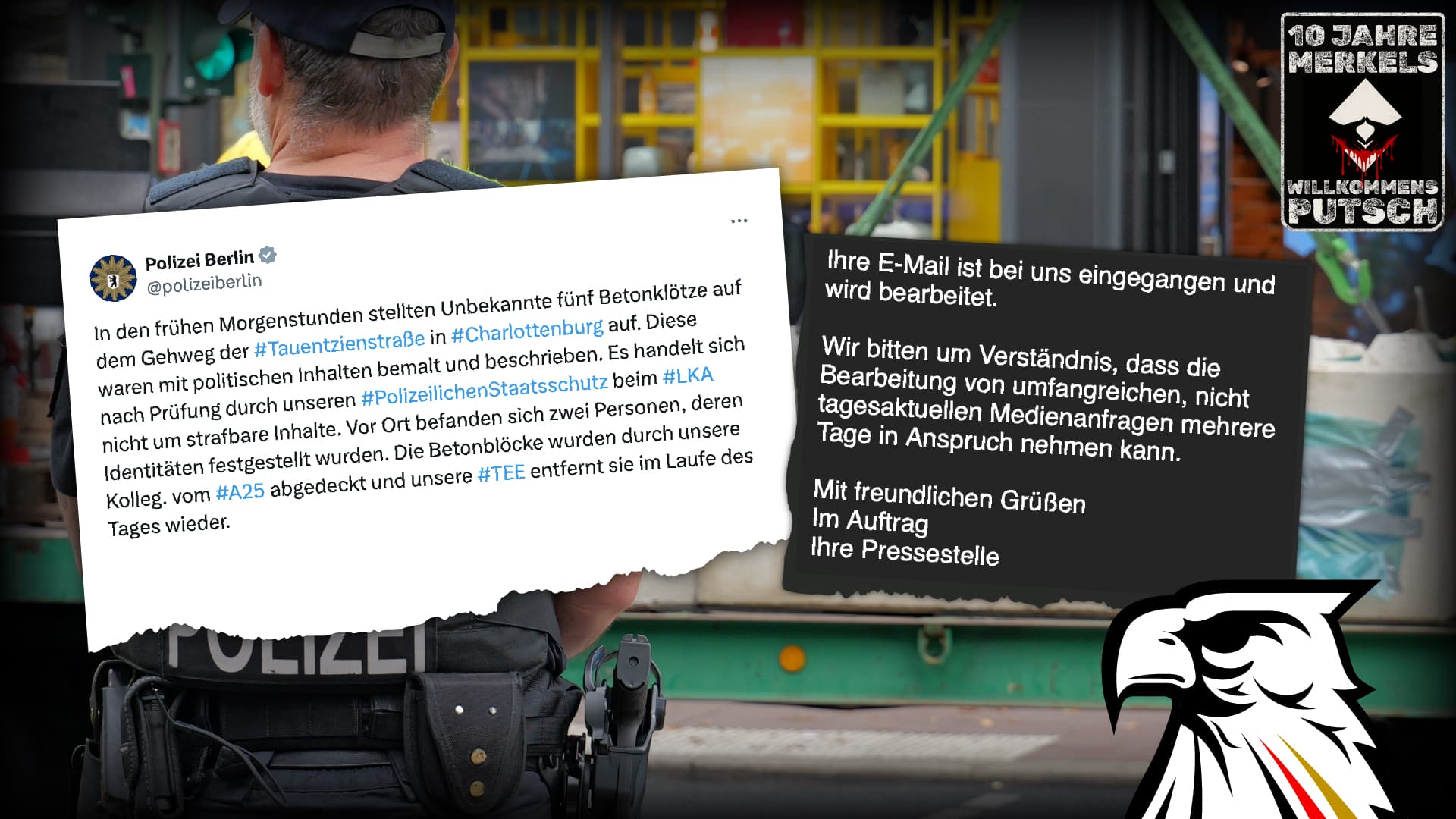





 PUTINS KRIEG: Heftige Verluste an Front! Russland und Ukraine liefern sich Gefechte | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Heftige Verluste an Front! Russland und Ukraine liefern sich Gefechte | WELT STREAM






























