
Mitte April erging in Großbritannien ein wegweisendes Urteil: Der Supreme Court stellte fest, dass im Hinblick auf Gleichstellungsgesetze nur biologische Frauen als Frauen zu gelten hätten.
Geklagt hatte die schottische Initiative „For Women Scotland“. Während sich schottische Feministinnen nun also freuen, musste die Frauenbewegung in Deutschland eine Niederlage in Kauf nehmen: Die Klagen der Aktivistinnen Stefanie Bode und Rona Duwe gegen die Bundesrepublik Deutschland wurden vor dem Kölner Verwaltungsgericht abgewiesen.
Beide hatten unabhängig voneinander geklagt, weil eine Broschüre, die sie 2023 veröffentlicht hatten, von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz als jugendgefährdend eingestuft und indiziert worden war – TE berichtete.
Sie hatten mit dem Elternratgeber „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ das Werk einer US-amerikanischen Autorin zusammengefasst und übersetzt, das Eltern Informationen und Mittel an die Hand geben soll, um Kinder vor Indoktrination und etwaigen Folgen zu schützen.
Gegenüber TE sagte Stefanie Bode, dass „die Broschüre einen Weg jenseits hoch umstrittener sozialer Transitionen“ aufzeige. Es gebe „hohen Bedarf bei komplettem Mangel an solchen Informationen“, wie sie die Publikation böte. Bode betonte, dass die hier zur Verfügung gestellten Informationen ideologiefrei seien, und Narrative wie die von falschen Körpern, „Genderseelen“, Geschlechtswechsel und Geschlechterspektrum in Frage stellen.
Dem Anliegen, die in Deutschland bestehende Informationslücke zu schließen, entsprach das Kölner Verwaltungsgericht nicht. Die Abweisung der Klage beruht unter anderem darauf, dass das der Broschüre zugrunde liegende Buch „Desist, Detrans, Detox: Getting your child out of the Gender Cult“ der US-Amerikanerin Maria Keffler die Transbewegung als „Kult“ einordne. Eine polemische Überspitzung, die im übertragenen Sinne aber nicht abwegig ist: Die Transbewegung kultiviert eine eigene Sprache und eigene Gesetzmäßigkeiten, die „dogmatisch“ aufgefasst und durchgesetzt werden: So wird zum Beispiel das Verständnis implementiert, dass jede Infragestellung der eigenen Gefühle durch Dritte diskriminierend sei, und eine Missachtung der eigenen Person darstelle – die viel sinnvollere Annahme, dass eine solche Infragestellung Sorge und Liebe ausdrücke, wird nicht nur kategorisch abgelehnt, sondern gar nicht erst in Erwägung gezogen.
Wichtiger ist aber die Frage, wieso eine solche Behauptung jugendgefährdend sein soll. Weder richtet sie sich an Kinder. Noch wird ein Kind gefährdet, weil seine Eltern die Transbewegung als Kult begreifen. Die Aussage leugnet nicht mögliche psychische Probleme und Erkrankungen oder dass sich Jugendliche mit ihrer Geschlechtlichkeit unwohl fühlen können, sondern, dass mit solchen Phänomenen in einer bestimmten, von Transaktivisten festgelegten Art und Weise umgegangen werden müsse. Dass der Transhype unter Jugendlichen sich nicht mit echter Geschlechtsdysphorie deckt, legen auch die Zahlen nahe, so schwierig auch genaue Angaben sind. Eine Gallupstudie von 2021 besagt etwa, dass circa 0,7 Prozent der Erwachsenen in den USA „transgender“ seien. 2022 identifizierten sich aber, ebenfalls laut einer Gallupstudie, 2,1 Prozent der zwischen 1997 und 2012 geborenen Jugendlichen als transgender.
Eine Diskrepanz, die auf höhere Instabilität von Jugendlichen hinweisen könnte – was es umso wichtiger machen würde, sie in dieser Phase in ihrer biologischen Geschlechtlichkeit zu bestärken, damit sich Dysphorie oder Unbehagen wieder auflösen können; oder aber, dass besonders Jugendliche Inhalte konsumieren, die sie zu Zweifeln bezüglich ihres Geschlechts anleiten. Beide Interpretationen sprechen also gegen die Konfrontation von Jugendlichen mit Transgenderideologie und dafür, Eltern dabei zu unterstützen, Kinder dem Einfluss solcher Inhalte zu entziehen.
Das Verwaltungsgericht Köln sieht das anders. Streckenweise liest sich die TE vorliegende Urteilsbegründung geradezu zynisch: So wird als jugendgefährdend eingeordnet, was dazu „geeignet sei, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren“. Eine größere Desorientierung als das eigene Geschlecht zu verkennen, ist kaum denkbar. Transideologen versuchen, jeden, der Zweifel an der entsprechenden Selbstidentifikation übt, als transphob und diskriminierend darzustellen: Eine Verdrehung „sozialethischer“ Werte also, die Kindern ein falsches Verständnis davon vermittelt, was echte Diskriminierung ist.
Sie werden gefährdet, indem ihnen nahegelegt wird, dass Zweifel am biologischen Geschlecht normal und anzunehmen seien, Zweifel am empfundenen Geschlecht aber seien „sozialethisch“ falsch.
Im Mai 2024 beschloss auch der Deutsche Ärztetag, die Bundesregierung dazu aufzufordern, den Einsatz von Pubertätsblockern, Hormontherapien und operativen Geschlechtsumwandlungen restriktiv zu handhaben, und „nur im Rahmen kontrollierter wissenschaftlicher Studien und unter Hinzuziehen eines multidisziplinären Teams sowie einer klinischen Ethikkommission und nach abgeschlossener medizinischer und insbesondere psychiatrischer Diagnostik und Behandlung eventueller psychischer Störungen zu gestatten“. Auch die Regelungen des Selbstbestimmungsgesetzes hatte er im Hinblick auf Minderjährige kritisiert. Gewichtige Stimmen also, die eine Neubewertung der Indizierung vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse – die man freilich auch 2023 bereits hätte herleiten können – problemlos gerechtfertigt hätten.
Das Gericht stellt fest, dass „Regelungen des Jugendschutzes Gefährdungen der Persönlichkeitsentwicklung entgegenwirken [sollen]“, um dann die Indizierung einer Publikation als rechtmäßig zu betrachten, die sich gerade dagegen wendet, die Entwicklung von Kindern durch die Gabe von Pubertätsblockern zu verhindern. Sodann wird als „von erheblicher Bedeutung“ betrachtet, „dass die Broschüre gerade nicht als differenzierende Stimme wahrnehmbar sei, die vor möglicherweise missbräuchlichen Geschäftspraktiken im Einzelfall warne, sondern Transsexualität grundsätzlich dem Kultischen zurechne“.
Bitter, hatten doch die Klägerinnen auf die Einseitigkeit jener Publikationen hingewiesen, die Transsexualität propagieren: Wer staatlich geförderte, teils vom Staat verantwortete Texte zu diesem Thema liest, stellt fest, dass diese keinerlei Differenzierung vornehmen, und in tatsächlich quasireligiöser Weise die Transideologie vertreten. Der Hinweis der Kläger, dass „zahlreiche Broschüren mit entgegengesetzten Inhalten, (…) nicht als jugendgefährdend eingestuft seien“, wird als irrelevant abgetan, und damit die Implikation, dass hier mit zweierlei Maß gemessen werde. Dabei müsste für eine breite gesellschaftliche Diskussion beiden Positionen die Möglichkeit eingeräumt werden, die eigene Haltung pointiert darzustellen. Aber auch die Meinungsfreiheit sieht das Gericht nicht verletzt.
Worin, abgesehen von der Diagnose, dass es sich bei der Transideologie um einen (Pseudo-)Kult handele, die jugendgefährdende Qualität der Broschüre liegen soll, bleibt in der Urteilsbegründung völlig im Dunkeln. Für Stefanie Bode ist daher klar: Sie will weiterkämpfen – und beim Oberverwaltungsgericht Berufung gegen die Entscheidung einlegen.






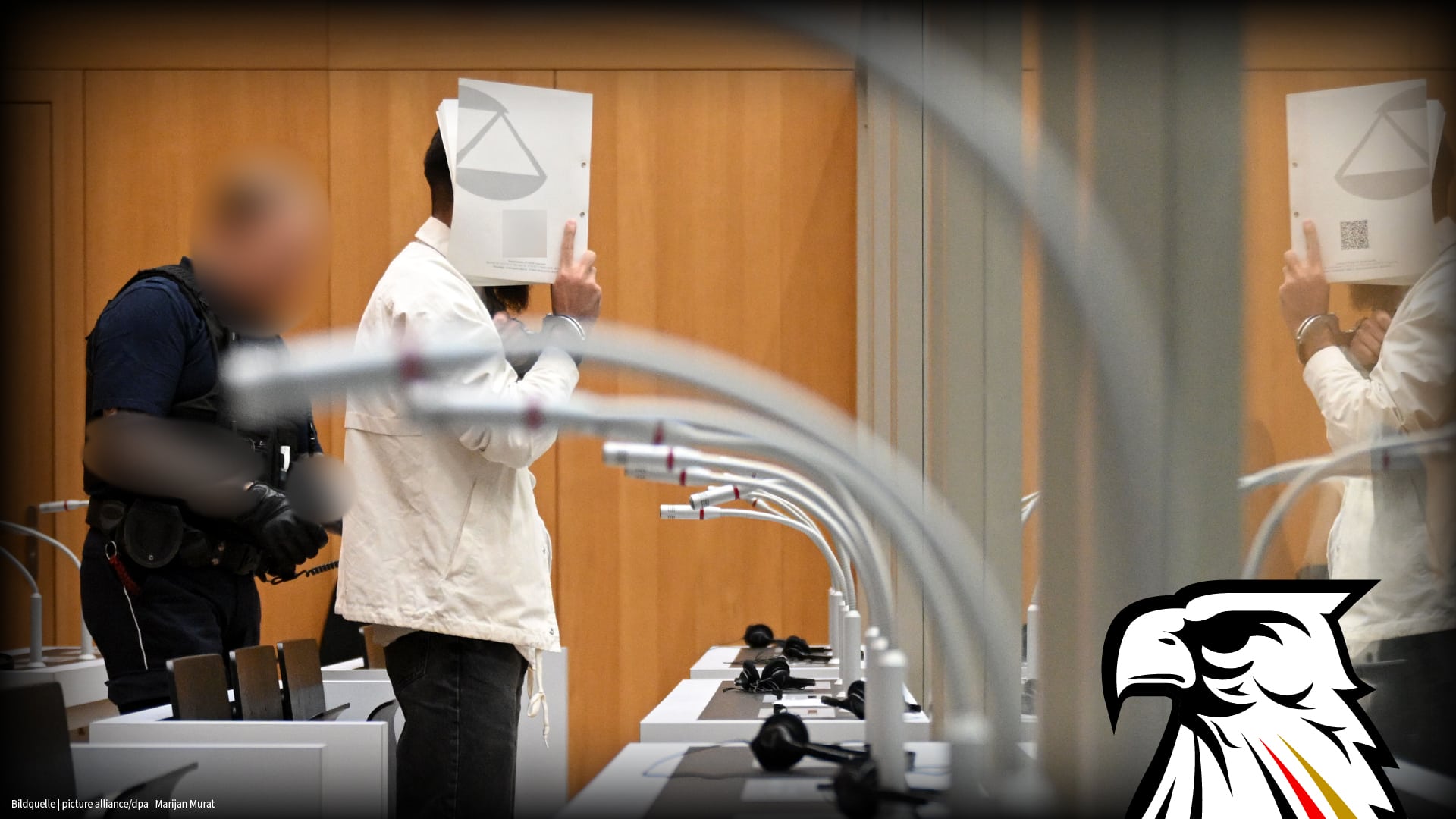


 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























