
Bei der Union ist die Kür des Kanzlerkandidaten gelaufen: CDU-Chef Friedrich Merz zieht für CDU und CSU in den Wahlkampf, obwohl beispielsweise CSU-Chef Markus Söder die höheren Beliebtheitswerte hatte. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) lag zeitweise deutlich vor Merz. Jetzt ringen die Sozialdemokraten mit der Entscheidung, ob sie Kanzler Olaf Scholz oder den beliebtesten deutschen Politiker, Verteidigungsminister Boris Pistorius als Spitzenkandidat nominieren sollen.
Aber warum stellen Parteien nicht einfach ihre beliebtesten Kandidaten auf?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Da ist zuerst das Beliebtheitsranking selbst. In ihm taucht in der Regel nur auf, wer von den Umfrageinstituten in eine Liste aufgenommen und überhaupt abgefragt wird. Gibt man keine Namen vor, so gewinnen immer die bekanntesten Politiker, weil viele Menschen die Vertreter der Parteien kaum kennen. Angela Merkel kannte nahezu jeder, sie führte deshalb sowohl die Liste der beliebtesten als auch die Liste der unbeliebtesten Politiker an. Hinzu kommt, dass die Platzierungen oft sehr dicht beisammen liegen.
Angela Merkel
Wenn ein Politiker von Platz vier auf Platz drei springt, kann es gut sein, dass der Zuspruch im Vergleich zur letzten Befragung von 38,4 Prozent auf 38,8 Prozent gestiegen ist, während der ehemals Drittplatzierte einige Zehntel verloren hat. Solche Unterschiede liegen unterhalb der Fehlertoleranz, und man ist gut beraten, darauf keine wichtigen Personalentscheidungen zu gründen.
Hinzu kommt: Hohe Beliebtheitswerte kommen auch zustande, weil viele Befragte einen Politiker sympathisch finden, die niemals dessen Partei wählen würden. Während Angela Merkel häufig bis zu knapp 80 Prozent in den Umfragen erhielt, erreichte die Union bei Wahlen bis auf eine Ausnahme 2013 durchweg die schlechtesten Werte der Nachkriegszeit.
Auch deshalb gibt es in der Politik eine eigene interne Logik bei der Kandidatenkür, die mit den Wählerwünschen wenig bis gar nichts zu tun hat. Diese Logik besagt unter anderem, dass der Amtsinhaber von Spitzenämtern so lange wieder automatisch der Spitzenkandidat ist, wie dem keine Amtszeitbegrenzung entgegensteht oder er freiwillig (z.B. in den Ruhestand) ausscheidet. Von den deutschen Kanzlern der Nachkriegszeit ist nur Angela Merkel freiwillig nicht mehr angetreten.
Ein Auswechseln der Frontleute aus Beliebtheitsgründen wäre das offene Eingeständnis, einen schlechten Amtsinhaber gehabt und als Partei versagt zu haben. Wer wählt schon eine Truppe, die einen Verlierer ins Amt hievt. In der Realität bleiben Regierungschefs deshalb so lange im Amt, bis sie abgewählt werden. Auch in der SPD gibt es Stimmen, die eine Abkehr von Olaf Scholz als „Königsmord“ bezeichnen. Für gewöhnlich gehen Parteipolitiker davon aus, dass die Parteibasis sich aus Eigeninteresse am Erfolg der Partei loyal, d.h. stumm hinter dem Spitzenkandidaten versammeln und Zweifel herunterschlucken. Je schlechter die Umfragewerte sind, desto blanker liegen die Nerven, desto mehr bröckelt die schweigende Geschlossenheit.
Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat der Union.
Am Ende spielen in die Personalentscheidungen auch noch Karriere-Interessen der Parteifreunde eine Rolle: Einen schwachen Amtsinhaber ins Rennen zu schicken, der absehbar scheitert und nach einem miserablen Wahlergebnis zurücktreten muss, macht den Weg frei für ehrgeizige Nachfolger, die dann auf aussichtsreiche Posten nachrücken.
Das viel gescholtene Wahlsystem in den USA hat für dieses komplizierte Kandidaten-Karussell eine andere Lösung: In Vorwahlkämpfen müssen die Interessenten öffentlich und offen gegen einander antreten und zeigen, ob sie die Massen begeistern können. Klüngel der Parteiführung können am Ende die Lieblinge der Basis nicht mehr verdrängen. Kritiker könnten einwenden, dass auf diese Weise auch Donald Trump zum Kandidaten der Republikaner geworden ist. Dass die Personalie nicht erfolgreich gewesen wäre, kann man angesichts des Wahlergebnisses allerdings nicht behaupten. Es sei, denn man hält das Wahlvolk für dumm und unverantwortlich. Dann freilich müsste man noch einmal grundsätzlich über Demokratie als solche diskutieren.
Lesen Sie auch:Exklusiv-Umfrage: Deutsche sehen Trump und Merz negativ







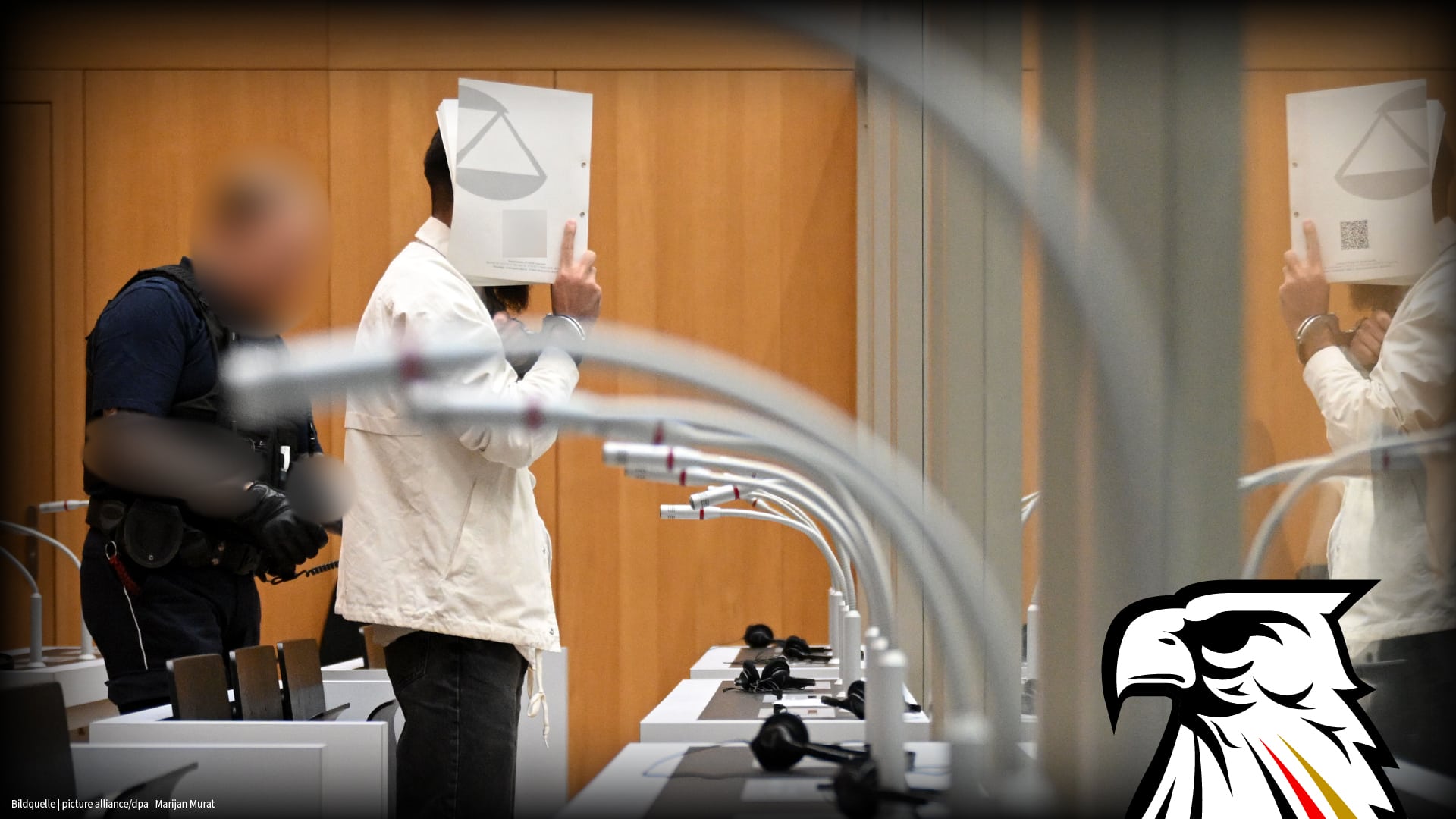


 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























