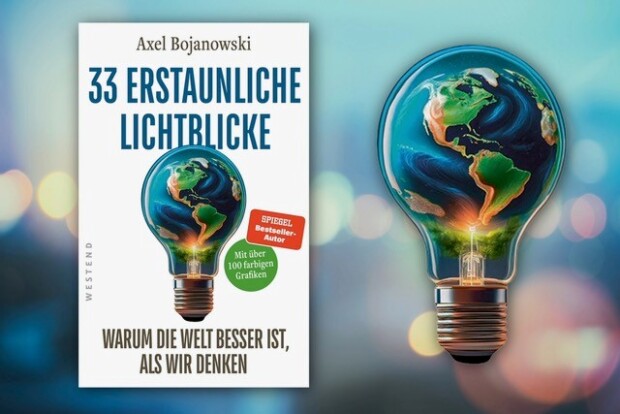
»Es sollte keine Milliardäre geben«, sagt US-Senator Bernie Sanders – aber ein Ökonom kontert: Alle seien Milliardäre. Er erzählt eine Erfolgsgeschichte: Moderne Menschen verfügen über spektakulären Reichtum, der ihnen nicht bewusst ist. Das hat etwas mit Bleistiften zu tun.
»Schauen Sie sich diesen Bleistift an«, sprach Milton Friedman in die Kamera. »Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der diesen Bleistift herstellen könnte.« So beginnt ein mittlerweile bekanntes Video von 1980, in dem der berühmte US-Ökonom erklärt, warum Marktwirtschaft Menschen reich gemacht hat.
»Das Holz, aus dem der Bleistift gemacht ist«, fuhr Friedman fort, »stammt nach allem, was ich weiß, von einem Baum, der im Bundesstaat Washington gefällt wurde.« Um diesen Baum zu fällen, habe es eine Säge gebraucht, und um die Säge herzustellen, Stahl, und für Stahl sei Eisenerz nötig gewesen. Und bei dem »Blei« handele es sich eigentlich um Grafit, das vermutlich aus einer Mine in Südamerika stamme.
»Dieser rote Deckel hier, dieser Radiergummi, stammt wahrscheinlich aus Malaya, wo der Gummibaum nicht einmal heimisch ist«, erzählte Friedman. »Er wurde von einigen Geschäftsleuten mithilfe der britischen Regierung aus Südamerika importiert.« Und die Messingzwinge? Der Ökonom lächelte: »Ich habe nicht die geringste Ahnung, woher sie kommt.«
Der Ökonom bilanzierte: »Wenn Sie in den Laden gehen und diesen Bleistift kaufen, tauschen Sie im Grunde ein paar Minuten Ihrer Zeit gegen ein paar Sekunden der Zeit all dieser Tausenden von Menschen.« »Was hat all die Menschen zusammengebracht, um bei der Herstellung des Bleistifts zusammenzuarbeiten?«, fragte Friedman.
»Es gab keinen Kommissar, der Bestellungen von einer zentralen Stelle verschickte. Es war die Magie des Preissystems: die unpersönliche Funktionsweise der Preise, die sie zusammenbrachte und sie dazu veranlasste zusammenzuarbeiten, um diesen Bleistift herzustellen, sodass man ihn für eine unbedeutende Summe haben konnte«, erklärte Friedman.
Deshalb sei das Funktionieren des freien Marktes so wichtig. »Nicht nur, um die produktive Effizienz zu fördern, sondern vor allem, um Harmonie und Frieden unter den Völkern der Welt zu fördern«, erläuterte der Ökonom in seiner Rede, die eine Hommage an seinen Mentor Leonard Read sein sollte, der das Bleistift-Beispiel 1958 ersonnen hatte.
Read hatte zahlreiche weitere Phänomene genannt, etwa Postdienst, Automobilbau, Mähdrescher, Telefonleitungen. Alle seien Beweis dafür, dass unregulierte Märkte auf natürliche Weise das bestmögliche Ergebnis für den Einzelnen erzielten.
Das System habe die Menschen der westlichen Welt zu Milliardären gemacht, ohne dass ihnen das bewusst sei, schreibt der Wirtschaftshistoriker Gale Pooley von der Utah Tech University gerade. »Wir haben vielleicht keine Milliarde Dollar auf der Bank, aber wir genießen die Vorteile von vielen Milliarden Dollar, die in unserem Namen investiert werden«, erläutert er.
Viele Produkte haben hohe Fixkosten, aber niedrige Stückkosten, wenn sie in großem Maßstab hergestellt werden. Die Kosten für die Entwicklung eines neuen Medikaments etwa können zwei Milliarden Dollar betragen. Sobald ein Medikament zugelassen sei, liege sein Stückpreis nicht selten unter einem Dollar, bemerkt Pooley. Die moderne Gesellschaft genieße Reichtum durch den Zugang zu Produkten mit hohen Fixkosten. Technologie und Innovationen ermöglichten es, dass etwa Smartphones oder Medikamente für die meisten erschwinglich würden, was die Fähigkeit des Kapitalismus verdeutliche, »gemeinsamen Wohlstand zu erzeugen«.
Als Johannes Gutenberg 1440 den Druck erfand, kostete ein durchschnittliches Buch etwa 135 Tage Arbeit. Ein durchschnittlicher Arbeiter mit Achtstundentag musste mehr als 200 Stunden arbeiten, um sich ein Buch leisten zu können. Druckerpresse, immer günstigere Zulieferprodukte wie Papier, Digitalisierung und ein wachsendes Publikum haben Bücher zur Massenware gemacht.
Je mehr Menschen es gäbe, desto billiger würden Waren – denn es gäbe mehr Käufer, schreibt Pooley: Mit wachsendem Markt für ein Produkt verringert sich sein Stückpreis. »Wir können Produkte mit so hohen Fixkosten und niedrigen Stückkosten genießen, weil es so viele von uns gibt.«
Mit seinem Text reagierte Pooley auf eine Aussage des politisch links stehenden US-Senators Bernie Sanders, der auf »X« geschrieben hatte: »Es sollte keine Milliardäre geben.« Eine Irreführung, meint Pooley: »Im Vergleich zu vor 100 Jahren sind die Vereinigten Staaten ein Land, in dem jeder Milliardär ist« – weil man sich Produkte leisten könnte, deren Herstellung mehr als eine Milliarde Dollar gekostet habe.
Auszug aus: Axel Bojanowski, 33 erstaunliche Lichtblicke. Warum die Welt viel besser ist, als wir denken. Westend Verlag, Klappenbroschur, 192 Seiten – mit über 100 farbigen Grafiken, 23,00 €.







 DEUTSCHLAND: Es brodelt! Söders CSU nach Israel-Waffenwende sauer! WELT STREAM
DEUTSCHLAND: Es brodelt! Söders CSU nach Israel-Waffenwende sauer! WELT STREAM





























