
Fehler? Welche Fehler? Für Gespräche mit Angela Merkel braucht man eine komplizierte Entschlüsselungstechnik. Die offizielle Buchpremiere ihrer Erinnerungen („Freiheit“, Kiepenheuer & Witsch) im Deutschen Theater machte da keine Ausnahme. Drei Jahre ist Merkel nun nicht mehr im Amt, und es war doch wieder alles wie früher: Anne Will befragte die Kanzlerin, die Kanzlerin zog ihre rhetorischen Kreise und ließ die vom politischen Dachboden geholten und eigens entstaubten Dechiffriermaschinen wieder einmal heißlaufen.
Merkels Markenzeichen: Nicht die Antworten sind interessant, sondern wie sie etwas sagt und was sie nicht sagt. Man habe den Eindruck, sagt Moderatorin Anne Will zum Ende des Gesprächs, dass die Kanzlerin a.D. kleine Pannen zugebe, zu den großen Fehlern aber schweige. Das sieht Merkel naturgemäß nicht so. „Es ist mir ja nicht gelungen, mit demokratischen Mitteln zu einem guten Klimaschutz zu kommen“, sagt sie.
Die Wahrheit ist, dass Merkel – richtigerweise – immer klar war, dass Klimaschutz nur solange populär ist, wie er nichts kostet und niemandem etwas abverlangt. Danach richtete sie ihre Politik aus. Man muss Moderatorin Anne Will zugutehalten, dass sie im Vergleich zu ihrer TV-Nachfolgerin Caren Miosga durchaus auch kritische Fragen stellt und Merkel etwa mit den bitteren Vorwürfen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach dem russischen Massaker von Butscha im März 2022 konfrontiert. Der ganze Komplex der Russland-Politik von Merkel steckt voller Widersprüche, die in der verwinkelten Rhetorik der Ex-Regentin untergehen.
So habe sie nicht geglaubt, dass eine Beitrittsperspektive für die Ukraine auf dem Bukarester Nato-Gipfel 2008 Russland abgeschreckt hätte, Kiew zu überfallen. Die damaligen Rücksichten auf Putin haben ihn aber auch nicht abgeschreckt. Widersprüche, die man zumindest im Rückblick referieren könnte. Doch ganz gleich, ob es um die Pipelines Nord Stream eins und zwei geht, die Aussetzung der Wehrpflicht oder ihr Verhältnis zu Putin, Merkel verfährt nach dem Grundsatz: Was ich damals für richtig gehalten habe, kann heute nicht falsch sein.
„Sie bereuen nichts?“, fragt Will. „Nein“, sagt Merkel.
„Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021“ von Ex-Kanzlerin Angela Merkel steht im Kulturkaufhaus Dussmann.
Will liest ihr die lange Mängelliste ihres politischen Erbes vor. Von der Energiepolitik bis Bürokratie und Infrastruktur. „Wenn es hilft, dann soll man sagen, Merkel war’s“, wischt sie die Dinge, wie in der Natur psychologischer Abwehrreflexe liegt. Es sind solche Sprüche, die im erkennbar geneigten Publikum mit Sympathie und Verständnis aufgenommen werden und charmant darüber hinweggehen, dass sie es ja wirklich war. Wer sonst?
Dass die Bundeswehr in keinem guten Zustand sei, liege an den Koalitionspartnern und der gesellschaftlichen Stimmung. Bei der Anschaffung bewaffneter Drohnen hätten ihr Grüne wie Jürgen Trittin zugesetzt, sagt sie. Mitunter habe sie sich nicht durchgesetzt. Mitunter hat sie es gar nicht erst versucht. Das sagt sie freilich nicht.
Merkel trägt einen weißen Blazer, den sie zu Beginn sorgfältig unter ihre Sitzfläche stopft, damit er auf den Schultern keine Buckel wirft. Die Kette aus Ostsee-Bernstein ist ihre Lieblingskette, die sie im Wahlkreis mal geschenkt bekam. Den Kontakt mit Menschen vermeidet sie noch immer: Im Foyer kann man signierte Bücher kaufen, die sie am Vortag beschriftet hat. Ein deutlicher Unterschied zur Amtszeit: Merkel antwortet mehrfach mit einem klaren „ja“ oder „nein“, was sonst bei ihr nicht vorkam.
„Wer wollen sie gewesen sein?“, fragt Will an mehreren Stellen. Eine hübsche Wendung für den eigentlichen Sinn des Buches: das Festhalten ihrer eigenen Weltsicht. Immer wieder hat Merkel sich im Laufe der Jahre intern oder auch offen geärgert, dass Journalisten nicht das schrieben, was sie ihnen gesagt hatte. Sie habe die Schilderungen nicht allein anderen überlassen wollen, sagt sie.
Angela Merkel bereue laut eigener Aussage nichts.
Authentisch sind im Gespräch auch die typisch sperrigen Merkel-Sätze. Als Will in typisch rheinländischer Manier von einem „Baggersee“ spricht, in den Merkel bei der Abiturfeier gefallen sei, korrigiert sie: Es sei ein „eiszeitlich geschaffener See“ gewesen, was in der uckermärkischen Endmoränen-Landschaft zweifellos korrekt ist. Sie saß mit einem Mitschüler in einem Boot, „plötzlich stand der auf, damit war die Gleichgewichtsstruktur nicht mehr gegeben.“
Fast eine ganze Stunde spricht Will mit Merkel über die DDR-Zeit, die diese nicht als „Ballast“ betrachtet wissen will, wie der Publizist Thomas Schmid es in der Welt am Sonntag einst formuliert hatte. Sie räumt dann aber doch ein, dass sie in der Bundespolitik viel habe lernen können, zumal man im Osten viel darüber gesprochen habe, wie schlecht der Sozialismus sei, aber wenig darüber, was man eigentlich wolle.
Wer will Merkel gewesen sein? In keiner Episode wird das deutlicher, als in den Schilderungen über ihre Migrationspolitik im Sommer 2015, die im Buch, aber auch in den Erzählungen der Alt-Kanzlerin zu einer Legende der Mitmenschlichkeit verwoben werden, die an vielen Stellen einfach nicht stimmt. Wer wissen will, wie es wirklich war, findet in den „Getriebenen“ von Robin Alexander mehr Fakten als in Angela Merkels Erinnerungen.
Ob sie es ihrem Nachfolger im CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, gönne, demnächst vielleicht der nächste Kanzler zu sein, wird Merkel gefragt und antwortet mit einem klaren „Ja.“ Und: „Man braucht diesen unbedingten Willen zur Macht.“ Den habe er. Den hatte sie auch, wie sie beim Kapitel über ihren Weg ins Kanzleramt nur etwas umständlich zugibt. Niemand konnte es allerdings so gut verbergen wie sie. Die Zahl ihrer Fans bis heute ist der beste Beweis.





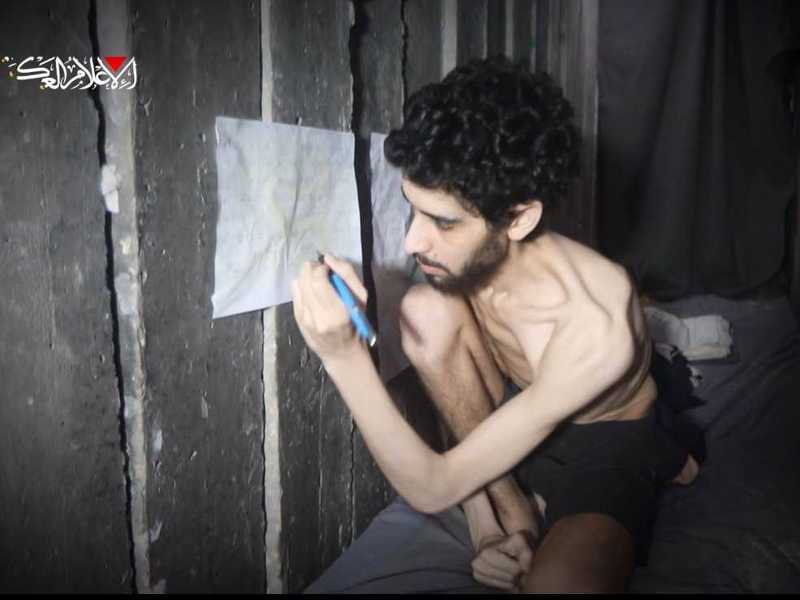

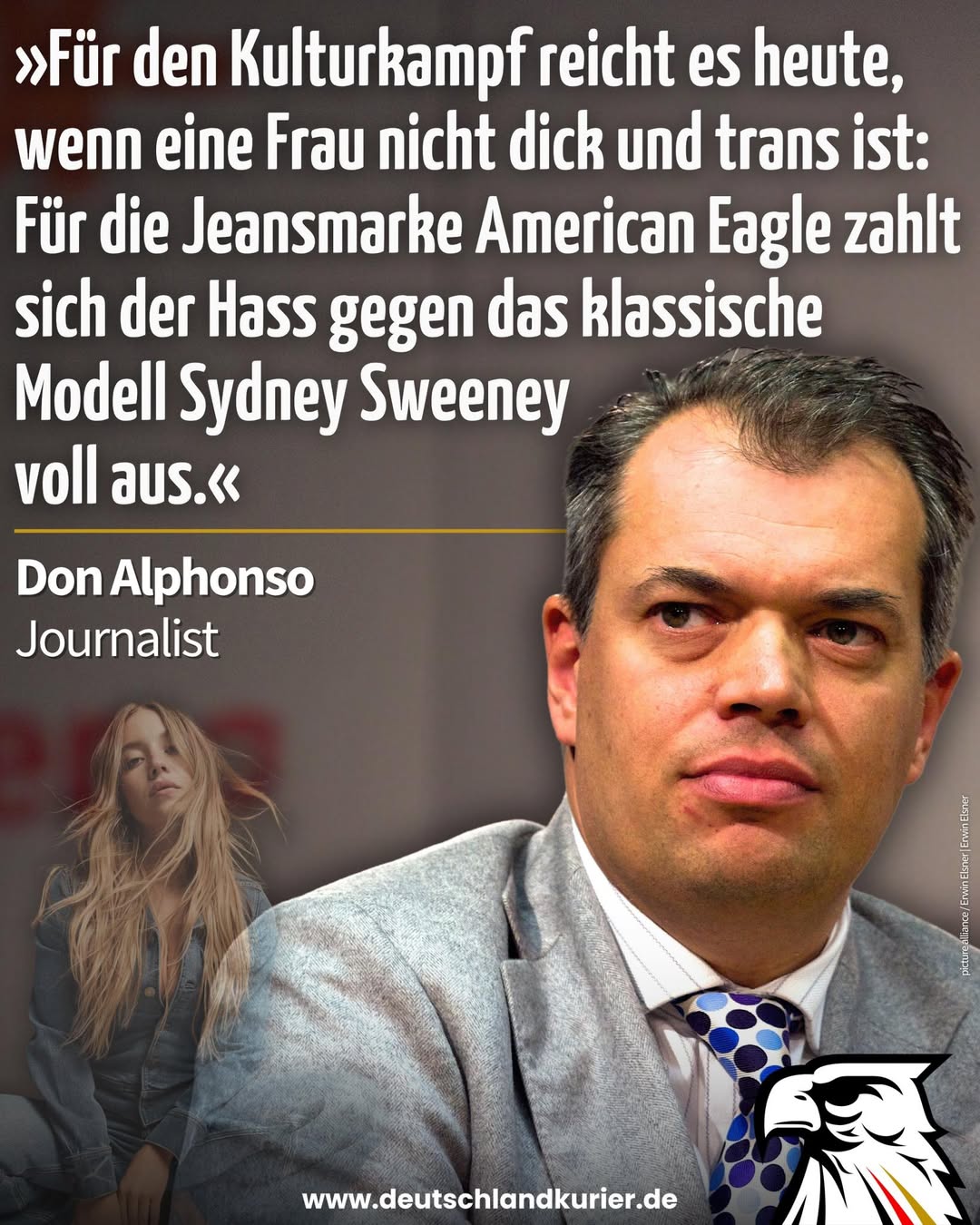


 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























