
In der deutschen Energiepolitik spielt sich derzeit ein merkwürdiges Schauspiel ab: Kaum hat Robert Habeck den Chefsessel im Bundeswirtschaftsministerium geräumt, beginnen die Grünen, seine Nachfolgerin in Sachen Kraftwerksstrategie anzugreifen – obwohl sie hier seine Linie fortführt.
Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer sagte hierzu: Der von Bundeswirtschaftsministerin Reiche geplante Ausbau von Gaskraftwerken sei ein „gefährlicher Kurs“, der dem Energiewendeland Niedersachsen schade und Milliarden an Subventionen verschlinge. In einem Artikel der Kreiszeitung warnt Meyer vor angeblich klimaschädlichen, ineffizienten und teuren Kraftwerken – vor allem im Süden der Republik. Er sieht darin eine energiepolitische Schieflage zulasten des Nordens.
Diese Aussagen widersprechen nicht nur der früheren Linie der eigenen Partei – sie werfen vor allem eine zentrale Frage auf: Brauchen wir Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Und wenn ja – was ist von Christian Meyers Aussagen zu halten? Eine Einordnung.
Eins steht fest: Solange Deutschland den Kurs Richtung 100 Prozent Erneuerbare fährt, wird es ohne Backup-Kraftwerke nicht gehen. Denn wenn Windflaute und Dunkelheit zusammentreffen, droht es im Land buchstäblich dunkel zu werden.
Während andere Nachbarländer wie Frankreich oder Schweden auf stabile Erzeugungsformen wie Wasser- und Kernkraft setzen und damit keine zusätzliche Absicherung benötigen, geht Deutschland einen anderen, deutlich teureren Weg: Die Wetterabhängigkeit unserer Stromerzeugung macht Backup-Kapazitäten physikalisch zwingend erforderlich. Nicht aus Liebe zur fossilen Erzeugung, sondern weil es anders nicht geht. Genau deshalb kommen wir nicht umhin, die von Herrn Meyer genannten 22 bis 32 Milliarden Euro in Reservekraftwerke zu investieren.
Doch das sind keine Kosten einer angeblichen Rückkehr zur Fossilenergie, wie Meyer suggeriert – sondern die systembedingte Folge der eigenen Energiepolitik. Länder mit grundlastfähiger Stromerzeugung wie Frankreich brauchen keine solchen Parallelstrukturen. Deutschland hingegen schon – und zwar dringend. Reservekraftwerke sind keine fossilen Irrwege, sondern das notwendige Pflaster für ein wetterabhängiges Stromsystem. Wer das bestreitet, hat die Physik verlassen – und die ehrliche Argumentation gleich mit.
Was heute von Christian Meyer und anderen grünen Politikern als energiepolitischer Tabubruch skandalisiert wird, war ursprünglich Teil eines ehrgeizigen Plans – formuliert im eigenen politischen Lager: Bereits 2023 hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein Ziel von 25 Gigawatt wasserstofffähiger Gaskraftwerksleistung bis 2030 ausgerufen. Er begründete dies mit den Worten: „Die Bundesregierung will den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken mit bis zu 25 Gigawatt Kapazität fördern: Mit diesem Bedarf rechne ich bis 2030. Diese Gaskraftwerke sollen einspringen, wenn erneuerbare Energien nicht genug Strom liefern.“
Ein Ziel, das sogar über dem liegt, das Niedersachsen nun lautstark kritisiert. Durchsetzen konnte Habeck dieses Ausbauziel jedoch nicht. In zähen Verhandlungen mit der EU-Kommission wurde es auf 12,5 Gigawatt halbiert – ergänzt um 500 Megawatt Langzeitspeicher. Auch dieser Kompromiss wurde zwar öffentlich angekündigt, blieb aber bis heute ohne Umsetzung: Die geplanten Ausschreibungen wurden nie gestartet, die Strategie versandete.
Dass nun ausgerechnet Niedersachsens Umweltminister den Vorstoß von Frau Reiche für 20 GW als „gefährlich“ brandmarkt, wirkt vor diesem Hintergrund wie energiepolitisches Kurzzeitgedächtnis – oder gezielte Geschichtsvergessenheit.
„Es kann nicht sein, dass wir Milliarden fossile Subventionen für neue Gaskraftwerke wegen der Versäumnisse beim Ausbau Erneuerbarer Energien und der Netze im Süden zahlen“ – mit dieser Aussage bedient sich Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer einer Rhetorik, die gezielt auf vermeintliche Fehler anderer Bundesländer verweist. Doch sie spaltet – und verstellt den Blick auf die eigentlichen energiewirtschaftlichen Probleme.
Denn die strukturellen Herausforderungen der Energiewende sind keine regionalen Versäumnisse, sondern Ergebnis politischer Weichenstellungen auf Bundesebene – allen voran der fatalen Abschaltung der Kernkraftwerke. Bayern und Baden-Württemberg, lange Zeit durch grundlastfähige Kernenergie abgesichert, stehen seither in besonderer Weise vor einem Problem, das aber auch den Rest der Republik trifft: einer Versorgungslücke, wenn Wind und Sonne nicht liefern.
Mehr Windkraft im Süden, wie von Meyer und den Grünen mantrahaft gefordert, scheitert jedoch an der meteorologischen Realität: Süddeutschland zählt zu den windschwächsten Regionen Europas. Windräder dort sind nur mit erheblichen Subventionen realisierbar– und selbst dann bleibt das Grundproblem bestehen: Die Überbrückung langanhaltender Dunkelflauten, in denen weder Wind noch Sonne zur Verfügung stehen.
Die geplanten Gaskraftwerke sind deshalb kein „süddeutscher Luxus“, sondern eine systemische Notwendigkeit – ein Beitrag zur Versorgungssicherheit, von dem ganz Deutschland profitiert. Wer das leugnet, betreibt keine Energiepolitik – sondern provinziellen Populismus.
Christian Meyer verweist gern darauf, dass Niedersachsen beim Ausbau der Erneuerbaren ganz vorn liege und dass Kommunen im Land von erheblichen Mehreinnahmen profitieren könnten. Was dabei unter den Tisch fällt: Diese Einnahmen sind kein Ausdruck marktgetriebener Stärke, sondern beruhen maßgeblich auf milliardenschweren Subventionen aus dem Bundeshaushalt.
Allein im Jahr 2024 belief sich die EEG-Förderung aus dem Klima- und Transformationsfonds auf 18,5 Milliarden Euro. Laut einer Mittelfristprognose des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) könnten die Förderzahlungen bis 2029 auf knapp 23 Milliarden Euro ansteigen – trotz des Auslaufens älterer Anlagen mit hohen Vergütungssätzen.
Mit anderen Worten: Die gefeierten Mehreinnahmen sind keine Rendite wirtschaftlicher Effizienz, sondern Ergebnis eines steuerfinanzierten Umverteilungsmechanismus. Wer sich dafür als Vorreiter feiern lässt, sollte auch sagen, wer das Podium bezahlt.
Christian Meyer behauptet weiterhin: Wenn neue Gaskraftwerke nicht auf Wasserstoff umrüstbar seien, gefährde das die Klimaziele und bremse den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Doch diese Argumentation ignoriert ökonomische und technologische Realitäten – und verkennt die mehr als fragliche Rolle von Wasserstoff in der künftigen Energiewirtschaft.
Grüner Wasserstoff bleibt auf absehbare Zeit ein knappes und teures Gut. Selbst optimistische Szenarien sehen die Produktionskosten bis 2030 beim Drei- bis Fünffachen des europäischen Erdgaspreises – und dieser liegt wiederum etwa beim Fünffachen des US-Preises.
Gleichzeitig geraten Vorzeigeprojekte ins Straucheln:
Und selbst wenn Wasserstoff in ausreichender Menge verfügbar wäre: Die Grundstoffindustrie hätte Vorrang. Sie benötigt ihn alternativlos zur Dekarbonisierung von Stahl, Chemie und Zement – nicht für gelegentliche Kraftwerkseinsätze mit wenigen hundert Volllaststunden.
Fazit: Was gebraucht wird, ist ein technologieoffener Ansatz, der physikalische Notwendigkeiten anerkennt – nicht politisch getriebene Wunschvorstellungen.
Christian Meyer und die Grünen betonen gern, dass Niedersachsen mehr Strom aus Erneuerbaren erzeugt, als es verbraucht. Doch diese Summenbilanz ist ein wiederkehrendes One-Trick-Pony der EE-Befürworter – denn sie sagt nichts über eine kontinuierliche Versorgung aus. Die Realität ist ein ständiger Wechsel zwischen Überproduktion und Mangellagen. Und auch im windreichen Norden bleibt man in Dunkelflauten auf fossile Kraftwerke und Importe angewiesen.
Meyer verweist auf „viele Batteriespeicher und Biogasanlagen, die flexibel gefahren werden können, wenn die Stromausbeute geringer ist“. Dies schauen wir uns mal genauer an: Niedersachsen hat einen jährlichen Stromverbrauch von rund 50 TWh. Dem stehen 105 MW installierte Großspeicherleistung und 1,36 GW Biogasanlagen gegenüber.
Was heißt das im Ernstfall – einer Dunkelflaute ohne Kohle- und Gaskraftwerke?
Und selbst wenn man Batterien massiv ausbauen wollte: Die Langfristszenarien des Bundeswirtschaftsministeriums prognostizieren für 2045 einen bundesweiten Bedarf von rund 80 TWh Wasserstoff-Backup. Wollte man diese Energiemenge stattdessen mit Batterien abdecken, wären bei optimistischen Preisen von 100 Euro/kWh Investitionen von acht Billionen Euro nötig – und das alle 20 bis 30 Jahre. Eine Summe, die jede haushaltspolitische Realität sprengt.
Fazit: Eine stabile Versorgung allein durch Wind und Solar ist nicht gegeben. Wenn es dunkel und windstill ist, braucht es Importe – und die Kohle- und Gaskraftwerke, die Christian Meyer so vehement ablehnt.
Wenn die Energiepolitik Niedersachsens so erfolgreich wäre, wie Christian Meyer sie in glühenden Worten darstellt, stellt sich eine einfache Frage: Warum hat sich ArcelorMittal gegen den Standort Bremen entschieden, um grünen Stahl zu produzieren? Trotz zugesagter Fördermittel in Milliardenhöhe erklärte der Chef der europäischen Flachstahlsparte, Reiner Blaschek, unmissverständlich: „Die Rahmenbedingungen ermöglichen aus unserer Sicht kein belastbares und überlebensfähiges Geschäftsmodell.“
Als Gründe nennt der Konzern: hohe Strompreise, unsichere Wasserstoffverfügbarkeit und mangelnde Planungssicherheit. Die Konsequenz: ArcelorMittal stoppt das Bremer Projekt – und realisiert ein vergleichbares Vorhaben in Dunkerque/Frankreich, wo die Rahmenbedingungen als günstiger gelten. Dort wird der Strom für die Elektrolichtbogenöfen von französischen Kernkraftwerken geliefert – diese Option haben wir leider nicht mehr.
Das Urteil des Konzerns ist eindeutig – und eine schallende Ohrfeige für die energiepolitischen Standortbedingungen, wie sie unter Christian Meyer in Norddeutschland mitverantwortet werden. Fazit: Energiepolitik braucht Realitätssinn – nicht Rhetorik.
Was aus Niedersachsen an Kritik am Gaskraftwerksausbau kommt, ist ein Wunschkatalog – ohne Rücksicht auf physikalische und ökonomische Realitäten. Weder lassen sich Backup-Kapazitäten durch Batterien ersetzen, noch wird Wasserstoff in absehbarer Zeit in genügender Menge und zu tragbaren Kosten zur Verfügung stehen, um fossile Kraftwerke vollständig abzulösen.
Die Entscheidung von ArcelorMittal, nicht in Norddeutschland zu investieren, spricht eine deutlichere Sprache als jede Pressemitteilung. Die Industrie zieht sich nicht zurück, wenn die Bedingungen gut sind – sondern wenn sie es nicht mehr sind. Hinzu kommt: Die jetzige Kritik steht im offenen Widerspruch zu Robert Habecks ursprünglicher Kraftwerksstrategie, die selbst 25 GW Gaskapazität vorsah. Diesen Kurs nun als „gefährlich“ zu bezeichnen, wirkt nicht nur widersprüchlich – sondern auch destruktiv.
Besonders problematisch ist die Tendenz, strukturelle Unterschiede zwischen Nord und Süd zum politischen Gegensatz zu stilisieren. Wer Versorgungssicherheit zur Regionalfrage erklärt, die Folgen des Kernkraftausstiegs ausklammert und strukturelle Herausforderungen zum Gegenstand polemischer Debatten macht, betreibt keine lösungsorientierte Energiepolitik – sondern populistische Symbolpolitik. So führt man das Land nicht in eine zukunftsfähige Energiepolitik – sondern aus dem gesellschaftlichen Konsens hinaus.






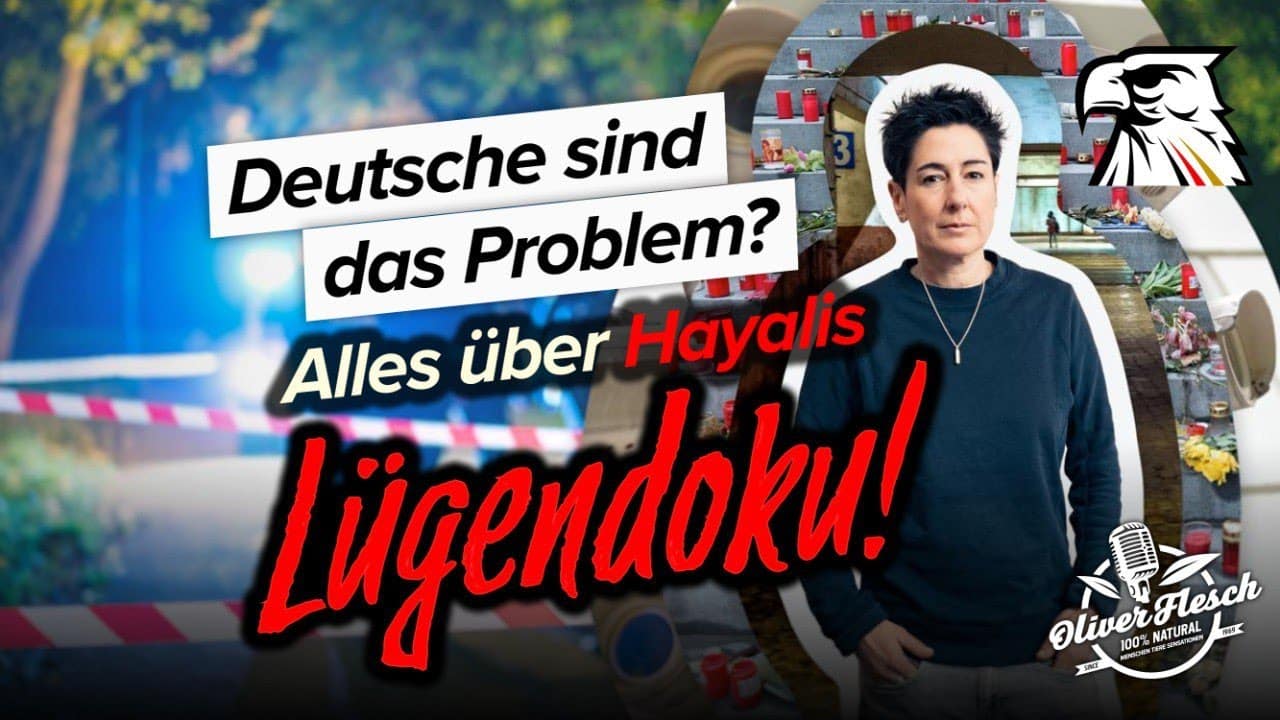



 UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM
UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM






























