
Wie soll es weitergehen im Land? Mit einem „Boomer-Soli“ könnte das Rentensystem stabilisiert werden, behauptet das DIW Berlin unter der Führung von Marcel Fratzscher. Die Berliner Landesregierung erarbeitet einen Gesetzesentwurf zur Enteignung von Immobilien und Maschinen. Und die Grüne Jugend will „fürs Klima“ sogar RWE, Leag und ThyssenKrupp enteignen. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, hält die Vorstöße für erschreckend.
„Es gibt immer wieder Sichtweisen, die sich hartnäckig halten, obwohl sie schlicht falsch sind und schlimmer noch, oft das Gegenteil von dem bewirken, was sie vorgeben. So heißt es etwa, bei Nasenbluten solle man den Kopf in den Nacken legen. Dabei ist das eine schlechte Idee, da das Blut in den Rachen laufen kann, was im Extremfall Erstickungsanfälle auszulösen droht. Ähnlich hartnäckig halten sich Vorurteile und Zuschreibungen über zweifelhafte wirtschaftspolitische Konzepte, die sich in den letzten Jahren aus einer unheilvollen Mixtur von sozialpolitischer Maßlosigkeit, industriepolitischem Allmachtsglauben und klimapolitischer Entkoppelung herausgebildet haben“, schreibt Steiger in seiner aktuellen wirtschaftspolitischen Kolumne.
Kai Wegner (l., CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht mit Raed Saleh (SPD), Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie planen ein Gesetz, das Enteignungen erlaubt.
Doch aus den Thinktanks, Instituten und Parteizentralen sprudeln weiter neue Schauer-Ideen: „Ein Boomer-Soli, der die demografischen Herausforderungen ausgerechnet mit einer weiteren Aushöhlung des Leistungsprinzips adressieren will, eine Berliner SPD, die ungeniert einen Entwurf für ein Gesetz zur Vergesellschaftung erarbeitet, um den Mietmarkt zu regulieren, oder eine Grüne Jugend, die schamlos davon spricht, Unternehmen wie RWE, Leag und Thyssenkrupp enteignen zu wollen, sind nur einige der aktuellen Auswüchse.“
Der Experte bezeichnet es als „erschreckend“, wie Menschen, die zum Teil noch nie in ihrem Leben in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, „wütend das Privileg einfordern, über ihre Mitmenschen, deren Ersparnisse und Einkommen zu verfügen.“ Hinzu komme eine aufdringliche Erziehungsneigung sowie die grobe Missachtung von Eigentumsrechten. Der politische Streit werde so ständig in einen moralischen Streit verschoben. „Es ist gerade diese moralische Codierung und das unredliche Gleichsetzen von Instrumenten mit Zielen, die einer lauten Minderheit ihre vermeintliche Überlegenheit verschafft“, schreibt Steiger.
„Gutes Handeln wird durch eine richtige Gesinnung zur Schau gestellt und nicht etwa durch positive Handlungsergebnisse. Für den eigenen Niedergang muss man folgerichtig auch keine Verantwortung mehr übernehmen“, kritisiert Steiger. So werde die selbstgewählte Kinderlosigkeit in einem umlagefinanzierten Sozialsystem ruckzuck zur ökologischen Großtat uminterpretiert und „das vorsätzliche Abschalten einer CO2-neutralen Technologie wie der Kernkraft, mitten in einer Phase der Dekarbonisierung und ohne geeignete Alternativen zu besitzen, als Beitrag zur Transformation gepriesen.“
Ob in der Sozialpolitik oder bei der Migration, das Bild des barmherzigen Samariters wird laut Steiger besonders gerne bemüht. Er erinnert an die ehemalige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung in leidenschaftlich moralischem Brustton dafür warb, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Ihre biblische Begründung damals: „Der barmherzige Samariter hat auch seinen Mantel geteilt und hat nicht gewartet, bis jemand kommt und sagt, ich wäre auch noch bereit.“
Kennt den Unterschied zwischen dem heiligen St. Martin und einem barmherzigen Samariter nicht: die Grüne Katrin Göring-Eckardt
Problem: Der barmherzige Samariter hat nie seinen Mantel geteilt, das war der heilige Martin. „Aber der barmherzige Samariter hat einen Überfallenen in eine Herberge gebracht und gepflegt. Am Folgetag gab er dem Wirt noch zwei Silbergroschen, damit er sich bei Bedarf weiter um ihn sorgt“, ergänzt der Wirtschaftsexperte und macht auf weitere, wichtige Punkte aufmerksam: „Zunächst einmal war der barmherzige Samariter zwar tugendhaft und hilfsbereit, aber er hatte vor allem auch Geld. Und nur durch sein Geld war er überhaupt in der Lage zu helfen. Hätte er seinen Wohlstand vorher verschenkt oder eine rot-grüne Vermögenssteuer gezahlt, hätte er auch nicht helfen können.“
Hatte Katrin Göring-Eckardt nicht auf dem Plan: der barmherzige Samariter (li) und der heilige Martin (re) sind nicht identisch.
Zweitens sei die Moral in diesem Bildnis an die eigenen finanziellen Ressourcen gebunden. „Der Samariter verwendet sein eigenes Geld aus eigener, freier Verantwortung. Er sagt nicht zu dem Wirt und anderen Herbergsgästen: ‚Wir müssen gemeinsam solidarisch sein.‘ Er hängt die Kosten der eigenen Tugendparolen eben nicht anderen um. Er zahlt selbst. Zudem geht der Samariter keine unbegrenzte Zahlungsverpflichtung ein, sobald der Überfallene wieder auf den Beinen steht, endet die Hilfe“, stellt Steiger klar.
Denn Nächstenliebe und Barmherzigkeit sind Tugenden. Und Tugenden sind immer Haltungen von Personen, sie bewegen sich also auf einer individualethischen Ebene. Sie prägen freie menschliche Entscheidungen und sind Ausdruck der inneren Einstellung. Das lässt sich eben nicht auf den Staat übertragen.








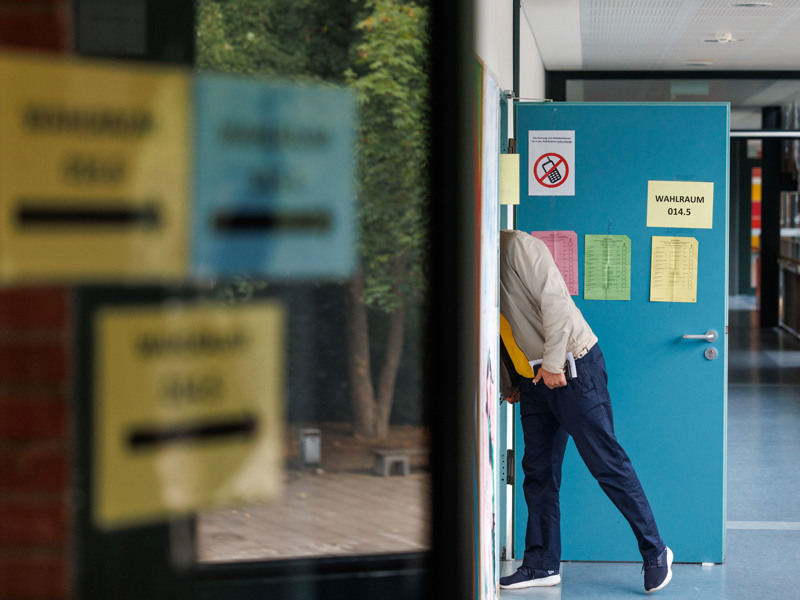
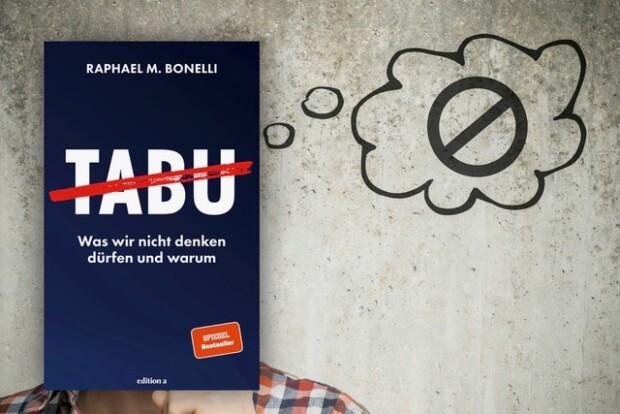
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























