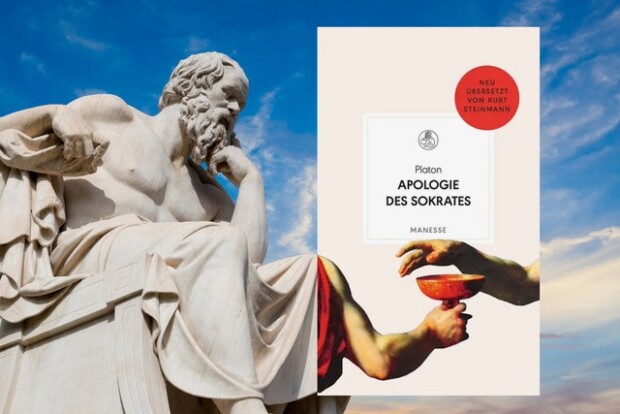
Unter den Texten, die in dieser Reihe vorgestellt werden, dürfte die Rede, mit der sich Sokrates gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit verteidigen musste, nicht nur der älteste, sondern auch der kürzeste sein. In der von John Burnet besorgten Ausgabe der Oxford Classical Library umfasst sie keine dreißig Seiten.
Dennoch lässt sich der Anspruch, der sich mit dem Wort Klassiker verbindet, gut begründen. Es ist ja kein Zufall, dass der Prozess gegen Sokrates immer wieder mit dem Justizskandal verglichen wurde, in dessen Verlauf Jesus von Nazareth fünfhundert Jahre später zum Tode verurteilt wurde. Und Zufall war es eben auch nicht, dass ein paar Zeitgenossen das Unerhörte der Vorgänge, deren Augen- und Ohrenzeugen sie geworden waren, verstanden und der Nachwelt überliefert haben. Für Jesus taten das die Evangelisten und die Apostel, für Sokrates waren es seine Schüler, neben Xenophon vor allem Platon.
Die Ähnlichkeiten zwischen beiden Gestalten und den von ihnen verkündeten Lehr- und Glaubenssätzen sind so oft beschrieben worden, dass eine knappe Erinnerung an dieser Stelle genügen sollte. Beide Male stand ein Mann vor Gericht, der es gewagt hatte, über Gott – oder die Götter – anders zu denken und zu reden, als seine Mitbürger das gewohnt waren. Beide Männer waren davon überzeugt, dass die Seele unsterblich sei und der Mensch gut daran tue, ihrer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als der des Körpers.
Sogar der Satz, der als der harte Kern jedweden Glaubens betrachtet werden kann, als solcher ja auch immer wieder zitiert worden ist, die Forderung nämlich, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, findet sich nicht nur in den Evangelien, sondern wörtlich auch bei Sokrates und seinem Schüler Platon. Nietzsche wusste schon, warum er das Christentum als Platonismus fürs Volk verhöhnte. Als Pfarrerssohn und Altphilologe kannte er sich in beiden Bereichen gut aus.
Man kann den Vergleich noch weiter treiben – böswillige Anklage, turbulenter Verlauf, parteiische Richter, Fehlurteil und so weiter –, läuft dann jedoch Gefahr, die beträchtlichen Unterschiede zu übersehen; denn die gibt es natürlich auch. Angesichts des Todes tut Sokrates das, was er lebenslang am liebsten getan hatte, ja auch am besten konnte, er argumentiert, begründet, widerlegt, verteidigt sich. Jesus dagegen schweigt. Selbst den allmächtigen Gerichtsherrn, den Römer Pontius Pilatus, würdigt er kaum eines Wortes, und als er von einem seiner Folterknechte misshandelt wird, fragt er nur: „Was schlägst du mich?“
Das wird der Sache aber nicht gerecht. Die Griechen liebten das Leben, auch wenn sie weit davon entfernt waren, den Tod als Übel zu betrachten. Nicht geboren zu werden, heißt es bei Pindar, sei das Beste, das Zweitbeste: möglichst früh zu sterben. Was die Griechen fürchteten, ja hassten, war nicht der Tod, sondern das Alter, das taub und blind und hässlich macht.
Eos, die Göttin der Morgenröte, die vergessen hatte, ihrem irdischen Geliebten zusammen mit dem ewigen Leben auch die ewige Jugend zu verschaffen, galt ihnen als Inbegriff der Dummheit – ganz im Gegensatz zu unseren Spahns und Lauterbachs, die uns weismachen wollen, sie täten uns einen Gefallen, wenn sie die Organspende als Form der Nächstenliebe propagieren und das gutes Leben nennen.
Hier öffnet sich der tiefste von all den Gräben, die das griechische vom christlichen, antikes von modernem Weltverständnis trennen. Während sich auch der fortschrittlichste Christ dazu gedrängt fühlt, den Tod als Strafe zu betrachten, von der erlöst zu werden ihm die Kirche verspricht, war für die Griechen der Tod selbst die Erlösung – Erlösung von den Zumutungen und Widrigkeiten des Lebens.
Sokrates beruft sich auf die bekannteste seiner Tugenden, die intellektuelle Redlichkeit, wenn er es für töricht erklärt, sich vor etwas zu fürchten, wovon man nichts weiß und auch nichts wissen kann. Man halte sich für klug, obwohl man es nicht sei, und das sei Dünkel. Wirklich klug sei auch er nicht, schon gar nicht da, wo es um Dinge wie Tod und Leben ginge, doch wisse er immerhin, dass er nichts wisse: Nur das habe er seinen Mitbürgern voraus, nur deshalb habe ihn der Gott in Delphi den weisesten aller Griechen genannt.
Das war die Stimme einer Religion, die ohne Dogmen, Heilige Schriften und Glaubensbekenntnisse auskam, die keine Theologen kannte und Priester nur als komische Figuren, die in keiner Komödie fehlen durften. Die Götter dieser bunten und anschaulichen, aber zutiefst skeptischen Religion waren Götter auch für Sokrates. Ihretwegen wurde er von ein paar Übereifrigen vor Gericht gezerrt, in ihrem Namen zum Tode verurteilt.
Tatsächlich machte Sokrates von dem ihm zustehenden Recht, den Schuldspruch des Gerichts mit einem eigenen Antrag zu beantworten, in der Weise Gebrauch, dass er auf lebenslange Speisung im Prytaneion, dem Rathaus der Stadt, plädierte: die höchste Auszeichnung, die Athen zu vergeben hatte – so jedenfalls Platon. War das nun höhnisch oder ernst gemeint oder heiliger Zorn? Wahrscheinlich war es, wie bei Platon meistens, Ironie; sokratische Ironie allerdings, in der sich die Wahrheit wie im Zerrspiegel zu erkennen gibt.
Das Griechische rät zur Vorsicht. Unter den mir bekannten Sprachen ist sie die einzige, die das Wort Wahrheit negativ konnotiert; „aletheia“ meint das Un-Verborgene – eine Insel im Meer des Verborgenen, Noch-nicht-Entdeckten, das durchforscht, aber nicht durchschaut, nicht eigentlich erkannt werden kann. Einziges Mittel, der Wahrheit jedenfalls ansatzweise, fragmentarisch auf die Spur zu kommen, ist das Gespräch (das als „ergebnisoffen“ zu bezeichnen eine moderne Tautologie ist).
Platon misstraute der Schriftlichkeit, die Buchstaben verglich er mit den Zierpflänzchen, die in freier Natur verkümmern, weil sie im Treibhaus großgezogen worden seien. Das einzig brauchbare Verfahren, Philosophie zu betreiben, war für ihn der Dialog, in dem jede Antwort Anlass für die nächste Frage ist; leider hat er sich damit nicht durchgesetzt. Wie alle Griechen hielt er das Adjektiv „umstritten“ für ein Adelsprädikat; über die Arroganz heutiger Faktenfinder hätte er nur gelacht.
Alles Weitere spielt jenseits des Prozesses. Unsterblich geworden ist Sokrates ja erst durch seine Weigerung, das Gefängnis zu verlassen, obwohl ihm das möglich war (davon erzählt Kriton), und durch die Gelassenheit, mit der er den Schierlingsbecher wie einen Heiltrank zu sich nahm (davon berichtet Platon im „Phaidon“).
Die obersten Gebote jeder anspruchsvollen Moral lassen sich eben nicht beweisen, sie lassen sich nur beglaubigen, und zur Beglaubigung taugen keine Worte, sondern nur die Tat. Die Behauptung, dass Unrecht zu tun schlimmer sei, als Unrecht zu leiden, wirkt nicht nur auf den ersten Blick absurd, genauso paradox wie der Befehl, dem Gegner auch die andere Backe hinzuhalten – eine Ethik der Würdelosigkeit, wie Max Weber das genannt hat, „außer: für einen Heiligen“. Womit der Prozess gegen Sokrates dann doch wieder in die Nähe des ganz andersartigen Prozesses gegen Jesus von Nazareth rückt. Hätte es beide Prozesse nicht gegeben oder wären sie anders ausgegangen, hätte die Weltgeschichte einen anderen Verlauf genommen.
Die Weltgeschichte war übrigens gerecht. Während wir von seinen Anklägern gerade einmal die Namen kennen, hat Sokrates mit dem, was er sagte und tat, tatsächlich überlebt. Und Platon, sein bester Schüler, ist der einzige antike Autor, dessen gesamtes Oeuvre der Nachwelt überliefert worden ist.
Platon, Apologie des Sokrates. Neu übersetzt von Kurt Steinmann. Manesse Verlag, sorgfältig edierte und bibliophile gestaltete Hardcover-Ausgabe mit Schutzumschlag, Kaptalband und Lesebändchen, 192 Seiten, 24,00 €. Erhältlich im TE-Shop.









 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























