
Die Geschichte galt einmal als Lehrmeisterin des Lebens. Hinter dieser Einsicht stand die Hoffnung, dass der Mensch aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen vermag.
Theoretisch gilt der Zusammenhang noch immer, praktisch keineswegs. Fast keine historische Parallele ist zu abgeschmackt, als dass sie nicht im Kampf um politische Macht bemüht würde. SPD und Grüne tun sich in diesem historischen Analphabetismus besonders hervor.
Ein Bundestagsabgeordneter der SPD, ein grüner Wirtschaftsminister und ein sozialdemokratischer Bundeskanzler legten in dichter Abfolge die Stirn in Sorgenfalten. Dirk Wiese tat es am 8. November vor dem Deutschen Bundestag, Robert Habeck am 9. November im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks, Olaf Scholz am 10. November in der ARD-Talkshow „Caren Miosga“. Drei Männer, eine Botschaft: Nun aber seien die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen; prompt zogen sie die falschen.
Die Politiker gehören den beiden verbliebenen Parteien der gerupften Regierungskoalition an, die bis zur letzten Woche Ampel hieß. Daraus wurde nach der Entlassung des Finanzministers und dem Austritt der FDP-Minister ein rot-grünes Schrumpfkabinett ohne parlamentarische Mehrheit. Mit fragwürdigen historischen Vergleichen soll das Hängen an der Macht argumentativ unterfüttert werden.
Dirk Wiese am 8. November bei seiner Rede im Bundestag.
Dirk Wiese, immerhin Sprecher des als konservativ geltenden „Seeheimer Kreises“ der SPD, las im Reichstagsgebäude energisch vom Blatt ab: Es gebe eine ganz bestimmte „wichtige Lehre aus der Weimarer Republik, als Nationalsozialisten und andere Extremisten die junge Demokratie regelmäßig in die Regierungsunfähigkeit manövrierten.“ Diese Lehre laute, dass „allein dem Bundeskanzler das Initiativrecht für die Vertrauensfrage“ zukomme.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik gibt anders als die Weimarer Reichsverfassung dem Parlament nicht das Recht, den Kanzler oder einen beliebigen Minister jederzeit abzuberufen. Der Bundeskanzler verlässt sein Amt nur, wenn er aus eigenem Entschluss die Vertrauensfrage stellt und verliert – oder wenn das Parlament ihn mit einem konstruktiven Misstrauensvotum stürzt.
Der Bundestag muss sich dann sofort auf einen neuen Kanzler einigen. Im Reichstag hingegen wurde oft der Kanzler mit einem destruktiven Votum gestürzt. Es gab keinen unmittelbaren Nachfolger, also wurde neu zu den Wahlurnen gerufen. Die Minister und Kanzler gaben sich die Klinke in die Hand. Die Demokratie wurde schwach und schwächer.
Abenteuerlich ist jedoch die Schlussfolgerung aus dem Untergang von Deutschlands zweiter Demokratie. Wiese behauptet: „Durch die Forderung nach überstürzten Neuwahlen sollen Unsicherheit in Bezug auf die Institutionen und Zweifel an der Legitimität von vorgezogenen Neuwahlen geschürt werden. Das ist das Spiel der AfD, die sich an ihren geistigen Vorbildern aus der Weimarer Republik orientiert.“ Der Sozialdemokrat Wiese springt dem gescheiterten Genossen im Kanzleramt plump zur Seite. Rasche Neuwahlen, die Scholz aller Voraussicht nach das Amt kosten, wären in dieser absurden Lesart eine protofaschistische Tat.
Tags darauf verwies auch Robert Habeck auf die „Erfahrungen der deutschen Geschichte“. Darum dürfe nur der Kanzler selbst die Vertrauensfrage stellen. Scholz wiederum rührte bei Miosga einen giftigen Geschichtssud der besonderen Art an: Der Kanzler müsse „formal“ mit der Vertrauensfrage Neuwahlen „auslösen – wegen der Erfahrungen, die wir mit den Kommunisten und Faschisten im Parlament der Weimarer Republik hatten, wo wir gesagt haben, so kann man das Spiel nicht weitergehen lassen und in der Bundesrepublik eine neue verfassungsrechtliche Ordnung geschaffen haben.“
Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit Caren Miosga.
Das zur Formalität herabgestufte Recht des Kanzlers aber will er, Scholz, neu handhaben: Nun sollen sich „die Abgeordneten von Regierung und Opposition, insbesondere die demokratischen Parteien“, auf einen Termin für die Vertrauensfrage einigen. Dem werde er folgen. Es ist eine aberwitzige Volte. Scholz klammert sich an die Macht wie ein Ertrinkender ans Treibholz.
Scholz, Habeck und Wiese übersehen eine wichtige historische Lehre: Zur Balance zwischen Parlament und Regierung gehört ganz wesentlich das konstruktive Misstrauensvotum. Ein Kanzler, der von der Macht nicht lassen will, kann so von heute auf morgen seines Postens enthoben werden. Das Recht auf die Vertrauensfrage schützt den Kanzler, das Recht auf ein konstruktives Misstrauensvotum das Parlament.
Womit wir bei der Brandmauer wären, die die AfD von allen Machtoptionen aussperrt. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP suchen nach Mehrheiten unter den von ihnen definierten „demokratischen Parteien“ oder in der „demokratischen Mitte“. Friedrich Merz könnte sich wahrscheinlich morgen schon zum Kanzler wählen lassen, wenn er die Stimmen aktueller und ehemaliger AfD-Abgeordneter nicht verschmähte.
Für Friedrich Merz kommen weder eine Koalition noch eine Duldung durch die AfD infrage.
Ein solches Votum wäre weit entfernt von einer Koalition. Ohne ein konstruktives Misstrauensvotum könnte sich Scholz theoretisch bis zu den nächsten regulären Wahlen im September an den Sessel des Regierungschefs ketten. Niemand kann ihn zwingen, die Vertrauensfrage zu stellen.
Eine Demokratie bleibt defizitär, wenn sie nicht alle Möglichkeiten nutzt, die die Verfassung bietet, um dem Volk das Wort zu erteilen. Jetzt ist die Stunde des Parlaments, nicht der Moment der Regierung. Der Souverän ist gefragt, nicht der Kanzler. Wenn Brandmauern den demokratischen Fortschritt behindern, verfehlen sie ihr Ziel.





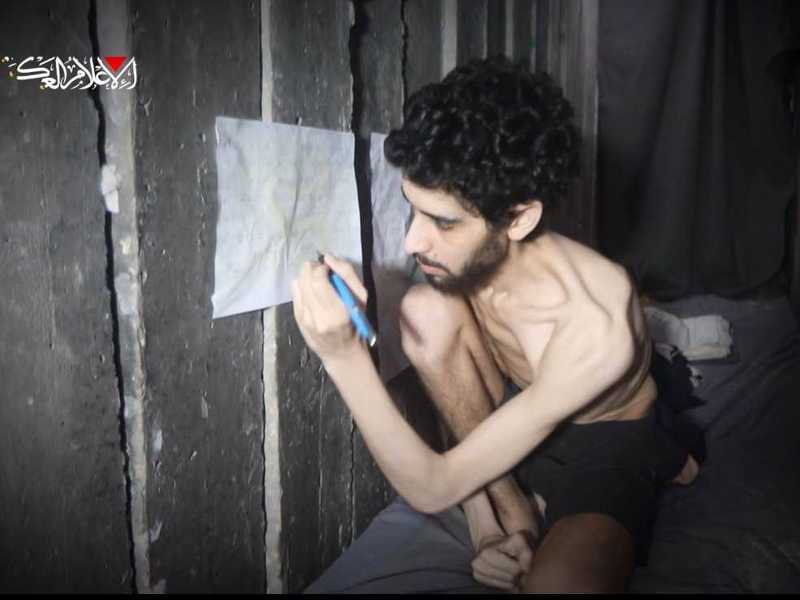

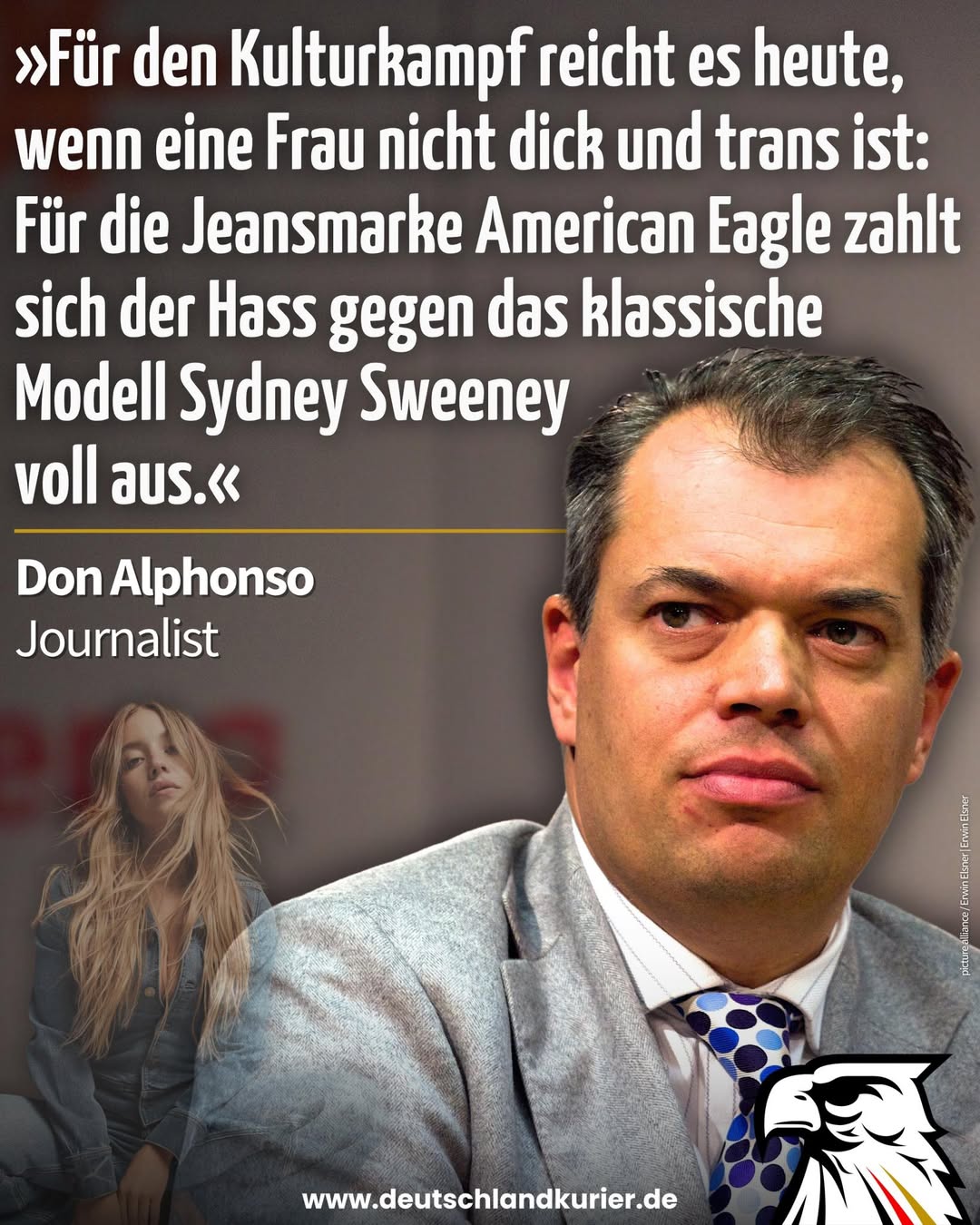


 USA: Donald Trump schickt nach Medewew-Drohung U-boote nach Russland! USA verliert Geduld | LIVE
USA: Donald Trump schickt nach Medewew-Drohung U-boote nach Russland! USA verliert Geduld | LIVE





























