
Das Bundesamt für Verfassungsschutz bewertet die gesamte AfD als „gesichert rechtsextremistisch“. NIUS hat mit zwei renommierten Verfassungsrechtlern darüber gesprochen, was das bedeutet, was sich ändert und welche politische Implikation hinter der „Hochstufung“ vom Verdachtsfall zur „gesichert rechtsextremistischen“ Partei stecken könnte.
Ein mögliches Parteienverbot hat mit der Arbeit, den Beobachtungen oder den Einschätzungen des Verfassungsschutzes nichts zu tun, erklärt Staatsrechtler Prof. Josef Franz Lindner (Universität Augsburg) gegenüber NIUS: „Das Grundgesetz regelt, dass eine Partei nicht von der Regierung – und der Verfassungsschutz ist weisungsgebundener Teil der Exekutive – verboten werden kann. Nach Artikel 21 des Grundgesetzes obliegt das einzig dem Bundesverfassungsgericht.“ Darin heißt es wörtlich unter Absatz 4:
„Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“
Und für derlei Maßnahmen oder gar ein Verbot einer Partei seien die Hürden wesentlich höher als für die Einschätzungen des Verfassungsschutzes. Prof. Lindner weiter: „Für ein Parteiverbot müsste unweigerlich bewegt sein, dass die AfD auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hinarbeitet.“ Der Begriff „rechtsextremistisch“ sei lediglich ein Arbeitsbegriff des Verfassungsschutzes, der im Grundgesetz keine Anwendung finde.
Prof. Josef Franz Lindner
Bei der Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes handelt es sich um genau das: die Bewertung einer Behörde, die dem Bundesinnenministerium weisungsgebunden unterstellt ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte zwar, dass die Bewertung unabhängig von politischem Einfluss vorgenommen worden sei, „der Verfassungsschutz ist jedoch keine objektive Instanz, die die Wahrheit verkündet“, erklärt Prof. Volker Boehme-Neßler (Universität Oldenburg) gegenüber NIUS. Wie bereits erwähnt, kann über ein Verbotsverfahren allein das Bundesverfassungsgericht entscheiden, welches viel höhere Hürden als die Bewertung des Verfassungsschutzes kennt.
Das „Hochstufung“ des Verfassungsschutzes hat mit Blick auf die Befugnisse des Verfassungsschutzes keine Auswirkung, erklärt Prof. Boehme-Neßler weiter: „Juristisch ist irrelevant, zu welcher Bewertung das Bundesamt für Verfassungsschutz hier kommt. Schon durch die Hochstufung vom Prüffall zum Verdachtsfall war es dem Verfassungsschutz erlaubt, geheimdienstliche Mittel einzusetzen, um Belege über die Partei zu sammeln – die nun vorgestellte Einschätzung des Verfassungsschutzes ist nur das Ergebnis der Überprüfung, hat aber rechtlich keine Konsequenzen.
Prof. Volker Boehme-Neßler
Die Befugnis des Verfassungsschutzes, die AfD auch mit geheimdienstlichen Methoden zu überwachen, hat sich durch die Bewertung als „gesichert rechtsextremistisch“ nicht verändert. Bei einfachen Mitgliedern oder auch Sympathisanten der Partei gelte mit Blick auf diese Mittel der „Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, wie Prof. Lindner betont und erklärt: „Nur, wer selbst als Person und Repräsentant eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen könnte, darf mit diesen Mitteln beobachtet werden – eine flächendeckende Beobachtung aller Parteimitglieder oder gar von Sympathisanten wäre nicht verhältnismäßig und somit rechtswidrig.“
Allein eine Mitgliedschaft oder das Kundtun der Sympathie für die AfD kann keine beruflichen Konsequenzen haben, erklärt Prof. Boehme-Neßler. „Es gilt immer, den Einzelfall zu betrachten. Eine Mitgliedschaft, ein politisches Engagement oder damit hausieren zu gehen, die AfD zu wählen, können kein Kündigungsgrund sein. Wenn sich jemand jedoch wiederholt rassistisch äußert und so das Betriebsklima stört, sind berufliche Konsequenzen möglich – das muss dann jedoch im Einzelfall geprüft werden und hat auch nichts mit einer etwaigen Parteimitgliedschaft zu tun.“ Prof. Lindner erläutert mit Blick auf Beamte: „Die Einstufung als ,gesichert rechtsextremistisch‘ kann im Einzelfall jedoch dem Dienstherren Anlass geben, sich der Verfassungstreue des Beamten zu versichern – aber nur im Einzelfall und nicht pauschal.“
Ähnlich verhält es sich mit Mietverhältnissen oder beispielsweise Konten, da sind sich beide Verfassungsrechtler einig: Die alleinige Bewertung durch eine weisungsgebundene Behörde der Exekutive kann nicht die Grundlage sein, AfD-Mitglieder oder Sympathisanten von Dienstleistungen auszuschließen oder Mietverträge zu kündigen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde.
Noch-Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat in einem Statement von einem „1100-seitigen Gutachten“ gesprochen, welches Ergebnis einer „neutralen Prüfung“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz sei. Dieses soll jedoch, wie es heißt, nicht veröffentlicht werden. Prof. Volker Boehme-Neßler hält das für hochproblematisch: „Die bisher veröffentlichte Begründung des Verfassungsschutzes ist ohnehin schon dünn, noch schlimmer ist allerdings, dass die Belege geheimgehalten werden sollen. Das geht in einem Rechtsstaat nicht. Das wäre zutiefst undemokratisch.“
NIUS hat das Bundesamt für Verfassungsschutz um Zusendung des Gutachtens gebeten und die den Informationsanspruch der Öffentlichkeit im Zweifel rechtlich durchzusetzen versuchen.
Wie bei jeder Behördenentscheidung steht auch der AfD eine verwaltungsrechtliche Anfechtung offen. Zunächst dürfte das Verwaltungsgericht Köln zuständig sein, nachdem der Verfassungsschutz dort ansässig ist. Im nächsten Schritt wäre dann das Oberverwaltungsgericht in Münster zuständig, das bereits über die Anfechtung der Einstufung als Verdachtsfall entschieden hat und dem Verfassungsschutz diese gestattet hatte. „Allein das dürfte um die zwei Jahre dauern“, meint Verfassungsrechtler Prof. Lindner.
Zuletzt hatte die AfD Sachen erfolglos versucht, das 134-seitige Gutachten des Landesverfassungsschutzes einzuklagen, das die Grundlage für die Einstufung des Landesverbandes als „gesichert rechtsextremistisch“ bildete. Das Verwaltungsgericht in Dresden lehnte den Antrag im Juli 2024 ab.
Mehr NIUS: Leak aus dem Geheimgutachten: In diesen drei wachsweichen Beispielen will der Verfassungsschutz den Rechtsextremismus der AfD erkennen


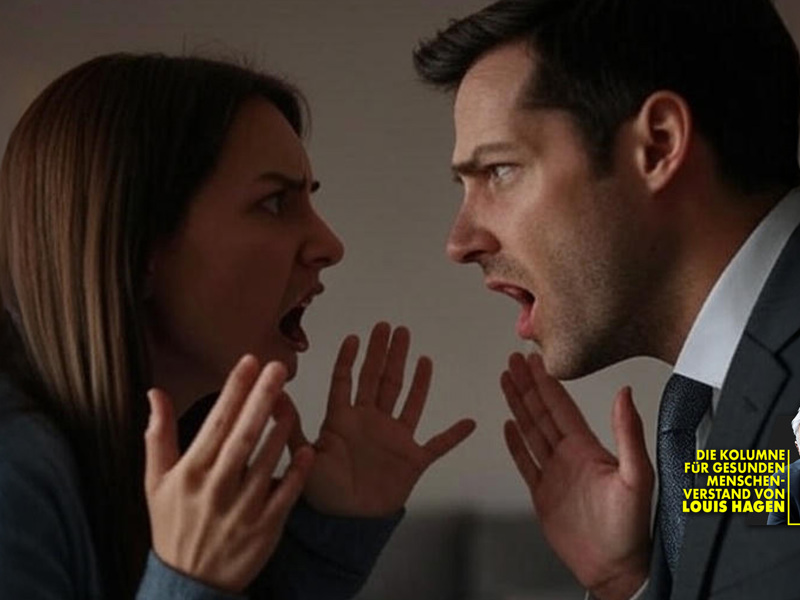







 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























