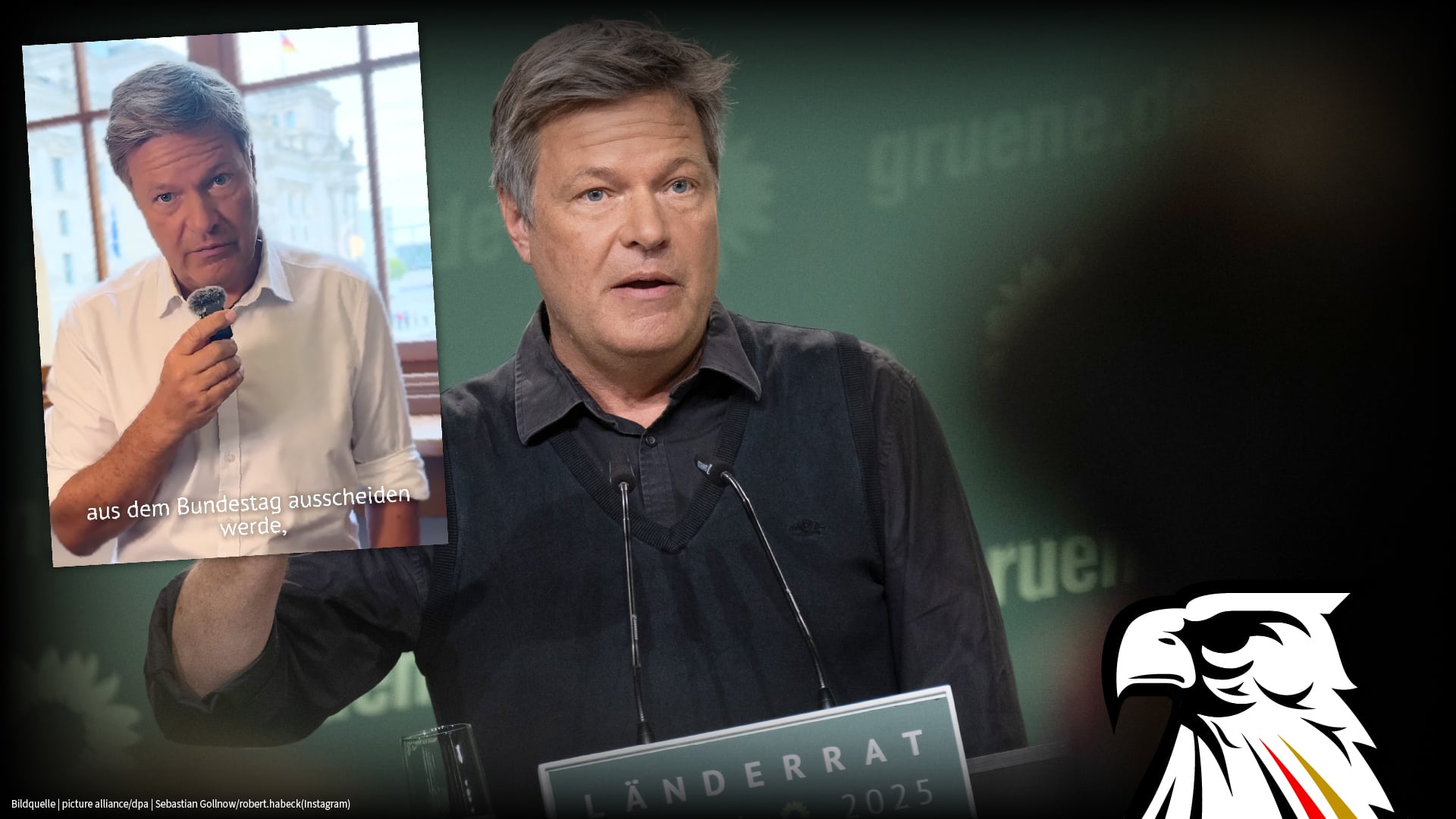Obwohl sich die Bundesregierung auch während der Sommerpause wie die Kesselflicker gestritten hat (um Steuererhöhungen, Israel-Frage, Sicherheitsgarantien, Verfassungsrichter-Wahl), wartet der richtig große Krach erst jetzt, mit Beginn des sogenannten „Herbst der Reformen“.
Große Lücken in den Haushaltsplänen der kommenden Jahre gesellen sich zu explodierenden Kosten bei den Sozialkassen. Dabei haben Union und SPD zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an die Geldnot:
CDU und CSU drängen auf Einsparungen gerade beim Sozialstaat und hoffen auf sprudelnde Steuereinnahmen durch Wirtschaftswachstum, was sich jedoch bisher nicht einmal in Ansätzen einstellt. Die SPD hingegen klammert sich schützend an den Sozialstaat und hat sich Steuererhöhungen zum Ziel gesetzt, um die Staatskassen mit dem Geld von Gutverdienern und Wohlhabenden zusätzlich aufzufüllen.
Ein heißer Herbst voller Regierungs-Zoff ist also programmiert!
Beim Landesparteitag der CDU Niedersachsen hat Friedrich Merz nicht nur seine Partei-Freunde angesprochen, zahlreiche Botschaften waren an die SPD gerichtet.
Es sind deutliche Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz, die er beim Landesparteitag der CDU in Niedersachsen von sich gegeben hat: „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.“ Beim Blick auf die Zahlen und angesichts der Warnungen Dutzender Experten und Ökonomen, die seit Jahrzehnten zu hören sind, erscheint Merz’ Aussage wie eine Binse – und doch ist sie eine deutliche Botschaft an den Koalitionspartner.
SPD-Chef Lars Klingbeil und auch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sprechen gerne vom „Kahlschlag beim Sozialstaat“, den sie nicht zulassen würden, um so eben nicht bei Rente, Bürgergeld oder der Krankenversicherung einsparen zu müssen. Doch auch diese Verteidigungstaktik adressiert Merz: „Ich werde mich durch Worte wie Sozial-Abbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen.“ Sein Appell: „Wir werden das ändern müssen.“
Bas und Klingbeil haben schon abgekündigt, dass für sie ein „Kahlschlag beim Sozialstaat“ nicht infrage kommt.
Was der Bundeskanzler sagt, ist durch Zahlen belegt: Der Steuerzuschuss zur Finanzierung der Rente ist auf 122,5 Milliarden Euro in diesem Jahr angestiegen, frisst beinahe ein Viertel des Haushaltes auf und wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Kosten für das Bürgergeld werden nach 47 Milliarden Euro im vergangenen Jahr in diesem Jahr wohl die 50 Milliarden Euro-Marke durchbrechen, Kranken- und Pflegeversicherungen haben Defizite, die der Bund mit Darlehen ausgleichen will. An Erkenntnis mangelt es dem Bundeskanzler und seiner Union also nicht. Allein die Tatsache, dass zu all diesen Bereichen im Koalitionsvertrag statt echter Reformen nur Expertenkreise und Kommissionen vereinbart worden sind, nehmen dem rhetorischen Eifer ein wenig den Wind aus den Segeln. Gleiches gilt für die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031 und die Einführung der „Mütterrente“.
Hinzu kommt: Trotz der Rekordverschuldung von 847 Milliarden Euro in nur vier Jahren fehlen in besagten vier Jahren – Stand jetzt – 177 Milliarden Euro in den Haushalts-Etats. Finanzminister Klingbeil hat ein weiteres 30 Milliarden Euro-Loch für das Jahr 2027 entdeckt, das nur mit einer „gemeinsamen Kraftanstrengung“ zu schließen sei, wie er seinen Kabinetts-Kollegen in einem Brief mitteilte.
Ein gigantisches Loch, welches durch Einsparungen oder unverhofft hohe Steuereinnahmen durch ein rasantes Wirtschaftswachstum aufgefüllt werden muss. Nach drei Jahren Rezession erwartet Deutschland im kommenden Jahr jedoch allenfalls ein Mini-Wachstum im Null-Komma-Bereich, weshalb der Fokus wohl oder übel auf Ersteres, auf Einsparungen wird liegen müssen.
Von prominenten Politiker der Union kommen auch die ersten Spar-Vorschläge.
CSU-Chef Markus Söder will den mehr als 15 Milliarden Euro schweren Fördertopf für Wärmepumpen ebenso wie den Etat für Entwicklungshilfe stutzen. „Wer seine ausreisepflichtigen Bürger nicht zurücknimmt, braucht auch kein deutsches Geld“, sagte Söder zu Bild. Außerdem soll beim Bürgergeld deutlich mehr eingespart werden, als Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr) bisher für möglich gehalten hatte. Dafür wären freilich radikalere Sanktionen für Arbeitsverweigerer – ebenso wie der Ausschluss von Ukraine-Flüchtlingen vom Bürgergeld – nötig, die die SPD nicht ohne Weiteres mitmachen dürfte.
Söder will an einigen Stellen sparen und lehnt Steuererhöhungen ab.
An dieser Stelle kommt wieder der Bundeskanzler ins Spiel, der seinem Koalitionspartner ins Gewissen redet: „Wenn die SPD die Kraft besitzt, migrationskritisch und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reformen dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen – ich wünsche mir das!“
Hoffnungen auf eine pragmatische Einsicht der Sozialdemokraten hat SPD-Chef Lars Klingbeil aber direkt zunichtegemacht. Denn Klingbeil riet der Union, „weniger zu hyperventilieren“. Botschaft: ihr übertreibt.
Klingbeil und seine Genossen haben nämlich ganz andere Pläne, mit denen sie die Milliarden-Löcher stopfen wollen und die lassen sich in einem Wort zusammenfassen: Steuererhöhungen. „Menschen, die sehr hohe Vermögen und Einkommen haben, sollten ihren Teil dazu beitragen, dass es in dieser Gesellschaft gerechter zugeht. Gerade in diesen extremen Zeiten“, verteidigte Klingbeil seinen eigenen Vorstoß zu Steuererhöhungen.
Unterstützung bekommt Klingbeil von zahlreichen SPDlern, unter anderem von Alexander Schweitzer, dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Es gebe „eine steigende Zahl von Deutschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Erwerbsarbeit bestreiten, sondern davon leben, dass sie hohe Vermögen, Aktien, große Erbschaften besitzen“, sagte Schweitzer dem Tagesspiegel. „Diese Menschen werden im Verhältnis viel, viel weniger besteuert als Menschen, die Lohnsteuer zahlen.“ Es sollte „politischer Konsens sein, auch zwischen SPD und CDU/CSU“, so Schweitzer, Multimillionäre und Milliardäre stärker zur Kasse zu bitten.
Alexander Schweitzer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
Tatsächlich reagiert die Union jedoch allergisch auf das Wort Steuererhöhung: „Mit dieser Bundesregierung unter meiner Führung wird es eine Erhöhung der Einkommenssteuer für die mittelständischen Unternehmen in Deutschland nicht geben“, sagte Merz beim Niedersachsen-Parteitag. Daran ändere sich auch nichts, wenn so manch einer beim Koalitionspartner „Freude daran hat, über Steuererhöhungen zu diskutieren“. Auch CSU-Chef Söder äußerte sich klipp und klar: „No way, no chance.“ Mit der CSU werde es „definitiv keine Steuererhöhungen“ geben. Das sei „immer ein Rohrkrepierer“, so Söder.
Das zeigt: Zwei Koalitionspartner, die sich wegen der Wahl einer Richterin beinahe zerlegt hätten, haben mit Blick auf den „Herbst der Reformen“ zwar die Finanz-Not erkannt, stoßen jedoch in zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen, die sich gegenseitig widersprechen. Die Ampel-Regierung war am Ende am Streit ums Geld zerbrochen – doch damals ging es um 17 Milliarden Euro. Nicht um 177 Milliarden Euro wie bei Union und SPD.
Mehr NIUS: Neue Schock-Zahlen für Merz: Union und AfD in Sonntagsfrage gleichauf