
Nach dem Blackout auf der Iberischen Halbinsel am Montag ist die Stromversorgung fast vollständig wiederhergestellt. Bis spät in die Nacht waren Spanien, Portugal und kleine Teile Frankreichs von dem Ausfall betroffen – von einer Ursache fehlt weiterhin jede Spur. Die Behörden sind sich jetzt trotz anfänglich dahingehender Vermutungen sicher: Auf einen Cyberangriff lässt sich der Blackout momentan nicht zurückführen.
Der Zeitung El País zufolge war sogar das staatliche Institut für Cybersicherheit in Spanien mit der Untersuchung des Blackouts beauftragt und sollte auch in Erfahrung bringen, ob ein möglicher Hackerangriff den Ausfall herbeigeführt haben könnte – das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.
Es gebe „keine Hinweise“ für eine solche Attacke, erklärte Portugals Premierminister Luís Montenegro. Die portugiesischen Behörden sehen den Ursprung des Blackouts währenddessen in Spanien, das wiederum macht eine Unterbrechung der Verbindungen zu Frankreich für den Ausfall verantwortlich.
„Es sieht so aus, als ob es in Frankreich eine Netzstörung gab, da Spanien hohe Überschüsse an Solarenergie loswerden musste, die plötzlich nicht mehr abgenommen werden konnten“, sagte der Energieökonom Dr. Björn Peters dazu bereits am Montag gegenüber Apollo News (lesen Sie hier mehr).
Ein Überangebot an Solarstrom ist zwar keine Seltenheit, kann der produzierte Strom jedoch nicht abgenommen, zum Beispiel im Ausland verkauft werden, kann es zu einer Überlastung des Stromnetzes kommen.
Dem portugiesischen Netzbetreiber REN zufolge handelte es sich um ein „seltenes atmosphärisches Phänomen“, berichtete außerdem der britische Fernsehsender Sky News. Grund dafür seien hohe Temperaturschwankungen, die wiederum zu „anomalen Schwingungen“ im Stromnetz führten, so REN – „ein Phänomen, das als ‚induzierte atmosphärische Schwingungen‘ bekannt ist. Diese Schwingungen verursachten Synchronisationsstörungen zwischen den Stromnetzen, was zu aufeinanderfolgenden Störungen im gesamten europäischen Verbundnetz führte“.
Spaniens Premierminister Pedro Sanchez teilte am Montag mit, das Land habe dann gegen 12.30 Uhr innerhalb von fünf Sekunden einen Rückgang der Stromversorgung um 15 Gigawatt erlebt, was etwa 60 Prozent der landesweiten Nachfrage zur Mittagszeit entspricht. Infolgedessen kollabierte das Stromnetz, Sanchez rief die nationale Notlage aus und 30.000 Polizisten, die die öffentliche Sicherheit gewährleisten sollten. Währenddessen wurden 35.000 Passagiere aus gestrandeten Zügen evakuiert, tausende verharrten an Bahnhöfen und Flughäfen, die Krankenhäuser liefen im Notbetrieb.
Am späten Montagabend konnte das Stromnetz wieder zu 61 Prozent hochgefahren werden, auch die Großstädte Barcelona und Madrid, das neun Stunden lang ohne Stromversorgung war, sollen wieder angebunden sein. Gegen 3 Uhr morgens waren es dem spanischen Netzbetreiber Red Eléctrica zufolge bereits 82,4 Prozent. Am Dienstagmorgen war die Stromversorgung in Spanien zu 99 Prozent wiederhergestellt, in Portugal waren es 95 Prozent.
Währenddessen wurde mancherorts die Vermutung geäußert, das Stromnetz sei wegen eines Ausfalls der Gas-, Kohle- und Atomkraftwerke zusammengebrochen. Andere wiederum machen den zu hohen Anteil der erneuerbaren Energien verantwortlich. Erst Mitte April soll Spanien erstmals 100 Prozent seines Strombedarfs in einem Moment aus erneuerbaren Energien gewonnen haben, berichtete damals das PV Magazine.
Im gesamten vergangenen Jahr lag dieser Wert Red Eléctrica zufolge bei 56 Prozent. Der Denkfabrik Ember zufolge kann Spanien auf 43 Prozent erneuerbare Energiequellen zurückgreifen, weitere 43 Prozent sind Atom- und Kohlekraftwerke sowie andere mit fossilen Brennstoffen betriebene Anlagen. Bis 2030 möchte Spanien den jährlichen Strombedarf jedoch zu 81 Prozent mit erneuerbaren Energien decken.
Aber „weil in Spanien wie in Deutschland hohe Anteile der PV-Anlagen nicht regelbar sind, stehen immer weniger Kraftwerke zur Verfügung, um auf Instabilitäten zu reagieren. Das System wird daher langsam immer unberechenbarer. Schon kleine Störungen können dann zu nicht mehr beherrschbaren Ausfällen großer Systeme führen“, mahnte Björn Peters.




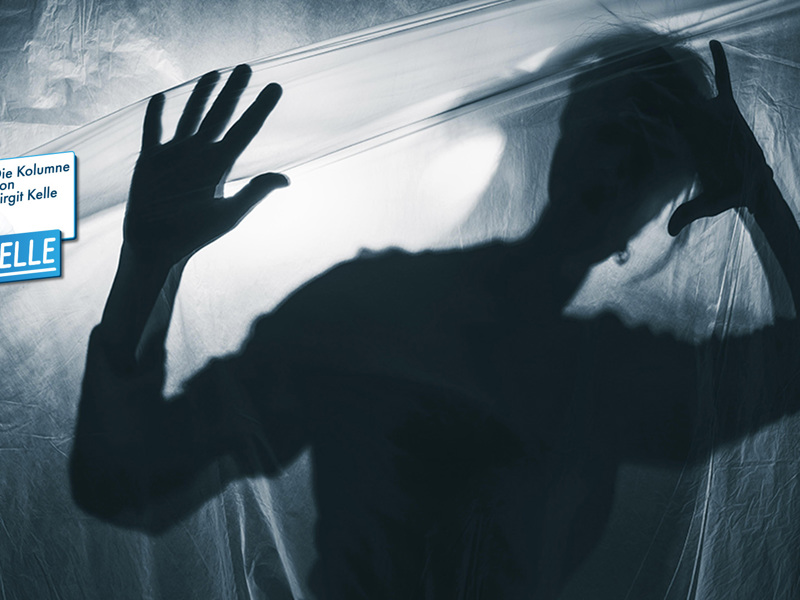



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























