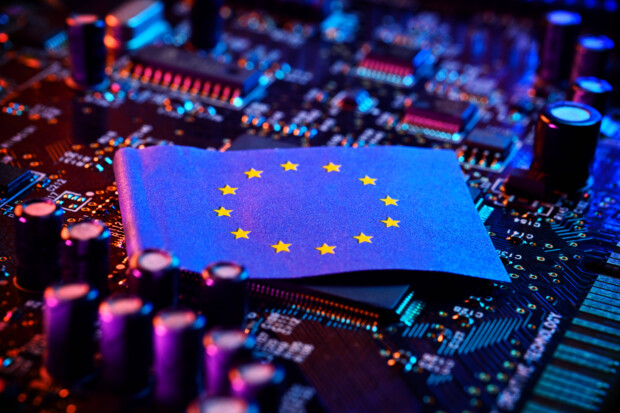
Donald J. Trump ist in Schottland und poltert gegen die politische Führung Europas. Egal ob in der Migrationsfrage oder beim Thema Windkraftanlagen – der Präsident sieht die EU-Großen auf dem Holzweg. Und das scheint mehr als die Ouvertüre zu den Zollgesprächen zu sein, die er am Sonntag bei einem Treffen mit der „sehr respektierten“ Ursula von der Leyen fortsetzen will: mit einer „guten 50-50-Chance“ auf eine Einigung. Trump ist nicht übermäßig optimistisch. Aber die Differenzen zwischen den USA und dem Staatenblock werden auch nach der denkbaren Einigung bestehen bleiben, keine Sorge.
Das zeigt ein Bericht des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, in dem es um die „Gefahr ausländischer Zensur“ geht, die amerikanischen Firmen und Online-Plattformen von der EU drohen. Das zugrundeliegende Thema ist der Digital Services Act (DSA) der EU, und der wird von den Repräsentanten als „umfassendes Gesetz zur digitalen Zensur“ beschrieben, das auch die Redefreiheit von US-Bürgern bedrohe. Das berichtet nach exklusivem Einblick Politico. Entstanden ist der Bericht nach fünf Monaten der Beratung, wobei auch die Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok und X angehört wurden.
Seit Monaten sprechen das Weiße Haus und das US-Außenministerium über die EU-Verordnung. Im Mai drohte Außenminister Marco Rubio EU-Vertretern Visa-Restriktionen an, wenn sie amerikanische Staatsbürger zensieren. Das hatte einen gewissen Nachhall. Auch in den Handelsgesprächen zwischen Trump und der EU spielt das Thema seine angemessene Rolle. Denn das Wertegerüst sollte schon stimmen bei so einer Vereinbarung. Darüber hinaus gibt es aber sicher auch Interessen von US-Firmen, die Trump hier verteidigt.
So wurden Zensurmaßnahmen zu Handelshemmnissen, und die Kommission scheint inzwischen zurückzuweichen, vor allem im Verfahren gegen X, das die Speerspitze der DSA-Durchsetzung bildet. An Musks Freie-Rede-Plattform wollte die EU als erstes gehen, um ein Exempel zu statuieren gegen einen politischen Akteur, der im klaren Gegensatz zu vielen EU-Regierenden stand. Der neue Bericht zeigt, dass diese Schützenhilfe der Republikaner für X (und andere Plattformen) über den Bruch zwischen Musk und Trump hinaus halten könnte. Die EU stellt sich damit an die Seite von Lula-Brasilien, in dem ein Oberster Richter Musk mit der Abschaltung seiner Plattform drohte.
Im Bericht des Repräsentantenhauses heißt es: „Auf dem Papier ist der DSA schlecht. In der Praxis ist er noch schlimmer.“ Die „europäischen Zensoren“ hätten es auf „Kernbereiche des politischen Diskurses“ abgesehen, die „weder schädlich noch illegal“ seien. Vielmehr gehe es der EU darum, kritische Debatten über Einwanderung und Umweltschutz abzuwürgen. Gemeint ist offenbar jedwede Kritik an der Massenzuwanderung oder am Klimaschutzdogma. Die stattfindende Zensur richte sich dabei „weitgehend einseitig“ gegen Konservative. Die Repräsentanten kommen zum Schluss, dass nicht die Online-Debatte schädlich ist, sondern das Gesetz, das sie inkriminiert. Und daneben bilden auch Satire und Humor gelegentlich das Ziel der Zensoren, wie deutsche Nutzer erfahren mussten. Und es geht dabei, nicht nur laut den US-Repräsentanten, um ganz bestimmte Meinungen, die unter Strafe gestellt oder zumindest beseitigt werden sollen.
Davon wollen natürlich die Mitglieder der EU-Kommission nichts wissen. Sie bewegen sich noch immer in dem festen Glauben, dass Meinungsfreiheit „ein Grundrecht in der EU“ sei und folglich auch stets im Zentrum der EU-Gesetzgebung steht. Aber in einem geheimen Kommissions-Workshop, von dem Politico im März berichtete, ging es um verschiedene „Szenarien“, mit denen Plattformbetreiber konfrontiert wurden und zu denen sie Stellung nehmen sollten. In einem dieser Szenarien ging es um den Satz „Wir müssen unser Land wieder zurückerobern“, dazu das Bild einer Frau im Hidschab, die ihrerseits als „Terroristin in Verkleidung“ betitelt war. Laut der EU-Kommission werden durch dieses Bild unbekannte Nutzer einer „widergesetzlichen Hassrede“ ausgesetzt. Offenbar fordert die Kommission von den Tech-Firmen, dass sie solche kontroversen Darstellungen zensieren. Doch mit welchem Recht, fragt der Bericht der Repräsentanten, wenn in den USA ähnliche Sätze ganz selbstverständlich auch von linksgerichteten Politikern wie Kamala Harris verwendet werden.
Den US-Repräsentanten kam es zudem spanisch vor, dass die Kommission ihren „Workshop“ geheim hielt, was man wiederum als Hinweis auf die sinistren, nicht für die Öffentlichkeit geeigneten Absichten der Kommission nahm: Die Kommission wolle die „von ihr angestrebte Zensur verbergen“.
Der DSA (deutsch Gesetz für digitale Dienste, GdD) ist seit Februar 2024 und betrifft auf EU-Ebene die „sehr großen Plattformen“ (VLOP) und Suchmaschinen (VLOSE), und zwar ganz gleich, ob ihr Sitz nun in der EU ist oder nicht. Wenn die Plattformen in der EU ihre Dienste anbieten, dann unterliegen sie auch der EU-Verordnung zu digitalen Diensten, was einerseits logisch erscheint. Andererseits gibt es der Kommission eine Möglichkeit, in die Welt hinaus zu regieren, was dann wiederum zu Zusammenstößen mit anderen führt. Die Kommission versucht insofern, Plattformen wie X, Facebook und andere auch weltweit zu transformieren. Denn natürlich sind alle Inhalte, die etwa in den USA auf die Plattformen gelangen, ebenso in der EU zugänglich – jedenfalls war das bisher so. Allerdings gibt der DSA den Mächtigen auch das Recht zur Sperrung ganzer Seiten, wie der Ex-Kommissar Thierry Breton nicht müde wurde zu betonen.
Man kann es auch anders sagen: Mit dem DSA will die EU sich das Recht zum Löschen von Inhalten unter den Nagel reißen. Nun sagen Befürworter der Verordnung, dass dieses Recht bisher bei den Plattform-Eigentümern liege, die zum Teil willkürlich davon Gebrauch gemacht hätten. Das werde durch den DSA verhindert, die Plattformen müssten nun Gründe nennen. Andere kritisieren, die Privatunternehmen hätten damit eine Funktion als Gatekeeper „an der Schwelle der Menschenrechte“ eingenommen, was zunächst einmal eine seltsame Formulierung für eine ausgebildete Juristin ist https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/digital-services-act-bedroht-internetregulierung-die-meinungsfreiheit (vielleicht kommt sie „aus dem Völkerrecht“).Der Punkt am DSA scheint zu sein, dass die EU sich diese Gatekeeper-Funktion selbst geben will. Ob es wirklich so ist, dass in den USA nur der Markt, in China der Staat und nur in der EU „der Mensch“ im Mittelpunkt steht, bleibt dahingestellt.
Daneben kritisiert der Bericht der US-Repräsentanten, dass „Faktenchecker“ und „Trusted Flagger“ von staatlichen Akteuren ausgewählt werden. Auch in Deutschland gibt es solche „Trusted Flagger“, also Figuren wie die staatlich finanzierte, Grünen-nahe „HateAid“, deren Anführer sich im US-Fernsehen ins Fäustchen lachten, als deutschen Internetnutzern die Handys beschlagnahmt wurden. Den Abstand zwischen den USA und EU-Europa kann man nicht besser darstellen: Die US-Moderatorin schien hoch erstaunt über die Tatsache, dass in der EU digitale Gerätschaften willkürlich konfisziert werden, die heute Ausdruck von persönlicher Freiheit sind. Gewisse „Eliten-Teile“ in Europa finden das akzeptabel, und mehr als das: Sie freuen sich über den Schock der Konfiszierten. Schadenfreude ist ein deutsches Wort, das im Englischen unübersetzt bleibt.
„Trusted Flagger“ und „Faktenchecker“ nimmt man im Trump-Lager keineswegs als neutral wahr. Und in der Tat besagt die staatliche Finanzierung der Organisationen meist schon alles. Es sind letztlich Regierungsangestellte, die ihren Job brav erledigen, wenn sie sich die Kritiker der regierenden Parteien vornehmen und den Status quo verteidigen. Man kennt das aus entsprechenden Portalen in Deutschland (Correctiv, Volksverpetzer) nach dem Muster: „Böse Rechte behaupten, die Lage wäre schlecht. Aber in Wahrheit ist alles sehr gut.“ Man sieht, Europa ist vielleicht doch nicht so weit weg von chinesisch-neokommunistischer Staatsbesoffenheit.








 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























