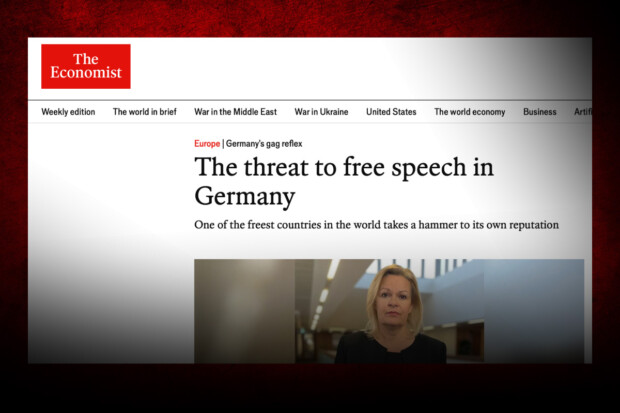
Der Economist ist alles andere als ein rechtspopulistisches, sondern eines der renommiertesten Wirtschaftsmagazine der westlichen Welt – umso bemerkenswerter ist die Klarheit, mit der das Medium Deutschlands Umgang mit der Meinungsfreiheit anprangert. In einem aktuellen Beitrag heißt es unmissverständlich: „Eines der freiesten Länder der Welt nimmt den Vorschlaghammer und zertrümmert seinen eigenen Ruf.“ Der Anlass: ein Gerichtsurteil gegen den Journalisten David Bendels, das symptomatisch für einen tiefgreifenden Wandel im politischen Klima steht.
Bendels hatte ein satirisch manipuliertes Bild von Bundesinnenministerin Nancy Faeser veröffentlicht, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ zu tragen scheint – eine provokante Satire, aber zweifellos als solche erkennbar. Doch anstatt das Ganze mit politischer Gelassenheit zur Kenntnis zu nehmen, reichte Faeser Strafanzeige ein. Das Ergebnis: eine siebenmonatige Bewährungsstrafe, eine saftige Geldbuße und die Verpflichtung zu einer öffentlichen Entschuldigung. Der Economist kommentiert das trocken, aber schneidend: „Sie schien entschlossen, Mr. Bendels recht zu geben.“
Der Fall wurde so zur realen Bestätigung seiner eigenen Satire. Und er ist kein Einzelfall. In Deutschland reichen heute ein Tweet, ein Bild oder ein flapsiger Kommentar – und man riskiert rechtliche Konsequenzen. Der Economist erinnert an den Fall eines Rentners, der auf X den Vizekanzler Robert Habeck als „Idiot“ bezeichnete und prompt eine Hausdurchsuchung durch die Polizei erlebte. Oder an den Fall des Journalisten Don Alphonso, der Habeck mit „Bahnhofstrinkern“ verglich und deswegen verurteilt wurde – das Urteil wurde später aufgehoben. Solche Eingriffe, so das Magazin, „gehen weit über den Schutz der Würde hinaus – sie sind Einschüchterung mit juristischen Mitteln.“
Die Begründungen dafür werden zunehmend schwammig. So urteilte das Gericht im Fall Bendels, ein „unparteiischer Beobachter“ könne möglicherweise nicht erkennen, dass das Bild manipuliert sei. Eine Annahme, die man bestenfalls als realitätsfern, schlimmstenfalls als zynisch bezeichnen kann. Damit wurde Faesers Recht auf Schutz vor Verleumdung über das Recht auf freie Meinungsäußerung gestellt – in einem Land, dessen Verfassung das Gegenteil vorsieht. „Das Gleichgewicht zwischen Schutz und Freiheit kippt“, mahnt der Economist.
Selbst prominente Juristen schlagen Alarm. Der Medienanwalt Christian Schertz, der sonst eher aufseiten klagefreudiger Politiker steht, nennt das Urteil gegen Bendels „exzessiv“. Doch in der politischen Führung scheint niemand innehalten zu wollen: Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, gezielt gegen die „vorsätzliche Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen“ vorgehen zu wollen. Was als Kampf gegen Desinformation verkauft wird, öffnet die Tür für willkürliche Zensur. Der Economist fragt zurecht: „Wie lange noch, bis eine Karikatur als Angriff auf die Demokratie gewertet wird?“
Besonders alarmierend: Die Bevölkerung spürt diesen Wandel längst. Laut einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2024 glauben nur noch 40 Prozent der Deutschen, ihre Meinung frei äußern zu können – ein historischer Tiefstand, der sich seit 1990 halbiert hat. Deutschland, einst Vorbild für die freie Gesellschaft, gleitet ab in einen Zustand, in dem politisch Unliebsames nicht mehr argumentativ widerlegt, sondern strafrechtlich geahndet wird. „In Deutschland riskiert man inzwischen Gefängnis für einen gemeinen Tweet“, zitiert der Economist den US-Vizepräsidenten J.D. Vance – und lässt die Aussage unkommentiert stehen. Weil sie für sich spricht.









 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























